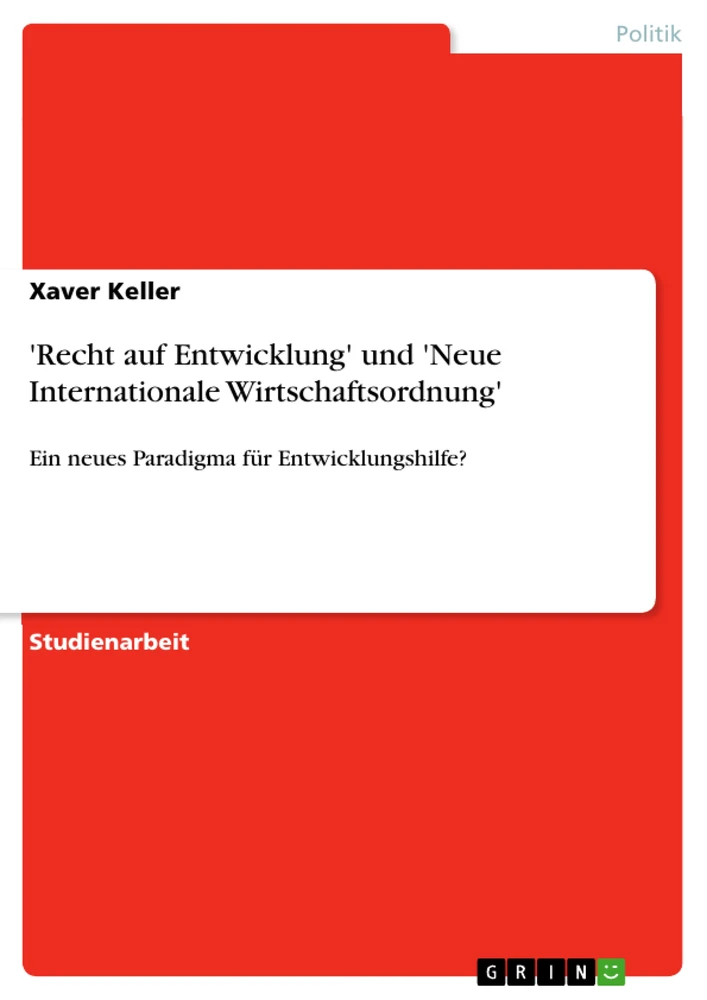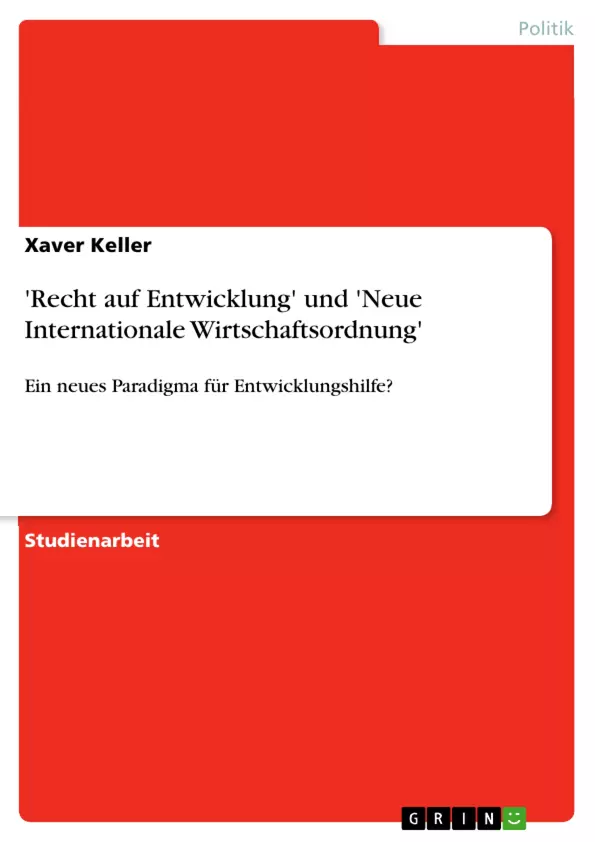Die vorliegende Arbeit untersucht das „Recht auf Entwicklung“ und die „Neue In-ternationale Wirtschaftsordnung“ in Bezug auf Entwicklungshilfe (EH). Diese bei-den Konzepte, die im allgemeinen EH-Diskurs eine eher untergeordnete Rolle spie-len, sind Ergebnisse der Auseinandersetzungen, die in den 1960er und 1970er-Jahren innerhalb der Vereinten Nationen zwischen Industrie- und Entwicklungs-ländern stattgefunden haben und heute in anderen Formen fortexistieren. Die Ar-beit untersucht, welche Auffassung von EH in die beiden Konzepte eingegangen ist und ob sich diese von der momentanen EH-Praxis unterscheidet. Insbesondere wird überprüft, ob die beiden Konzepte eine Verpflichtung der Industrieländer zu EH-Leistungen beinhaltet und ob sich aus ihnen Veränderungen im Verhältnis zwischen Geber- und Nehmerländern ableiten lassen.
Inhaltsverzeichnis
- ABKÜRZUNGEN
- EINLEITUNG
- ENTSSTEHUNG UND INHALT DER KONZEPTE
- HISTORISCHER KONTEXT
- INHALT
- RECHT AUF ENTWICKLUNG
- NEUE INTERNATIONALE WIRTSCHAFTSORDNUNG
- VERGLEICH DER KONZEPTE
- ENTWICKLUNGSBEGRIFF
- MEHRDIMENSIONALITÄT
- BEDÜRFNISORIENTIERUNG
- VERTEILUNGSGERECHTIGKEIT
- PARTIZIPATION
- INTERNATIONALE WIRTSCHAFTSORDNUNG
- RECHT AUF ENTWICKLUNG
- NEUE INTERNATIONALE WIRTSCHAFTSORDNUNG
- ENTWICKLUNGSHILFE
- BEGRÜNDUNG VON ENTWICKLUNGSHILFE
- VERHÄLTNIS ZWISCHEN GEBER UND NEHMER
- ENTWICKLUNGSBEGRIFF
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzepte des „Rechts auf Entwicklung“ und der „Neuen Internationalen Wirtschaftsordnung“ im Kontext der Entwicklungshilfe (EH). Sie analysiert die historischen Wurzeln dieser Konzepte, die in den 1960er und 1970er Jahren im Rahmen der Vereinten Nationen entstanden sind, und untersucht, welche Vorstellung von EH in ihnen enthalten ist. Die Arbeit überprüft, ob diese Konzepte eine Verpflichtung der Industrieländer zur Bereitstellung von EH-Leistungen beinhalten und ob sich daraus Veränderungen im Verhältnis zwischen Geber- und Nehmerländern ableiten lassen.
- Die historische Entwicklung und der Inhalt der Konzepte des „Rechts auf Entwicklung“ und der „Neuen Internationalen Wirtschaftsordnung“
- Der Vergleich der beiden Konzepte in Bezug auf den Entwicklungsbegriff, die internationale Wirtschaftsordnung und die Rolle der Entwicklungshilfe
- Die Begründungen für Entwicklungshilfe und das Verhältnis zwischen Geber- und Nehmerländern
- Die Frage, ob die Konzepte eine Verpflichtung der Industrieländer zur Bereitstellung von EH-Leistungen beinhalten
- Mögliche Veränderungen im Verhältnis zwischen Geber- und Nehmerländern, die sich aus den Konzepten ableiten lassen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel untersucht die historische Entstehung und den Inhalt der Konzepte des „Rechts auf Entwicklung“ und der „Neuen Internationalen Wirtschaftsordnung“. Dabei wird der Fokus auf die politischen Auseinandersetzungen innerhalb der Vereinten Nationen in den 1960er und 1970er Jahren gelegt. Im zweiten Kapitel werden die beiden Konzepte anhand verschiedener Kriterien verglichen. Diese Kriterien umfassen den Entwicklungsbegriff, die internationale Wirtschaftsordnung und die Rolle der Entwicklungshilfe. Das Kapitel geht insbesondere auf die Frage ein, ob die Konzepte eine Verpflichtung der Industrieländer zur Bereitstellung von EH-Leistungen beinhalten und ob sich daraus Veränderungen im Verhältnis zwischen Geber- und Nehmerländern ableiten lassen.
Schlüsselwörter
Entwicklungshilfe, Recht auf Entwicklung, Neue Internationale Wirtschaftsordnung, Entwicklung, Internationale Wirtschaftsordnung, Industrieländer, Entwicklungsländer, Geber-Nehmer-Verhältnis, Vereinte Nationen, politische Auseinandersetzungen, 1960er Jahre, 1970er Jahre.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Konzepte dieser Untersuchung?
Die Arbeit untersucht das „Recht auf Entwicklung“ und die „Neue Internationale Wirtschaftsordnung“ im Kontext der Entwicklungshilfe.
Wann entstanden diese Konzepte historisch?
Sie sind das Ergebnis politischer Auseinandersetzungen innerhalb der Vereinten Nationen in den 1960er und 1970er Jahren zwischen Industrie- und Entwicklungsländern.
Gibt es eine Verpflichtung der Industrieländer zur Entwicklungshilfe?
Die Arbeit prüft kritisch, ob aus diesen beiden Konzepten eine völkerrechtliche oder moralische Verpflichtung der Industrieländer zu EH-Leistungen abgeleitet werden kann.
Wie unterscheiden sich die Konzepte von der heutigen Praxis?
Die Untersuchung analysiert, ob die in den Konzepten enthaltenen Vorstellungen von Entwicklungshilfe (z.B. Partizipation und Verteilungsgerechtigkeit) von der aktuellen Praxis abweichen.
Welche Kriterien werden für den Vergleich der Konzepte herangezogen?
Verglichen werden der Entwicklungsbegriff (Mehrdimensionalität, Bedürfnisorientierung), die internationale Wirtschaftsordnung und das Verhältnis zwischen Gebern und Nehmern.
- Citar trabajo
- Xaver Keller (Autor), 2011, 'Recht auf Entwicklung' und 'Neue Internationale Wirtschaftsordnung', Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175187