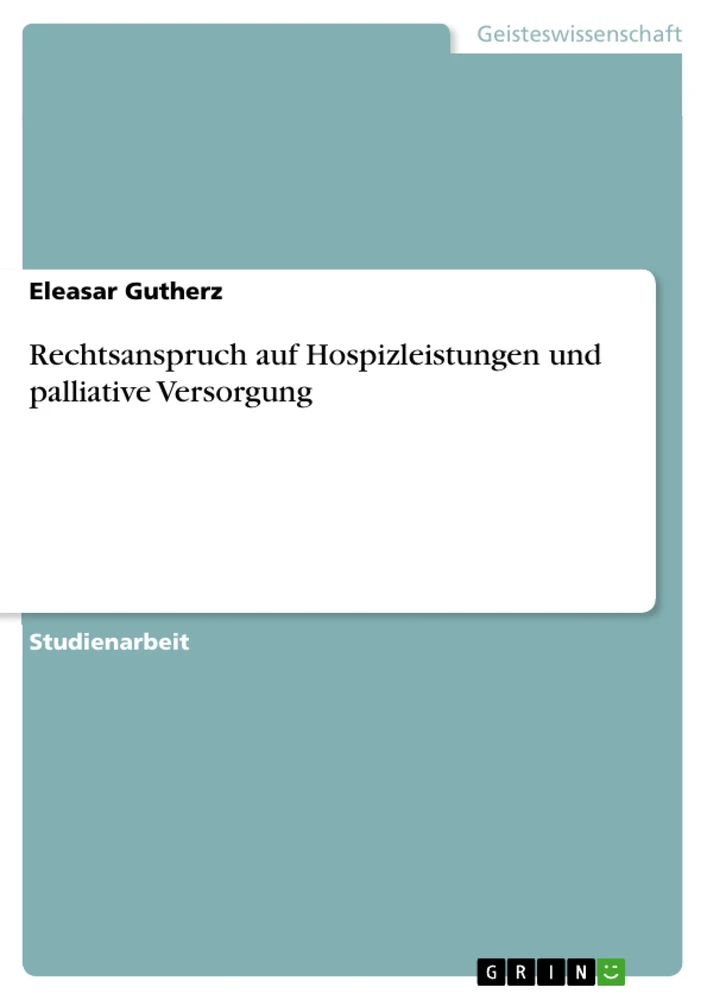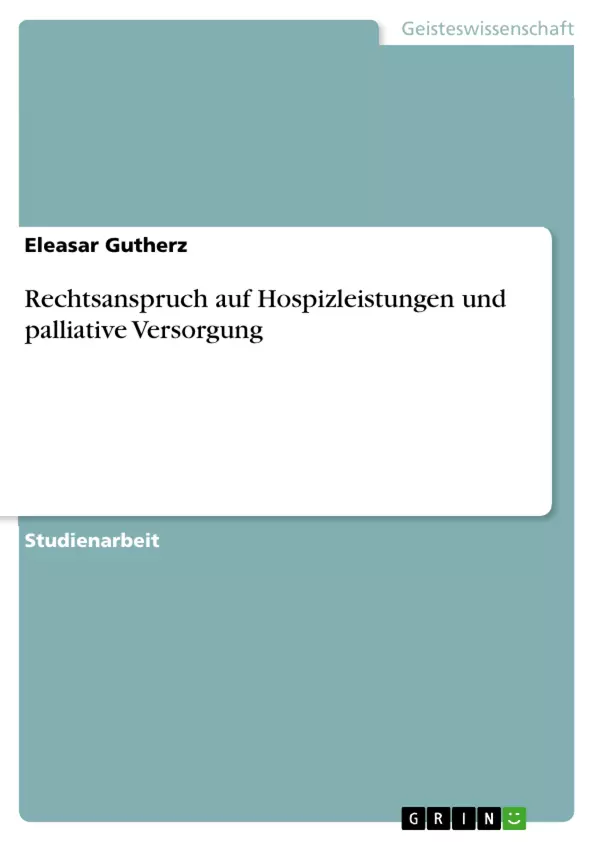Geklärt werden soll die aktuelle Regelung des Rechtsanspruchs auf Hospiz und palliative Versorgung, indem § 37b SGBV und § 39a SGBV anhand verschiedener Kommentare untersucht werden; genutzt werden ebenso die zugehörigen Rahmenvereinbarungen und Richtlinien, aber auch wissenschaftliche Beiträge aus der SGb und dem GesR.
Inhaltsverzeichnis
- 1. § 37b SGBV – Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
- 1.1. Allgemeine Einleitung in den § 37b SGBV zur Regelung der „spezialisierten ambulanten Palliativversorgung“ (SAPV)
- 1.2. Anspruchsvoraussetzungen auf SAPV - § 37b I 1 SGBV
- 1.3. Verordnung durch den Arzt und Entscheidung durch die Krankenkasse - § 37b I 2 SGBV
- 1.4. Leistungsinhalt der SAPV - § 37b I 3 SGBV
- 1.5. Anspruch auf ärztliche Teilleistung im stationären Hospiz - § 37b I4 SGBV
- 1.6. Keine Kostenverlagerung zulasten der gesetzlichen KV - § 37b I 5 SGBV
- 1.7. SAPV für Kinder - § 37b I 6 SGBV
- 1.8. Anspruch auf SAPV in Pflegeeinrichtungen - § 37b II 1 SGBV
- 1.9. Leistungserbringer der SAPV in Pflegeeinrichtungen - § 37b II 2 SGBV
- 1.10. Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) - § 37b II 3 SGBV
- 2. § 39a SGBV - Stationäre und ambulante Hospizleistungen
- 2.1. Allgemeine Einleitung in den §39a SGBV zur Regelung der Hospizleistungen und der Förderung derselben
- 2.2. Anspruchsvoraussetzungen auf (teil-)stationäre Versorgung, Prüfung durch Arzt und Medizinischen Dienst - § 39a I 1 SGBV
- 2.3. Finanzierung durch Zuschuss - § 39a I 2,3 SGBV
- 2.4. Konkretisierungsauftrag - § 39a I 4 SGBV
- 2.5. Achtung der Belange von Kindern - § 39a I 5 SGBV
- 2.6. Anhörung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung - § 39a I 6 SGBV
- 2.7. Schiedsverfahren bei Nichteinigung - § 39a I 7-9 SGBV
- 2.8. Ambulante Hospizversorgung - § 39a II SGBV
- 2.9. Förderungsverpflichtung und Förderungsvoraussetzungen - § 39a II 1,2 SGBV
- 2.10. Leistungsinhalt - Schulung Ehrenamtlicher § 39a II 3 SGBV
- 2.11. Förderung durch Zuschuss § 39a II 4-6 SGBV
- 2.12. Konkretisierungsauftrag – Belange von Kindern sind zu berücksichtigen - § 39a II 7,8 SGBV
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem rechtlichen Anspruch auf Hospizleistungen und palliative Versorgung. Sie zielt darauf ab, die grundlegenden Rechtsnormen, insbesondere § 37b SGBV und § 39a SGBV, anhand von Rechtskommentaren und Richtlinien zu analysieren. Die Arbeit fokussiert auf die aktuelle Rechtslage und den rechtlichen Kerngehalt des Anspruchs.
- Der Anspruch auf spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) nach § 37b SGBV
- Der Anspruch auf stationäre und ambulante Hospizleistungen nach § 39a SGBV
- Die Anspruchsvoraussetzungen für die jeweiligen Leistungen
- Der Leistungsinhalt und die Leistungserbringung
- Die Finanzierung der Leistungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. § 37b SGBV – Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
Dieses Kapitel behandelt die Einführung des § 37b SGBV im Jahr 2007, das die „spezialisierte ambulante Palliativversorgung“ (SAPV) regelt. Es werden die Gründe für die Einführung dieser Regelung, die Versorgungslücke, die sie schließen soll, sowie die Hintergründe der SAPV im Vergleich zu anderen Versorgungsformen erläutert. Der Fokus liegt auf der Anspruchsvoraussetzung, den Leistungserbringer, dem Leistungsinhalt und der Finanzierung der SAPV.
2. § 39a SGBV - Stationäre und ambulante Hospizleistungen
Dieses Kapitel widmet sich dem § 39a SGBV, der die stationären und ambulanten Hospizleistungen regelt. Die Einführung, die Geschichte und die Hintergründe der Hospizbewegung in Deutschland werden kurz beleuchtet. Anschließend wird auf die Anspruchsvoraussetzungen, die Finanzierung durch Zuschüsse, den Leistungsinhalt und die Förderung von Hospizen eingegangen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind das Recht auf Hospizleistungen und palliative Versorgung. Die Schwerpunkte liegen auf den Rechtsnormen § 37b SGBV (spezialisierte ambulante Palliativversorgung) und § 39a SGBV (stationäre und ambulante Hospizleistungen), Anspruchsvoraussetzungen, Leistungsinhalt, Leistungserbringung und Finanzierung. Weitere relevante Begriffe sind Krankenversicherung, Palliativmedizin, Hospizbewegung, Schwerstkranke, Sterbebegleitung, Gemeinsamer Bundesausschuss, Richtlinien, Rechtskommentare.
Häufig gestellte Fragen
Was regelt § 37b SGB V?
Dieser Paragraf regelt den Anspruch auf die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) für Schwerstkranke in ihrer häuslichen Umgebung.
Was ist der Unterschied zwischen Hospizleistung und Palliativversorgung?
Palliativversorgung fokussiert auf die medizinisch-pflegerische Linderung von Leiden (§ 37b), während Hospizleistungen (§ 39a) die ganzheitliche Sterbebegleitung in stationären oder ambulanten Einrichtungen umfassen.
Wer hat Anspruch auf SAPV?
Anspruch haben Versicherte mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden Erkrankung und einer begrenzten Lebenserwartung, die eine besonders aufwendige Versorgung benötigen.
Wie werden stationäre Hospizleistungen finanziert?
Die Finanzierung erfolgt gemäß § 39a SGB V durch Zuschüsse der Krankenkassen, wobei ein Teil der Kosten oft durch Spenden des Hospizträgers gedeckt werden muss.
Gibt es spezielle Regelungen für Kinderhospize?
Ja, das Gesetz sieht vor, dass bei der Ausgestaltung der Leistungen die besonderen Belange von Kindern und Jugendlichen ausdrücklich zu berücksichtigen sind.
Welche Rolle spielt der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA)?
Der G-BA erlässt Richtlinien, die den Leistungsinhalt und die Voraussetzungen für die spezialisierte Palliativversorgung im Detail konkretisieren.
- Quote paper
- Eleasar Gutherz (Author), 2011, Rechtsanspruch auf Hospizleistungen und palliative Versorgung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175239