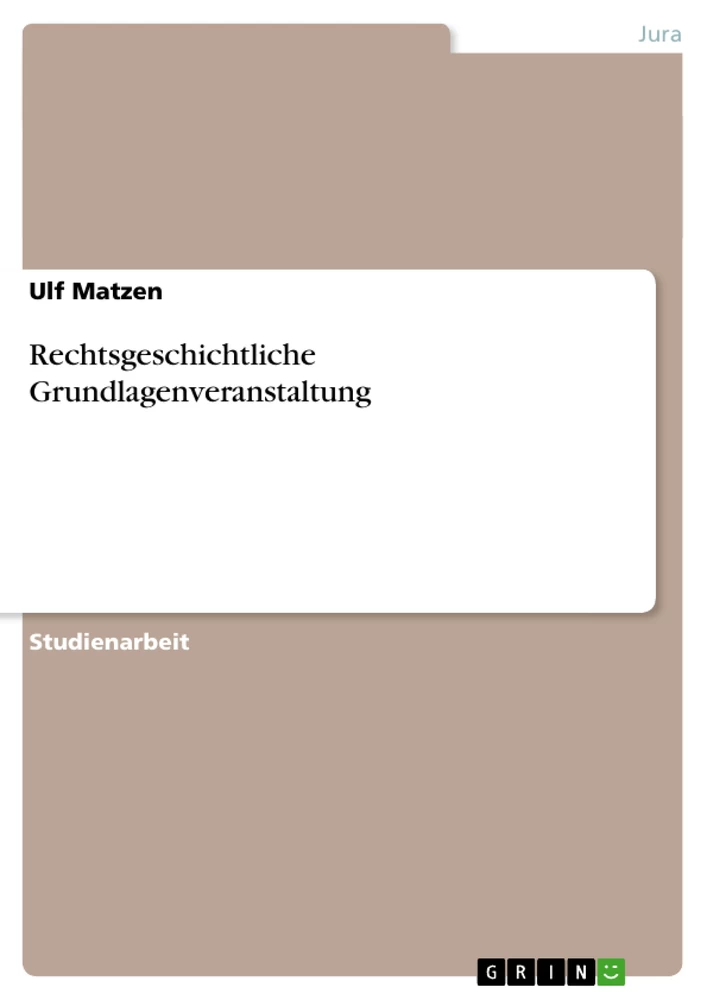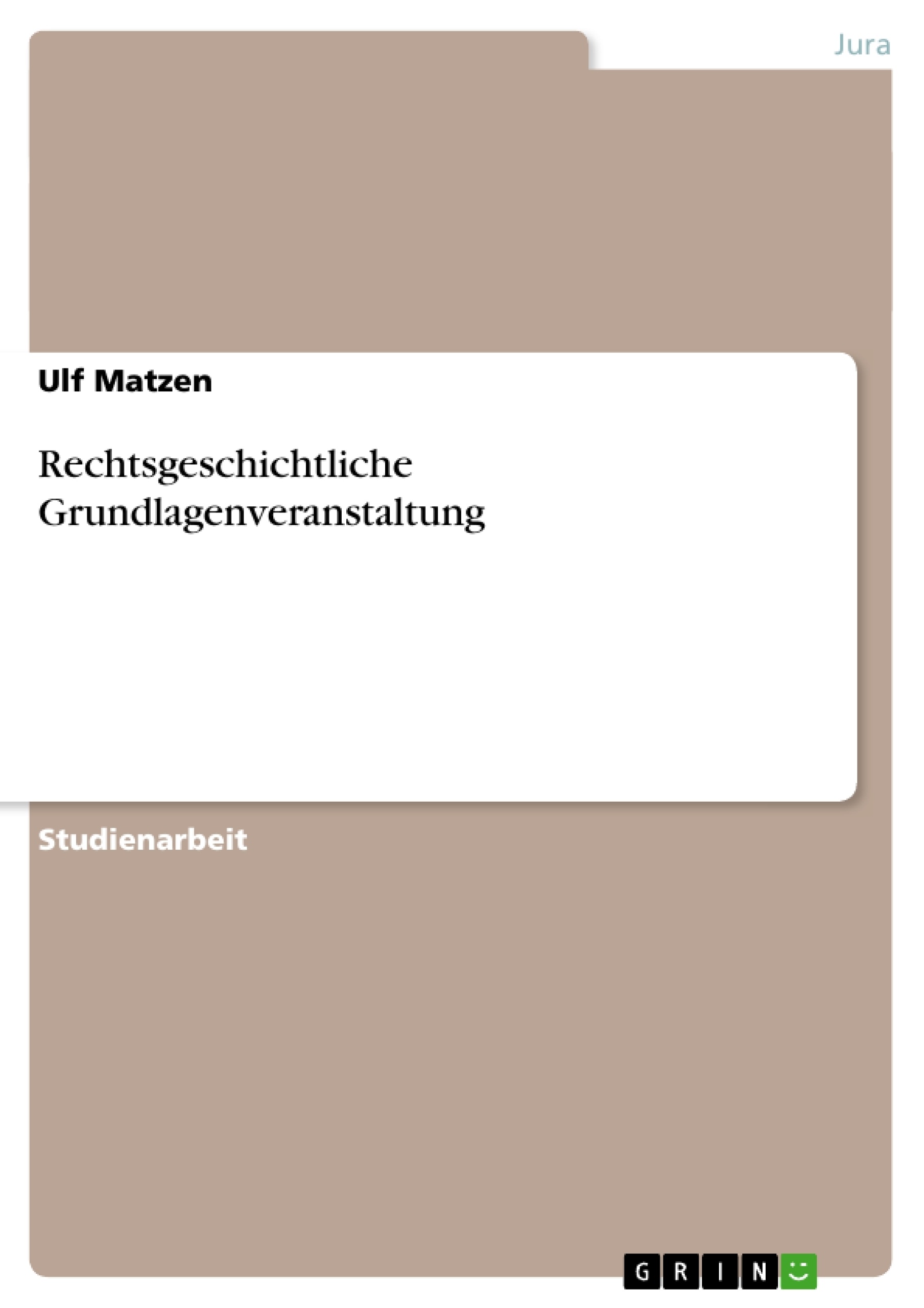Der Autor des Textes ist der bedeutende römische Spätklassiker
Ulpian, eigentlich Domitius Ulpianus. Er wurde ca. 190 n. Chr.
in Tyros geboren. Eine Karriere in der römischen Verwaltung
machte ihn zum Assessor des praefaectus praetorio Papinian.
222 n.Chr. übernahm Ulpian das Amt des praefaectus praetorio.
223 n.Chr. wurde er von der Praetorianergarde ermordet, deren
Korruption er bekämpft hatte. Er ist der römische Jurist, aus
dessen Werken am meisten überliefert wurde. Aus seinem 81
Bücher umfassenden Kommentar zum praetorianischen Edikt
wird in den Digesten zitiert. Der erste Text ist ein Fragment aus dem 31.Buch der
Kommentare des Ulpian zum praetorianischen Edikt. Er wurde
als Teil der Digesten überliefert. Der Praetor war der für die Gerichtsbarkeit zuständige höchste
Beamte der römischen Verwaltung. In seinem Edikt legte er zu
Beginn seiner einjährigen Amtszeit die Grundsätze fest, nach
denen er während dieser verfahren wollte. Es war üblich, dass
ein neuer Praetor das so festgelegte "Amtsrecht" seines
Vorgängers übernahm und es durch eigene Vorstellungen
ergänzte. Die praetorianischen Edikte dienten somit der
Rechtsfortbildung, bis ihr Inhalt unter Hadrian abschließend
festgelegt wurde. [...]
Inhaltsverzeichnis
- A.) Text 1.): D. 17, 1, 12, 9 (Ulpianus libro 31° ad edictum)
- I.)
- 1.)
- 2.)
- 3.)
- II.)
- 1.)
- 2.)
- III.)
- I.)
- B.) Text 2.): Samuel Pufendorf
- I.)
- 1.)
- 2.)
- 3.)
- II.)
- 1.)
- 2.)
- 3.)
- I.)
- C.) Text 3.): Österreichisches ABGB (1811)
- 1.)
- 2.)
- 3.)
- 4.)
- D.) Text 4.): Motive zu dem Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich
- 1.)
- 2.)
- 3.)
- 4.)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert verschiedene Rechtstexte aus verschiedenen Epochen der Rechtswissenschaft und untersucht, wie das Rechtsproblem des Auftrags im Laufe der Zeit behandelt wurde.
- Das Rechtsproblem des Auftrags und seine historische Entwicklung
- Die unterschiedlichen Rechtslösungen in verschiedenen Epochen
- Die Rechtsfolgen eines Auftrags
- Die Rechtsvergleichung und der Bezug zur Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
A.) Text 1.): D. 17, 1, 12, 9 (Ulpianus libro 31° ad edictum)
Dieses Kapitel analysiert den Rechtstext aus den Digesten, der die Rechtsfolgen eines Auftrags beschreibt. Es wird auf die Rechtsqualität des Textes, den Autor und die Stilepoche eingegangen. Darüber hinaus werden der rechtlich bedeutsame Sachverhalt, der Begriff und Inhalt des mandatum, der Gegenanspruch des Beauftragten, sowie die Rechtsfolgen und Einordnung des Textes behandelt.
B.) Text 2.): Samuel Pufendorf
Das Kapitel behandelt den Text von Samuel Pufendorf und untersucht dessen Rechtsqualität, den Autor und die Stilepoche. Es wird auf die Auslegung des Textes, die Ermittlung des rechtlich bedeutsamen Sachverhalts, die Feststellung der Rechtsfolge und die Einordnung des Textes im Kontext der Rechtsgeschichte eingegangen.
C.) Text 3.): Österreichisches ABGB (1811)
Dieses Kapitel befasst sich mit den einschlägigen Paragraphen des österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB). Es behandelt den Text, die Stilepoche, die Auslegung und die Rechtsvergleichung mit anderen Rechtstexten.
D.) Text 4.): Motive zu dem Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich
Das Kapitel analysiert den Text aus den Motiven zum Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich. Es befasst sich mit dem Text selbst, der Stilepoche, der Auslegung und der Rechtsvergleichung im Kontext der Rechtsgeschichte.
Schlüsselwörter
Auftrag, Mandatum, Rechtsproblem, Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung, Rechtsfolgen, Stilepoche, Digesten, Pufendorf, ABGB, Bürgerliches Gesetzbuch, Gegenwartsbezug
Häufig gestellte Fragen
Wer war Ulpian und welche Bedeutung hat er für das Recht?
Domitius Ulpianus war ein bedeutender römischer Jurist (ca. 190-223 n. Chr.). Seine Kommentare zum praetorischen Edikt machen einen großen Teil der späteren Digesten aus.
Was versteht man unter einem "mandatum" im römischen Recht?
Ein mandatum (Auftrag) ist ein Vertrag, bei dem eine Person unentgeltlich ein Geschäft für eine andere übernimmt. Es ist die historische Grundlage des heutigen Auftragsrechts.
Wie entwickelte sich das Auftragsrecht in der Neuzeit?
Die Arbeit zeigt die Entwicklung über Denker wie Samuel Pufendorf bis hin zu modernen Kodifikationen wie dem österreichischen ABGB und dem deutschen BGB.
Was ist das praetorische Edikt?
Es war eine Bekanntmachung des römischen Praetors zu Beginn seiner Amtszeit, in der er die Rechtsgrundsätze festlegte, nach denen er verfahren wollte. Es diente der Rechtsfortbildung.
Welche Rolle spielt die Rechtsvergleichung in dieser Arbeit?
Die Arbeit vergleicht Texte aus verschiedenen Epochen, um Kontinuitäten und Brüche in der rechtlichen Behandlung von Aufträgen und deren Haftungsfolgen aufzuzeigen.
- Quote paper
- Ulf Matzen (Author), 1993, Rechtsgeschichtliche Grundlagenveranstaltung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17538