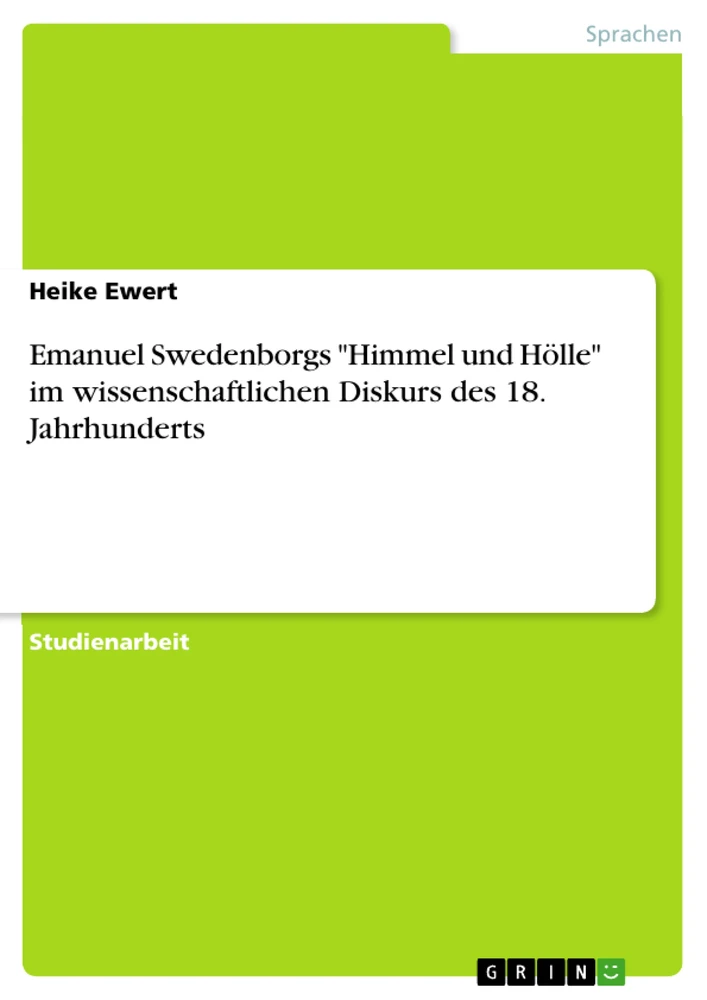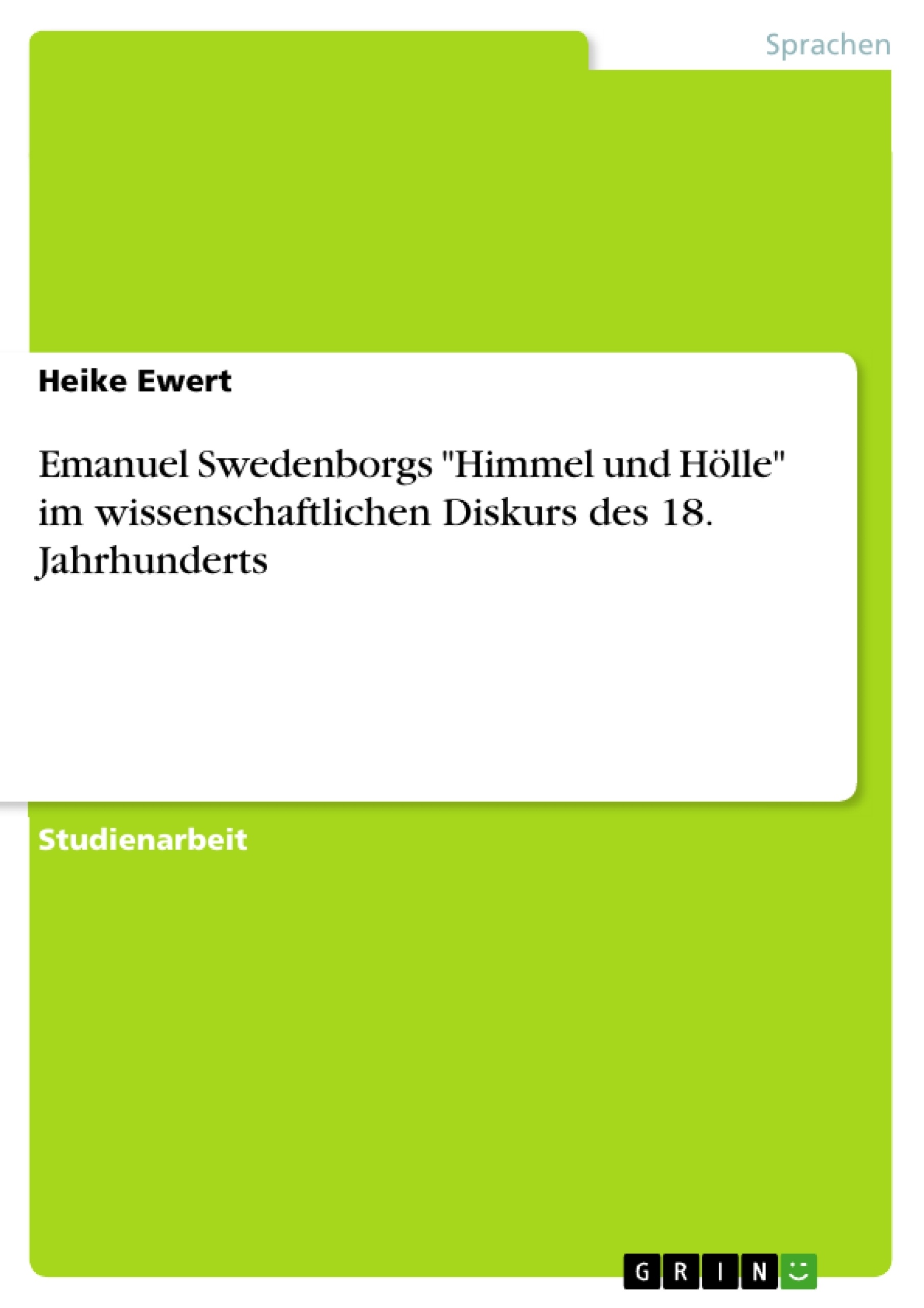Einleitung
Das 18. Jahrhundert birgt in sich den scheinbaren Widerspruch sowohl das Zeitalter der Vernunft, als auch ein Jahrhundert der Spiritualität und des Okkulten zu sein. Neuere Forschungsansätze, wie etwa die des Interdisziplinären Zentrums für die Erforschung der Europäischen Aufklärung, gehen jedoch davon aus, dass hier nicht zwei unvereinbare Pole aufeinandertreffen, sondern, dass die beiden Aspekte einander bedingen und sich gegenseitig beeinflussen. Meine Arbeit zielt darauf ab, Himmel und Hölle (1758) von Emanuel Swedenborg vor diesem Hintergrund zu untersuchen. Mein Schwerpunkt liegt dabei darauf, zu erforschen, inwiefern Swedenborg auch mit seinen visionären Schriften, in diesem Fall Himmel und Hölle, in den Wissenschaftsdiskursen des 18. Jahrhunderts zu verorten ist. Dazu soll im zweiten Kapitel kurz Swedenborgs Biografie betrachtet werden, im Besonderen seine naturwissenschaftliche Arbeit und sein religiöser Hintergrund. Desweiteren wird die Textart von Himmel und Hölle diskutiert, die einen Hinweis auf die Intention und das Selbstverständnis des Autors liefern kann.
Kapitel 3 stellt eine Einführung in Swedenborgs Zeichenmodell dar, das als Basis für die Korrespondenzlehre, die als Deutungs- und Argumentationsmodell in Himmel und Hölle eine entscheidende Rolle spielt (Kapitel 4). Als ebenso wichtig in Bezug auf Argumentationsstruktur und darauf basierende Verortung Swedenborgs in wissenschaftliche Kontexte des 18. Jahrhunderts sind seine Visionen und Geistergespräche, deren textuelle Funktion im 6. Kapitel erörtert wird. Kapitel 5 bietet eine kurze Einführung in den Wissenschaftsdiskurs des 18. Jahrhunderts, deren wichtigste Erkenntnis ist, dass Kanonisierung von Wissen der Hauptfaktor dessen ist, was man als okkult oder wissenschaftlich bezeichnen kann.
Im letzten Kapitel wird dieser Aspekt noch einmal aufgenommen, indem die Rezeption von Swedenborgs (visionärem) Werk dargestellt wird mit besonderem Augenmerk auf die Kritik Kants, die eine entscheidende Rolle bei der späteren Akzeptanz und Rezeption von Swedenborgs Werk einnimmt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Swedenborgs Biografie und Himmel und Hölle
- Das Zeichen und sein göttlicher Sinn
- Swedenborgs Korrespondenzlehre
- Okkultismus und Aufklärung
- Empirische Praktiken in Himmel und Hölle
- Rezeption von Swedenborgs Werk
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Emanuel Swedenborgs "Himmel und Hölle" (1758) im Kontext des 18. Jahrhunderts, das sowohl als Zeitalter der Vernunft als auch der Spiritualität gilt. Die Arbeit erforscht, wie Swedenborgs visionäre Schriften in den wissenschaftlichen Diskurs dieser Epoche einzuordnen sind. Der Fokus liegt auf der Interaktion zwischen Swedenborgs naturwissenschaftlichem Hintergrund und seinen mystischen Visionen.
- Swedenborgs Biografie und seine wissenschaftliche Arbeit im Verhältnis zu seinen religiösen Visionen
- Die Rolle von Swedenborgs Zeichenmodell und Korrespondenzlehre in "Himmel und Hölle"
- Die Einordnung von Swedenborgs Werk in den okkulten und wissenschaftlichen Diskurs des 18. Jahrhunderts
- Die Funktion von Visionen und Geistergesprächen in der Argumentation von "Himmel und Hölle"
- Die Rezeption von Swedenborgs Werk, insbesondere die Kritik Kants
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Einordnung von Swedenborgs "Himmel und Hölle" in den wissenschaftlichen Diskurs des 18. Jahrhunderts. Sie hebt den scheinbaren Widerspruch zwischen Rationalität und Spiritualität im 18. Jahrhundert hervor und argumentiert für deren gegenseitige Bedingtheit. Die Arbeit skizziert die methodische Vorgehensweise, die die Untersuchung von Swedenborgs Biografie, seinem Zeichenmodell, seiner Korrespondenzlehre, sowie die Rezeption seines Werkes umfasst.
Swedenborgs Biografie und Himmel und Hölle: Dieses Kapitel beleuchtet Swedenborgs Leben, seinen Werdegang als Naturwissenschaftler mit Studienaufenthalten in England und den Niederlanden, sowie seinen Kontakt zu bedeutenden Naturwissenschaftlern wie Newton. Es beschreibt den Wendepunkt in seinem Leben ab 1744, als er sich von der Naturwissenschaft der Bibelauslegung zuwandte, und die damit verbundenen Spekulationen über seinen mentalen Zustand. Das Kapitel betont die Ambivalenz von "Himmel und Hölle" als Werk, das sowohl Bibelauslegung als auch Visionen beinhaltet, und kündigt die weitere Untersuchung der Verknüpfung von Naturwissenschaft und Mystik in seinem Werk an.
Das Zeichen und sein göttlicher Sinn: [Hier fehlt der Text für eine Zusammenfassung dieses Kapitels im Originaltext.]
Swedenborgs Korrespondenzlehre: [Hier fehlt der Text für eine Zusammenfassung dieses Kapitels im Originaltext.]
Okkultismus und Aufklärung: Dieses Kapitel behandelt den Wissenschaftsdiskurs des 18. Jahrhunderts und betont, dass die Kanonisierung von Wissen entscheidend dafür ist, was als okkult oder wissenschaftlich bezeichnet wird. Es bereitet den Boden für die spätere Diskussion der Rezeption von Swedenborgs Werk.
Empirische Praktiken in Himmel und Hölle: [Hier fehlt der Text für eine Zusammenfassung dieses Kapitels im Originaltext.]
Rezeption von Swedenborgs Werk: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rezeption von Swedenborgs Werk und betont insbesondere die Bedeutung der Kritik Kants für die spätere Akzeptanz und Rezeption. Es unterstreicht die Offenheit von Swedenborgs Schriften für verschiedene Interpretationen und die Einordnung seines Werkes als Sozialutopie im Kontext anderer utopischer Literatur des 18. Jahrhunderts, wobei der nicht-fiktionale Anspruch des Autors hervorgehoben wird.
Schlüsselwörter
Emanuel Swedenborg, Himmel und Hölle, 18. Jahrhundert, Aufklärung, Okkultismus, Naturwissenschaft, Mystik, Korrespondenzlehre, Wissenschaftsdiskurs, Rezeption, Kant, Sozialutopie, Visionen, Geistergespräche, Bibelauslegung.
Häufig gestellte Fragen zu Emanuel Swedenborgs "Himmel und Hölle"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht Emanuel Swedenborgs Werk "Himmel und Hölle" (1758) im Kontext des 18. Jahrhunderts. Der Fokus liegt auf der Einordnung von Swedenborgs visionären Schriften in den wissenschaftlichen Diskurs dieser Epoche und der Interaktion zwischen seinem naturwissenschaftlichen Hintergrund und seinen mystischen Visionen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Themen wie Swedenborgs Biografie und seine wissenschaftliche Arbeit im Verhältnis zu seinen religiösen Visionen, die Rolle seines Zeichenmodells und seiner Korrespondenzlehre in "Himmel und Hölle", die Einordnung seines Werkes in den okkulten und wissenschaftlichen Diskurs des 18. Jahrhunderts, die Funktion von Visionen und Geistergesprächen in der Argumentation des Buches und die Rezeption von Swedenborgs Werk, insbesondere die Kritik Kants.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Swedenborgs Biografie und "Himmel und Hölle", Das Zeichen und sein göttlicher Sinn, Swedenborgs Korrespondenzlehre, Okkultismus und Aufklärung, Empirische Praktiken in "Himmel und Hölle" und Rezeption von Swedenborgs Werk. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise vor. Die Kapitel behandeln jeweils spezifische Aspekte von Swedenborgs Leben, Werk und Rezeption, wobei einige Kapitel im Originaltext unvollständig sind (fehlende Zusammenfassungen).
Wie wird Swedenborgs Werk in den wissenschaftlichen Diskurs des 18. Jahrhunderts eingeordnet?
Die Arbeit untersucht den scheinbaren Widerspruch zwischen Rationalität und Spiritualität im 18. Jahrhundert und argumentiert für deren gegenseitige Bedingtheit. Sie analysiert, wie Swedenborgs naturwissenschaftlicher Hintergrund und seine mystischen Visionen in seinem Werk interagieren und wie dies im wissenschaftlichen Diskurs der Zeit aufgenommen wurde. Die Rezeption, insbesondere die Kritik Kants, wird ebenfalls betrachtet.
Welche Rolle spielen Visionen und Geistergespräche in "Himmel und Hölle"?
Die Arbeit untersucht die Funktion von Visionen und Geistergesprächen in der Argumentation von "Himmel und Hölle" und wie diese Elemente im Kontext des wissenschaftlichen und okkulten Diskurses des 18. Jahrhunderts zu verstehen sind.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Emanuel Swedenborg, Himmel und Hölle, 18. Jahrhundert, Aufklärung, Okkultismus, Naturwissenschaft, Mystik, Korrespondenzlehre, Wissenschaftsdiskurs, Rezeption, Kant, Sozialutopie, Visionen, Geistergespräche, Bibelauslegung.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit untersucht Swedenborgs Biografie, sein Zeichenmodell, seine Korrespondenzlehre und die Rezeption seines Werkes, um die Forschungsfrage nach der Einordnung von "Himmel und Hölle" in den wissenschaftlichen Diskurs des 18. Jahrhunderts zu beantworten.
- Citation du texte
- Heike Ewert (Auteur), 2008, Emanuel Swedenborgs "Himmel und Hölle" im wissenschaftlichen Diskurs des 18. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175385