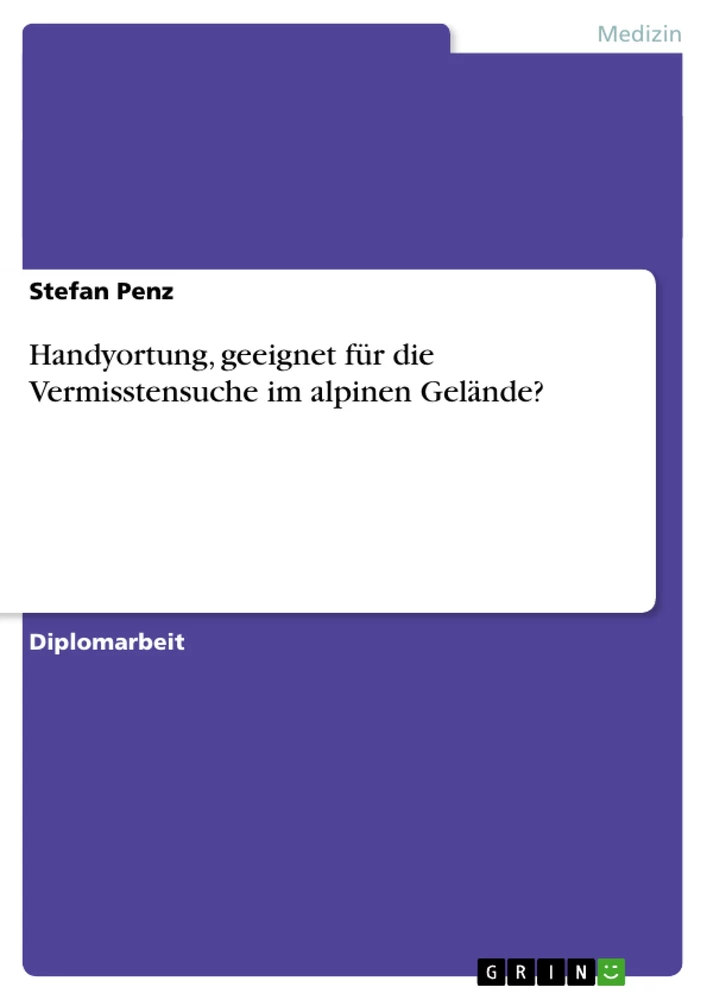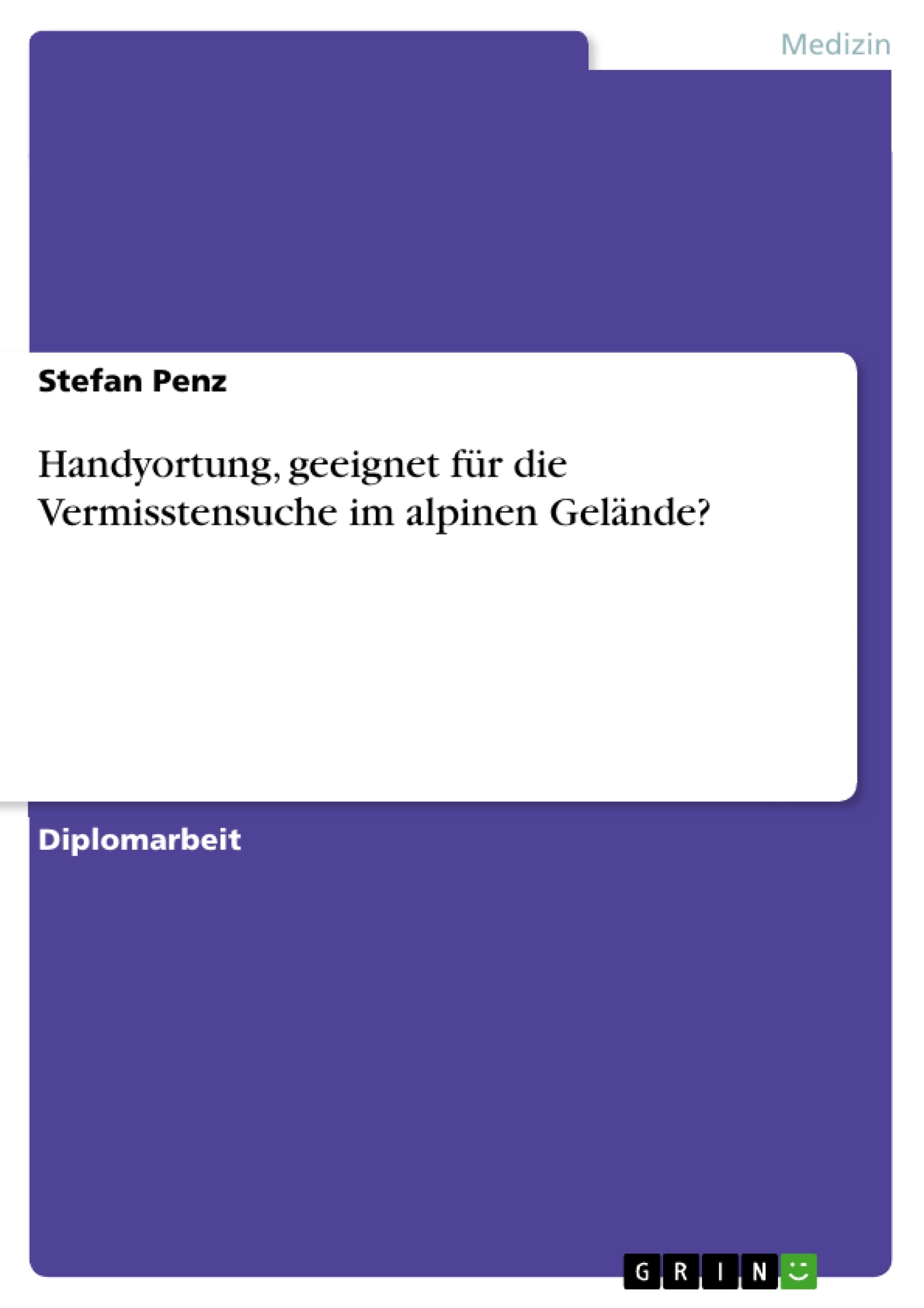Handyortung, geeignet für die Vermisstensuche im alpinen Gelände?
Abstract
Eignet sich die Handyortung für die Vermisstensuche im alpinen Gelände? Gibt es in Österreich überhaupt einen Bedarf an solchen Methoden und welche Technologien sind dazu im Stande? Untersucht werden auch ob vergleichbare Systeme in Österreich, Deutschland und den USA bereits existieren, und wie diese
einsatztaktisch in bestehende Rettungssysteme integriert sind. Die Resultate zeigen verschiedene Wege mit diesem Themenkomplex umzugehen. Dabei werden Fragen nach den rechtlichen Grundlagen und die des Datenschutzes ebenso gestreift, wie auch die Suche nach Alternativen zur Handyortung. Isoliert betrachtet ist zurzeit kein System aus sich heraus im Stande die Rettungskette entscheidend zu verkürzen, zu
orten ist außerdem eine gewisse Schnittstellenproblematik bei den einzelnen Akteuren, die viel Raum für Verbesserungen zulassen würde. Somit richtet sich die Forderung einerseits nach geänderten Rahmenbedingungen für die jeweiligen Organisationen, andererseits nach technischen Verbesserungen der Infrastruktur. In
einem Bündel an Maßnahmen, hätte die Handyortung durchaus das Potential einen entscheidenden Beitrag gegen den Alpintot zu leisten.
Is the localisation of cell phones useful for SAR-operations in an alpine environment? Is there a need for such methods in Austria, and (if yes,) which technologies are useful/of use? The essay examines if there already are such systems in Austria, Germany and the USA and how they are integrated in existing rescue organisations.The results show different ways to cope with this issue. Furthermore, the essay gives an insight into the applicable laws and data protection acts, and searches for
alternative options to the pinpointing of cell phones. There is no system which can significantly reduce the length of SAR-operations. Because some interfacing problems are to be found between the protagonists; accordingly, some enhancements could be made. On the one hand there are demands for new
parameters in the organisations themselves; on the other the technical infrastructure has to be upgraded. With some specific measurements it is entirely possible that the localisation of cell phones can prevail the death of many persons in the alpine
environment.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Statistik zur Mobilfunktechnik und Sucheinsätzen in Österreich.
- 1.1 Verbreitung der Mobilfunktechnik in Österreich
- 1.1.1 Mobile Notruf Statistik 2008
- 1.1.2 Gesamtüberblick der Mobilfunk-Notrufe 2008
- 1.2 Unfallstatistik Kuratorium für Alpine Sicherheit und Alpinpolizei 2008
- 1.2.1 Sucheinsätze in Österreich
- 1.3 Datenerhebung durch die Alpinpolizei
- 1.3.1 Aufgaben der Alpinpolizei
- 1.3.2 Struktur der AEG
- 1.3.3 Mannschaftsstärke und Ausrüstung der AEG
- 1.3.4 Zusammenarbeit mit der Fernmelde-Behörde
- 1.3.5 Definition Sucheinsatz
- 2 Aufbau eines Mobilfunknetzes.
- 2.1 Einleitung
- 2.2 Leitungsvermittelnde Datenübertragung
- 2.3 Zellulärer Aufbau und BTS
- 2.3.1 Funkzellen Größe
- 2.3.2 Funkzellendichte
- 2.4 Mobilitäts Management
- 2.5 Base Station Controller (BSC)
- 2.6 Mobile Switching Center (MSC)
- 2.6.1 Teilnehmer Datenbank (HLR), Besucher Datenbank (VLR) und Equipment Identity Register (EIR)
- 2.6.2 IMSI Identifikationsnummer
- 2.6.3 Telefonnummer oder MSISDN
- 2.6.4 Location Update
- 2.6.5 Location Areas (LA)
- 2.7 Zusammenfassung
- 3 Fortgeschrittene Ortungs- und Positionsbestimmungsverfahren
- 3.1 Begriffserklärungen
- 3.1.1 Unterschied von Ortung, Positionsbestimmung und Peilung
- 3.1.2 Präzision, Richtigkeit und Genauigkeit
- 3.1.3 Ausbeute und Konsistenz
- 3.2 Zellen-ID und Timing Advance (TA)
- 3.2.1 TA-Wert Auflösung
- 3.3 Sektorisierte Antennen
- 3.4 E-OTD - Enhanced Observed Time Difference
- 3.5 U-TDOA - Uplink Time Difference of Arrival
- 3.6 Angulationsverfahren
- 3.6.1 Assisted GPS (A-GPS)
- 3.6.2 Voraussetzungen für A-GPS
- 3.6.2 Funktionsweise von A-GPS
- 3.7 Zusammenfassung
- 3.7.1 Hybridtechniken
- 4 E-911 ein Blick in die USA
- 4.1 Einleitung
- 4.2 E-911 Wireless Phase 1
- 4.3 E-911 Wireless Phase 2
- 4.4 Probleme bei der Umsetzung
- 4.5 Aktueller Stand der Verfügbarkeit von E-911
- 5 Enhanced -112 Europas Antwort auf E-911.
- 5.1 Der Euronotruf 112
- 5.2 Enhanced 112 (E-112)
- 5.3 Erhebung von CGALIES
- 5.4 Kosten der Ortungstechnologien
- 5.5 Redundanz Anrufe
- 5.6 Interoperabilität
- 5.7 Quality of Service (QoS)
- 5.8 Ziele der verbesserten Ortung
- 5.9 Die Genauigkeitsanforderungen an die Netze
- 5.10 Enhanced Emergency Services in Asien
- 6 Ortung am Beispiel der integrierten Landesleitstelle Tirol
- 6.1 Preamble
- 6.2 Aufgaben und Geschichte der Leitstelle
- 6.2.1 Einsatzkoordination
- 6.2.2 Standardisierte Notrufabfrage nach US- Modell
- 6.2.3 Tunnelüberwachung
- 6.2.4 Koordination Krankentransporte
- 6.3 Ortung in der Leitstelle, warum?
- 6.3.1 Gefahr für Leib und Leben
- 6.4 Stammdaten oder Standortdaten
- 6.5 Rufnummernunterdrückung (CLIR)
- 6.6 Abfrageprozesse der Stamm- und Standortdaten
- 6.7 Reaktionszeiten
- 6.8 Genauigkeiten der Standortdaten und deren Interpretation
- 6.9 Einschränkungen
- 6.9.1 Sprechfähigkeit des Notrufabsetztenden
- 6.9.2 Erfahrung des Calltakers
- 6.9.3 Ortung ausländischer Telefone
- 6.9.4 Ortung österreichischer Handys im Ausland
- 6.9.5 Ortung SIM-Kartenloser Mobilfunktelefone
- 6.9.6 Notruf über fremden Provider
- 6.10 Arbeitsgemeinschaft zur Handyortung im Notfall
- 6.10.1 Gemeinsame Schnittstelle gemäß § 98 TKG
- 6.10.2 Phase 1
- 6.10.3 Phase 2
- 6.10.4 Anfrage Maske
- 6.11 Zusammenfassung
- 7 Das deutsche System – in Österreich umzusetzen?
- 7.1 Preamble
- 7.2 Björn Steiger - Stiftung und Life Service 112
- 7.2.1 Geschichte der Björn - Steiger - Stiftung
- 7.2.2 Notrufortung über die Björn - Steiger - Stiftung - Service - GmbH
- 7.2.3 Akzeptanz und Kosten bis 2007
- 7.2.4 Keine Notrufe über SIM-kartenlose Endgeräte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, ob die Handyortung für die Vermisstensuche im alpinen Gelände geeignet ist. Dabei werden die technischen Möglichkeiten, rechtlichen Rahmenbedingungen, sowie die Integration in bestehende Rettungssysteme in Österreich, Deutschland und den USA untersucht.
- Die Analyse der aktuellen Situation in Bezug auf die Handyortung für die Vermisstensuche
- Die Untersuchung der technischen Möglichkeiten und Grenzen der Handyortung
- Die Bewertung des rechtlichen Rahmens und des Datenschutzes
- Die Analyse der Integration der Handyortung in bestehende Rettungssysteme
- Die Suche nach Alternativen zur Handyortung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit einer detaillierten Betrachtung der Mobilfunktechnik und der Sucheinsätze in Österreich. Dabei werden Statistiken über die Verbreitung der Mobilfunktechnik und die Anzahl der Sucheinsätze ausgewertet, sowie die Aufgaben und Strukturen der Alpinpolizei dargestellt.
Im zweiten Kapitel wird der Aufbau eines Mobilfunknetzes erläutert. Es werden die verschiedenen Komponenten des Netzes, wie die Basisstationen, die Funkzellen und die Mobilitätsverwaltung, beschrieben.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Ortungs- und Positionsbestimmungsverfahren, die für die Handyortung verwendet werden. Es werden die Funktionsweise und die Genauigkeit der verschiedenen Verfahren, wie zum Beispiel Zellen-ID, Timing Advance und Assisted GPS, dargestellt.
Kapitel vier beleuchtet das amerikanische E-911-System, das die Ortung von Notrufen ermöglicht. Es werden die einzelnen Phasen der Entwicklung und die aktuellen Herausforderungen bei der Umsetzung dargestellt.
In Kapitel fünf wird das europäische Enhanced-112-System vorgestellt, das ebenfalls die Ortung von Notrufen ermöglicht. Es werden die Ziele, die technischen Anforderungen und die Kosten des Systems erläutert.
Kapitel sechs untersucht die Ortungsmöglichkeiten der integrierten Landesleitstelle Tirol. Es werden die Aufgaben der Leitstelle, die Abfrageprozesse und die Genauigkeit der Standortdaten dargestellt.
Das siebte Kapitel befasst sich mit dem deutschen System der Björn Steiger Stiftung und dem Life Service 112. Es werden die Funktionsweise des Systems und die Akzeptanz in der Bevölkerung beschrieben.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind Handyortung, Vermisstensuche, alpines Gelände, Rettungssysteme, Mobilfunktechnik, Datensicherheit, Datenschutz, E-911, Enhanced 112, Björn Steiger Stiftung, Life Service 112. Diese Begriffe spiegeln die zentralen Themen und Forschungsschwerpunkte der Diplomarbeit wider.
- Quote paper
- Stefan Penz (Author), 2010, Handyortung, geeignet für die Vermisstensuche im alpinen Gelände?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175416