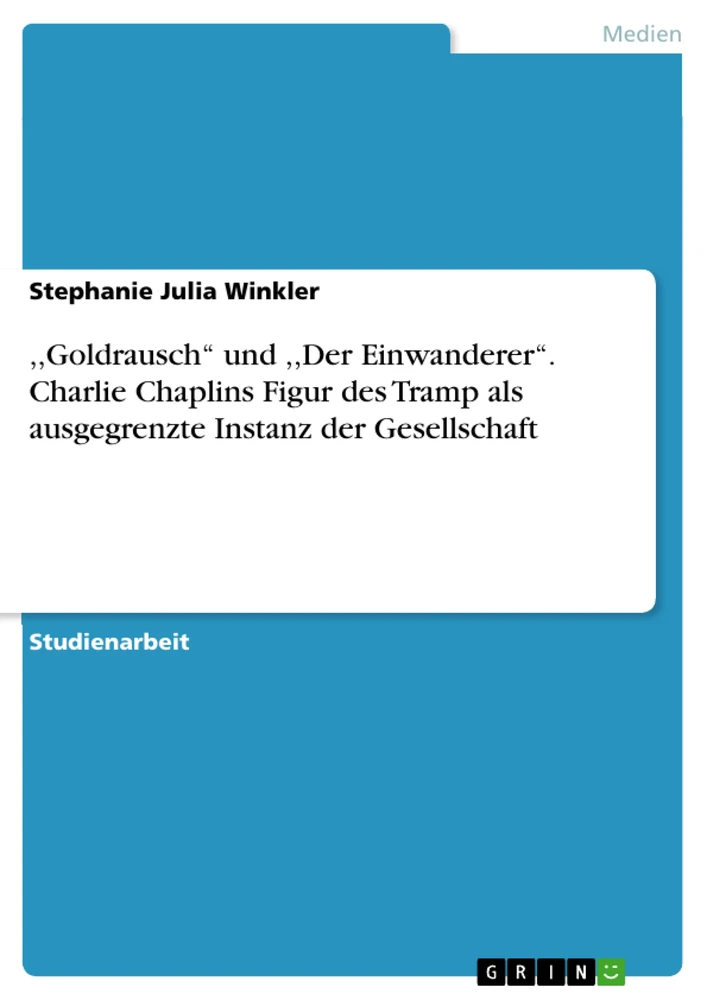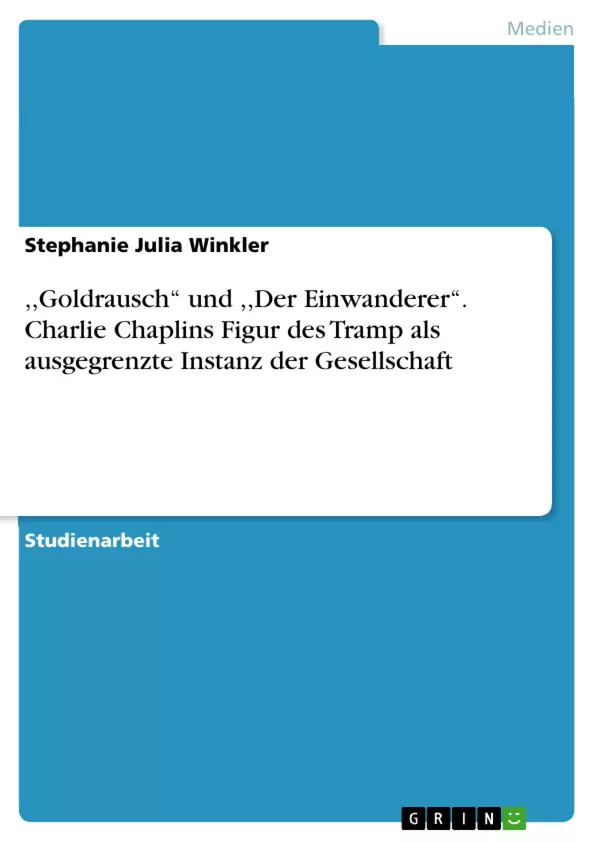1.Einleitung
Von der ersten öffentlichen Filmvorführung der französischen Brüder Lumière am 28. Dezember 1895 im Café de Paris, über die fiktionalen Filme von Georges Méliès bis hin zu den subversiven Stummfilmen Chaplins mit gesellschaftskritischer Thematik machte das neue Medium Kino einen entscheidenden Wandel durch. Mit der Präsentation ihres ,,Cinématographe Lumière‘‘, vor einem sowohl öffentlichen als auch zahlenden Publikum, erfüllten Auguste und Louis Lumière erstmals die Rahmenbedingungen für das, was wir heute Kino nennen. Das Lichtspielhaus als öffentliches Medium, in dem der Zuschauer kollektiv einen Film rezipiert und dafür mit seinem Eintrittsgeld zur Reinvestition beiträgt, trat seinen weltweiten Siegeszug an. Dabei dominierten zunächst einfache, für heutige Verhältnisse banale Alltagsszenen mit dokumentarischem Charakter, aufgenommen auf Zelluloidspulen die ersten Jahre des Stummfilms (vgl. Jost, 2009, S.3). Die Faszination dieser Filme ging mehr von der technischen Reproduzierbarkeit der Wirklichkeit als von ihrem Inhalt aus. Nach der Jahrtausendwende erkannte als erstes Georges Méliès das fiktionale Potential des neuen Mediums, der mit seinem vierzehn Minuten langen Film ,,Le Voyage dans la lune‘‘(1902) als erster die narrativ gestalterische Tätigkeit des Mediums nutzte und so das Filmgenre des Sciencefiction-Filmes erschuf (vgl. Grinsted, 2009, S. 104). Der Wandel des Kinos, von der unseriösen Jahrmarktattraktion hin zum Kino als Kunst mit ästhetischem Bewusstsein, war spätestens mit der französischen Innovation des „Film d'Art“ vollzogen. Kinopaläste sorgten dafür, dass das Kino fortan nicht mehr als Unterschichtsvergnügen mit proletarischen Zügen galt, sondern sich als fester Bestandteil eines künstlerischen Abendprogramms des Bildungsbürgertums etablierte. Auch Charlie Chaplin erkannte die Möglichkeiten des neu entstandenen Kinos: Das Unterhaltungsinstrument ,,Kino‘‘ ermöglichte es, Informationen in kürzester Zeit global zu verbreiten. Anstatt idyllische Scheinwelten zu erschaffen, zog er es vor, die Realität humoristisch zu verzerren und nutzte das neue Medium ,um ein möglichst großes Publikum mit den Themen Arbeit, Klassenunterschied und Unterdrückung zu konfrontieren (vgl. Heyer, 2005, S.3). Auch wenn sich dem Kinobesucher mit den Möglichkeiten des 3D-Kinos längst vollkommen neue Welten der Filmrezeption eröffnet haben, gilt die Stummfilmzeit noch heute als eine der erfolgreichsten Epochen der Filmgeschichte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vom Habenichts und Music-Hall Artisten zum Regisseur und Schauspieler Charles Spencer Chaplin
- Vom Goldsucher zum Millionär: Das amerikanisches Ideal vom sozialen Aufstieg als Pate für den Handlungsverlauf in „Goldrausch“
- Chaplins Figur des Tramp in „Goldrausch“ mit besonderem Fokus auf seiner Funktion als ausgegrenzte Instanz
- Die Entwicklung des Tramp von der eindimensionalen Gegenfigur in den Keystone Filmen zum Clown als existentielle Grundkategorie in „Goldrausch“
- Die „Underdog“ - Charakteristika des Tramp in ihrer Funktion als Entscheidungskriterium zwischen ausgegrenzter und ausgrenzender Instanz
- Kindliche Naivität: Die Kunst des Tramp tragikomische Momente mit einer Agonie des Frohsinns zu relativieren
- Das fehlende Ichbewusstsein als Basis für Chaplins Art der Umsetzung von Bergsons Theorie der „Komik durch Mechanik“
- Das Motiv der Liebe als gesellschaftliches Ideal und szeneübergreifendes Motiv des Tramp
- Der Entzug der Nahrung im Kontext der extremen Umwelterfahrung als zusätzliches Isolationsmoment zur sozialen Ausgrenzung
- „Komik der Ausgrenzung“: Die dialektische Struktur der Komik als metaphorische Aufforderung zur Integration des Tramp
- Der Vagabund als alter ego : Eine vergleichende Analyse des Tramp aus „Goldrausch“ mit Chaplins Vorläuferfigur in „Der Einwanderer“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Figur des Tramp in Charles Chaplins Filmen „Goldrausch“ (1925) und „Der Einwanderer“ (1917) im Kontext einer gesellschaftskritischen Gesamtbetrachtung. Sie untersucht, wie die Figur des Tramp als eine ausgegrenzte Instanz fungiert und welche Rolle soziale Ausgrenzung in Chaplins Werken spielt.
- Die Entwicklung der Figur des Tramp von seinen Anfängen bis hin zu seiner komplexen Darstellung in „Goldrausch“
- Die „Underdog“-Charakteristika des Tramp und deren Bedeutung für seine Rolle als ausgegrenzte und ausgrenzende Instanz
- Die Auswirkungen der extremen Umwelterfahrung auf die psychische Struktur des Tramp
- Die Komik der Ausgrenzung als metaphorische Aufforderung zur Integration des Tramp
- Ein Vergleich des Tramp in „Goldrausch“ mit seiner Vorläuferfigur in „Der Einwanderer“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Entwicklung des Kinos vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zur Blütezeit des Stummfilms und stellt die Bedeutung von Charles Chaplin als Künstler und Gesellschaftskritiker heraus. Kapitel 2 beleuchtet Chaplins Karriere und seine Entwicklung vom Habenichts zum renommierten Künstler. Kapitel 3 beleuchtet das amerikanische Ideal vom sozialen Aufstieg und zeigt auf, wie dieses Ideal im Handlungsverlauf von „Goldrausch“ reflektiert wird. Kapitel 4 untersucht die Figur des Tramp in „Goldrausch“, wobei die Schwerpunkte auf seinen „Underdog“-Charakteristika, der Komik der Ausgrenzung und der dialektischen Struktur der Komik als Aufforderung zur Integration liegen. Kapitel 5 vergleicht den Tramp aus „Goldrausch“ mit seiner Vorläuferfigur in „Der Einwanderer“.
Schlüsselwörter
Charles Chaplin, Stummfilm, Tramp, „Goldrausch“, „Der Einwanderer“, Gesellschaftskritik, Ausgrenzung, Komik, soziale Strukturen, „Underdog“-Charakteristika, Existenzphilosophie.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat die Figur des "Tramp" in Charlie Chaplins Werk?
Der Tramp fungiert als eine ausgegrenzte Instanz der Gesellschaft, die durch Humor und Tragikomik soziale Missstände wie Klassenunterschiede und Unterdrückung beleuchtet.
Wie wird das amerikanische Ideal des sozialen Aufstiegs in "Goldrausch" thematisiert?
Der Film zeigt den Weg vom mittellosen Goldsucher zum Millionär, nutzt dieses Ideal jedoch, um die Härte der Realität und die soziale Isolation humoristisch zu verzerren.
Was versteht man unter der "Komik der Ausgrenzung" bei Chaplin?
Es ist eine dialektische Struktur der Komik, die das Publikum durch Lachen mit dem Leid des Ausgegrenzten konfrontiert und metaphorisch zur Integration auffordert.
Welche Rolle spielt die kindliche Naivität des Tramp?
Die Naivität ermöglicht es der Figur, tragische Momente mit einer Art "Agonie des Frohsinns" zu relativieren und so in extremen Umwelterfahrungen zu überleben.
Inwiefern unterscheidet sich der Tramp in "Der Einwanderer" von dem in "Goldrausch"?
Während "Der Einwanderer" die Vorläuferfigur und die unmittelbare Ankunft thematisiert, zeigt "Goldrausch" die Weiterentwicklung zum existenziellen Clown in einer feindlichen Umgebung.
- Quote paper
- Stephanie Julia Winkler (Author), 2011, ,,Goldrausch‘‘ und ,,Der Einwanderer‘‘. Charlie Chaplins Figur des Tramp als ausgegrenzte Instanz der Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175665