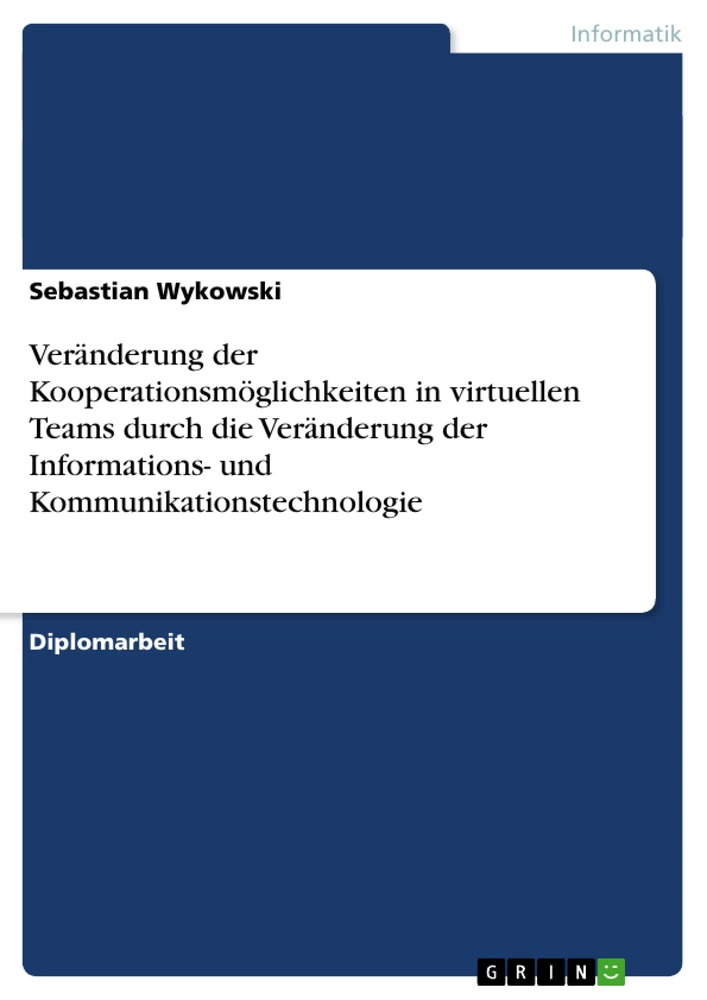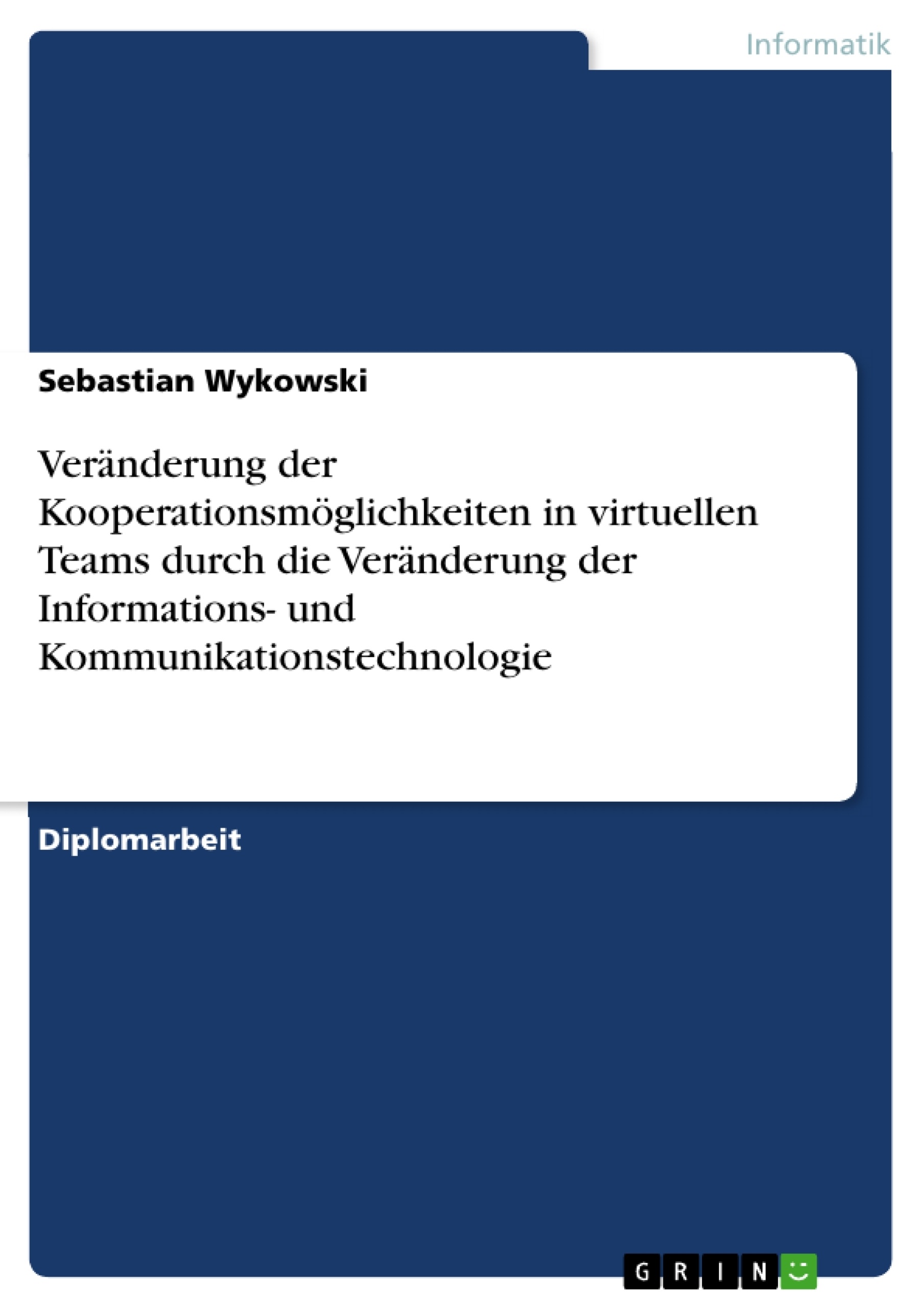Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Kommunikation und Kooperation von virtuellen und global verteilten Teams. Dabei werden Grundlagen und Voraussetzungen der
virtuellen Teamarbeit erläutert und die Entwicklungen der Informations- und Kommunikationstechnologie dargestellt. Zusätzlich soll die Medienwahl anhand der wichtigsten
Theorien veranschaulicht und die differenzierten Blickwinkel beleuchtet werden. Das Ziel
der Arbeit liegt bei der Untersuchung der virtuellen Teams, deren Kommunikation und
deren Beeinflussung durch Kontextvariablen.
„Ein Teamkollege sitzt in Indien, der andere in Deutschland, der dritte in den Vereinigten
Staaten. Ob Softwareunternehmen, Firmen der Elektro- und Elektronikindustrie oder Automobilfirmen - virtuelle Teams sind längst nicht mehr wegzudenken. Die Zusammenarbeit über elektronische Medien fordert vor allem die sozialen Kompetenzen der Teammitglieder. Ohne gegenseitige Motivation funktioniert gar nichts...“.
Hier prallen „Welten“ aufeinander, die virtuelle Teamarbeit ermöglicht eine ortsunabhängige Arbeit, die oft über Kontinente und Zeitzonen hinweg agiert. Dabei kooperieren Teammitglieder untereinander, die sich unter Umständen nicht einmal sehen und sich von Ihrer
Herkunft, Sprache und Kultur stark unterscheiden. Sozialbeziehungen und Vertrauen aufbauen durch virtuelle Kooperation und Kommunikation heißt die Devise. Virtuelle Arbeit
liefert für die Unternehmen Chancen und Risiken zu gleich.
Die Trends reflektieren den Stellenwert der virtuellen Teamarbeit, viele Unternehmen entscheiden sich bei benötigten Komponenten und Dienstleistungen für „Outsourcing“ oder
„Offshoring“.
Einer der Hauptgründe für IT-Offshoring-Projekte sind die niedrigen Kosten
in Ländern wie Indien, Russland, China und Bulgarien.
Die virtuellen Teams spielen dabei für das internationale Geschäft eine immer größere
Rolle, sie ermöglichen dem Unternehmen über traditionelle Grenzen hinweg zu agieren. Der Organisationspsychologe Professor Konradt von der Universität Kiel prognostiziert
aufgrund des ständig wachsenden Zeit- und Kostendrucks, dass bis 2012 ca. 30% der
fest angestellten Mitarbeiter virtuell zusammenarbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Übersicht
- Motivation
- Zielsetzung
- Kapitelübersicht
- Grundlagen und Stand der Technik
- Was ist ein virtuelles Team?
- Wissenstransfer in virtuellen Teams
- Die Entwicklung der IKT
- Reduktion von Informationen durch die Medien
- Unterteilung der Kommunikationsmedien bei der Gruppenarbeit
- Die organisationalen Voraussetzungen
- Die personalen Voraussetzungen
- Voraussetzung virtueller Teamarbeit bei global verteilten Teams
- Mangel an Face-to-Face Treffen und Medienvorschläge
- Kunden- und Lieferantendistanz - Zusammenfassung der grundlegenden Ebenen bei einem Offshoring-Projekt
- virtuelle Teamarbeit – der Nutzen und die Anforderungen
- Nutzen der virtuellen Teamarbeit
- Anforderungen an die virtuelle Teamarbeit
- Medienwahl
- Media-Richness-Theorie
- Media-Synchronicity-Theorie
- Channel-Expansion-Theorie
- Social-Influence-Modell
- Kultur
- Kulturelemente
- Merkmale von Kultur
- Die Rolle der Kulturunterschiede bei einem Software-Offshore-Projekt
- Kulturelle Hindernisse, die den Wissensaustausch beeinflussen
- Untersuchungen
- Die Umfrage
- Auswertung der Teilnehmerumfragen
- Modell und Hypothesen
- Untersuchung der Hypothese 1
- Untersuchung der Hypothese 2
- Untersuchung der Hypothese 3
- Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Kommunikation und Kooperation in virtuellen und global verteilten Teams, wobei ein Schwerpunkt auf der Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie und deren Auswirkungen auf die Zusammenarbeit liegt. Die Arbeit analysiert verschiedene Theorien zur Medienwahl in virtuellen Teams und beleuchtet die Rolle von Kontextvariablen wie Kultur, Distanz und organisatorischen Rahmenbedingungen.
- Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und deren Einfluss auf die virtuelle Teamarbeit
- Theorien zur Medienwahl in virtuellen Teams
- Rolle von Kultur, Distanz und organisatorischen Rahmenbedingungen bei der virtuellen Teamarbeit
- Herausforderungen und Chancen der Zusammenarbeit in global verteilten Teams
- Bewertung von Face-to-Face-Kommunikation und virtuellen Kommunikationsformen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema virtuelle Teams und beleuchtet die Motivation und Zielsetzung der Arbeit. Anschließend werden die Grundlagen und der Stand der Technik im Bereich der virtuellen Teamarbeit erläutert. Hierbei werden die Definition von virtuellen Teams, der Wissenstransfer in virtuellen Teams und die Entwicklung der IKT behandelt. Weitere wichtige Aspekte sind die Reduktion von Informationen durch Medien und die Unterteilung der Kommunikationsmedien in der Gruppenarbeit. Das Kapitel behandelt auch die Voraussetzungen für die virtuelle Teamarbeit im Unternehmen und bei global verteilten Teams, wobei die Herausforderungen und Chancen dieser Arbeitsformen beleuchtet werden.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Medienwahl in virtuellen Teams. Verschiedene Theorien wie die Media-Richness-Theorie, die Media-Synchronicity-Theorie, die Channel-Expansion-Theorie und das Social-Influence-Modell werden vorgestellt und miteinander verglichen. Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Einfluss von Kultur auf die virtuelle Teamarbeit. Hierbei werden kulturelle Elemente, Merkmale von Kultur und die Rolle von Kulturunterschieden bei einem Software-Offshore-Projekt erläutert. Es werden auch kulturelle Hindernisse beim Wissensaustausch in virtuellen Teams analysiert.
Im fünften Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen dargestellt. Die Arbeit befasst sich mit einer Umfrage und deren Auswertung sowie der Modellierung und Überprüfung von Hypothesen. Die Untersuchung der verschiedenen Hypothesen ermöglicht es, Zusammenhänge zwischen der Nutzung von Medien, den Einflüssen von Kultur und der Teamzufriedenheit zu erkennen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselwörtern: Virtuelle Teams, Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), Medienwahl, Kultur, Distanz, Globalisierung, Wissensmanagement, Teamkommunikation, Kooperation, Teamleistung, Offshoring, Medienreichtum, Media-Synchronicity, Social-Influence-Modell, Channel-Expansion-Theorie.
Häufig gestellte Fragen
Was genau ist ein virtuelles Team?
Ein virtuelles Team besteht aus Mitgliedern, die ortsunabhängig, oft über verschiedene Zeitzonen und Kulturen hinweg, primär über elektronische Medien zusammenarbeiten.
Welche Theorien zur Medienwahl werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert die Media-Richness-Theorie, die Media-Synchronicity-Theorie, die Channel-Expansion-Theorie und das Social-Influence-Modell.
Welchen Einfluss hat die Kultur auf die virtuelle Zusammenarbeit?
Kulturunterschiede können Hindernisse beim Wissensaustausch darstellen. Die Arbeit beleuchtet die Rolle kultureller Merkmale besonders bei Software-Offshore-Projekten.
Was sind die Hauptgründe für IT-Offshoring-Projekte?
Niedrige Kosten in Ländern wie Indien, Russland oder China sind ein Haupttreiber, um durch die Nutzung globaler Ressourcen Wettbewerbsvorteile zu erzielen.
Wie wichtig ist Face-to-Face-Kommunikation in virtuellen Teams?
Obwohl die Arbeit über Medien erfolgt, wird der Mangel an persönlichen Treffen als Herausforderung für den Aufbau von Vertrauen und Sozialbeziehungen thematisiert.
Welche Anforderungen stellt virtuelle Teamarbeit an die Mitglieder?
Neben technischem Know-how sind vor allem hohe soziale Kompetenzen und die Fähigkeit zur gegenseitigen Motivation über räumliche Distanzen hinweg erforderlich.
- Citation du texte
- Sebastian Wykowski (Auteur), 2011, Veränderung der Kooperationsmöglichkeiten in virtuellen Teams durch die Veränderung der Informations- und Kommunikationstechnologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175708