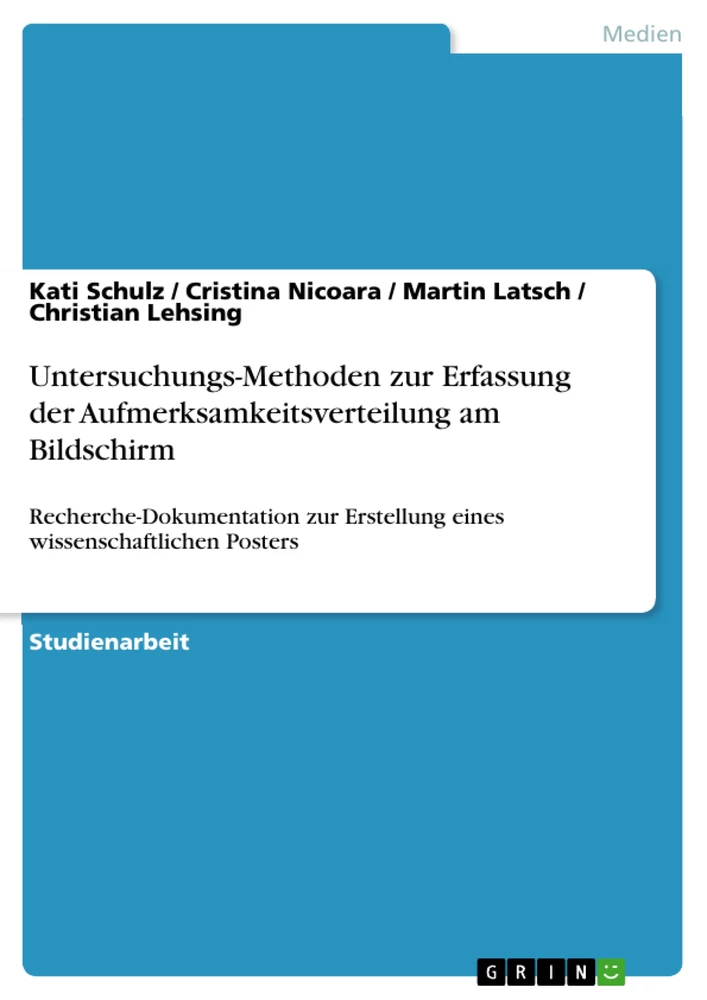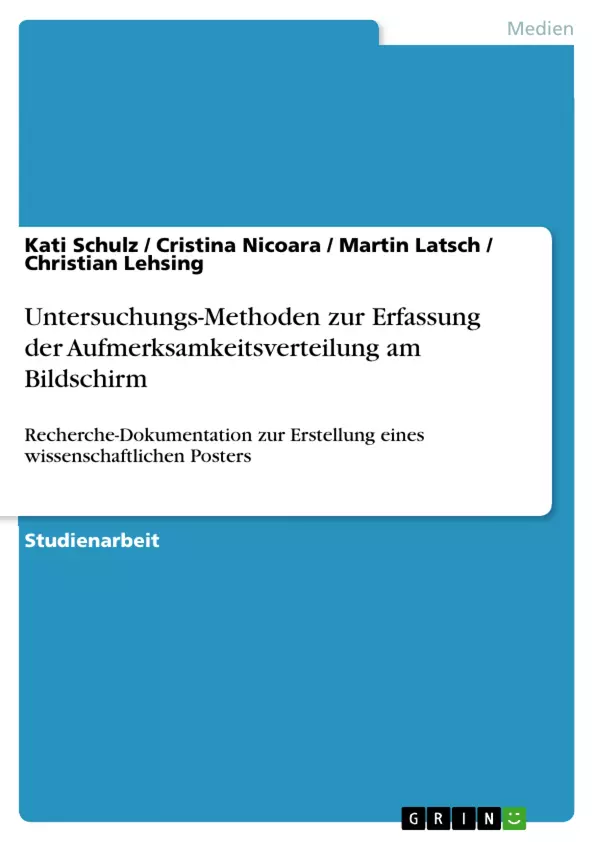Ziel der Postergestaltung war es, der Themenstellung auf adäquater Weise gerecht zu werden. Im Mittelpunkt standen hierbei objektive, wie subjektive Methoden der Aufmerksamkeitserfassung am Bildschirm. Diese Unterteilung geht zurück auf Fleischhauer (2006). Den Gestaltern des Posters war es wichtig, zum einen einschlägige und valide Verfahren der Aufmerksamkeitsmessung darzustellen und andererseits die große Vielfalt der Herangehensweisen an diese Thematik aufzuzeigen. Die Einleitung gibt einen kurzen physiologischen Einstieg mit dem Zitat John Lockes: „Nichts kommt in den Verstand, was nicht vorher in den Sinnen war.“ Über zwei zentralen Hypothesen, der eye-mind-hypothesis und der immediacy hypothesis führt dieser Teil des Überblicks ansatzweise in die Thematik ein. Anschließend gibt die Grafik die Methoden wieder, die sich mit der Aufmerksamkeitserfassung befassen. Eingeteilt sind diese in objektive und subjektive Verfahren. Hierbei erfassen objektive Verfahren Daten wie zum Beispiel die Verweildauer von Blickbewegungen auf einem bestimmten visuellen Objekt (Fixationen) oder auch die Wechsel von einem Objekt auf das nächste (interessante) Objekt können ausgelesen werden (Sakkaden). Im Gegensatz dazu nehmen subjektive Methoden das subjektiv Erlebte auf, was der Nutzer in Interaktion mit dem System erfahren hat. Dies kann zum Beispiel mit einer anschließenden Befragung erfolgen. Im Hauptteil werden 3 Methoden näher erläutert. Das sogenannte Eye Tracking, die Lorem-Ipsum/Site-Covering-Methode und die Verbal-Protocol-Analysis. Die Wahl dieser Methoden erfolgte aufgrund oben genannter Gründe. Sie spiegelt die Heterogenität des Forschungsbereiches wider und legt Möglichkeiten dar, die Aufmerksamkeit von Menschen in Interaktion mit Maschinen auf unterschiedliche Weise zu erfassen. [...] Abschließend ist zu sagen, dass die recherchierten Methoden in hohem Maße wissenschaftlich fundiert und anerkannt sind. Die Verteilung der Aufmerksamkeit lässt sich mit den beschriebenen Methoden, sowie den anschließend folgenden Verfahren gut erfassen. Aus dem generierten Gesamtbild können dann Optimierungsvorschläge erarbeitet werden, die die Benutzung des getesteten Systems in Richtung Nutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Design etc. verbessern können.
Inhaltsverzeichnis
- I. Grundlagen und Einführung
- II. Methoden
- II.1. Eye-Tracking
- II.2. Attention Tracking
- II.3. Remote-Tracking
- II.4. Site-Covering-Methode, Lorem-Ipsum-Covering-Methode
- II.5. Restricted Focus Viewer
- II.6. Subjektive Methoden
- III. Anwendung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel der Forschungsarbeit ist die Untersuchung verschiedener Methoden zur Erfassung der Aufmerksamkeitsverteilung am Bildschirm. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Ansätze zur Messung von Aufmerksamkeit im Kontext von Usability Engineering und Testing, wobei die Untersuchung sich auf objektive und subjektive Verfahren fokussiert.
- Grundlagen der Aufmerksamkeitsmessung
- Objektive Verfahren der Aufmerksamkeitsmessung, wie z.B. Eye-Tracking
- Subjektive Verfahren der Aufmerksamkeitsmessung, wie z.B. Befragungen und Verbal-Protocol-Analysen
- Anwendung der verschiedenen Methoden im Bereich Usability Engineering und Testing
- Bewertung und Vergleich der verschiedenen Methoden
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Grundlagen und Einführung: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in die Thematik der Aufmerksamkeitsmessung und erläutert die grundlegenden Prinzipien der Blickbewegungserfassung. Es wird auf die Relevanz der Augenbewegungen als Indikator für die Aufmerksamkeit sowie auf die Bedeutung von Fixationen und Sakkaden eingegangen.
- II. Methoden: Dieses Kapitel stellt verschiedene Methoden zur Erfassung der Aufmerksamkeitsverteilung am Bildschirm vor. Neben objektiven Verfahren wie Eye-Tracking werden auch subjektive Methoden wie Befragungen und Verbal-Protocol-Analysen behandelt.
- II.1. Eye-Tracking: Das Kapitel beschreibt das Eye-Tracking als eine objektive Methode zur Erfassung von Blickbewegungen. Es werden die Funktionsweise, die Vor- und Nachteile sowie die Anwendungsbereiche des Eye-Trackings erläutert.
- II.2. Attention Tracking: Dieses Kapitel behandelt das Attention Tracking als eine weitere objektive Methode zur Aufmerksamkeitsmessung. Es werden die Funktionsweise, die Vor- und Nachteile sowie die Anwendungsbereiche des Attention Tracking erläutert.
- II.3. Remote-Tracking: Das Kapitel beschreibt das Remote-Tracking als eine Methode zur Erfassung von Blickbewegungen aus der Ferne. Es werden die Funktionsweise, die Vor- und Nachteile sowie die Anwendungsbereiche des Remote-Trackings erläutert.
- II.4. Site-Covering-Methode, Lorem-Ipsum-Covering-Methode: In diesem Kapitel werden die Site-Covering-Methode und die Lorem-Ipsum-Covering-Methode als subjektive Verfahren zur Aufmerksamkeitsmessung vorgestellt. Die Funktionsweise, die Vor- und Nachteile sowie die Anwendungsbereiche der beiden Methoden werden erläutert.
- II.5. Restricted Focus Viewer: Dieses Kapitel behandelt den Restricted Focus Viewer als eine weitere subjektive Methode zur Erfassung der Aufmerksamkeit. Es werden die Funktionsweise, die Vor- und Nachteile sowie die Anwendungsbereiche des Restricted Focus Viewers erläutert.
- II.6. Subjektive Methoden: Das Kapitel fasst die verschiedenen subjektiven Methoden zur Aufmerksamkeitsmessung zusammen. Es werden die Vor- und Nachteile der subjektiven Verfahren im Vergleich zu objektiven Methoden diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema der Aufmerksamkeitsverteilung am Bildschirm, wobei die Erfassung der Aufmerksamkeit mittels objektiver und subjektiver Methoden im Vordergrund steht. Hierzu werden Methoden wie Eye-Tracking, Attention Tracking, Remote-Tracking, Site-Covering-Methode, Lorem-Ipsum-Covering-Methode und Restricted Focus Viewer sowie Befragungen und Verbal-Protocol-Analysen untersucht. Die Arbeit konzentriert sich auf die Anwendung dieser Methoden im Bereich Usability Engineering und Testing.
Häufig gestellte Fragen
Welche Methoden gibt es zur Erfassung der Aufmerksamkeit am Bildschirm?
Unterschieden werden objektive Verfahren (z.B. Eye-Tracking, Attention Tracking) und subjektive Verfahren (z.B. Befragung, Verbal-Protocol-Analysis).
Was ist der Unterschied zwischen objektiven und subjektiven Messverfahren?
Objektive Verfahren messen physische Daten wie Blickbewegungen; subjektive Verfahren erfassen das bewusste Erleben des Nutzers während der Interaktion.
Wie funktioniert Eye-Tracking im Bereich Usability-Testing?
Spezielle Kameras erfassen die Blickpunkte des Nutzers, um festzustellen, welche Elemente einer Webseite gesehen werden und welche nicht.
Was versteht man unter Fixationen und Sakkaden?
Fixationen sind die Phasen, in denen das Auge auf einem Punkt verweilt; Sakkaden sind die schnellen Sprünge zwischen diesen Fixationspunkten.
Was ist die Site-Covering-Methode?
Es ist eine Methode, bei der Teile des Bildschirms abgedeckt werden, um zu prüfen, welche Informationen der Nutzer zur Orientierung zwingend benötigt.
Wie hilft die Verbal-Protocol-Analysis bei der Untersuchung der Nutzererfahrung?
Nutzer werden gebeten, ihre Gedanken während der Bedienung laut auszusprechen, was Einblicke in Verständnisprobleme und Aufmerksamkeitsfokus gibt.
- Citation du texte
- Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH), M.Sc. Kati Schulz (Auteur), Dipl.-Ing. Cristina Nicoara (Auteur), M.Sc. Martin Latsch (Auteur), Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Lehsing (Auteur), 2010, Untersuchungs-Methoden zur Erfassung der Aufmerksamkeitsverteilung am Bildschirm, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175792