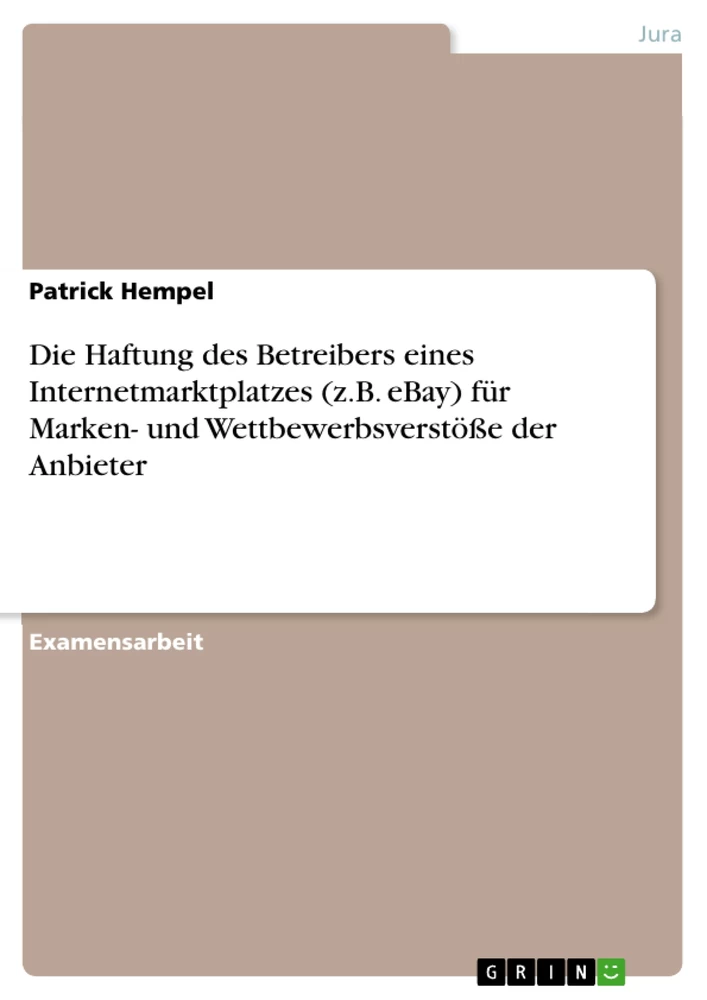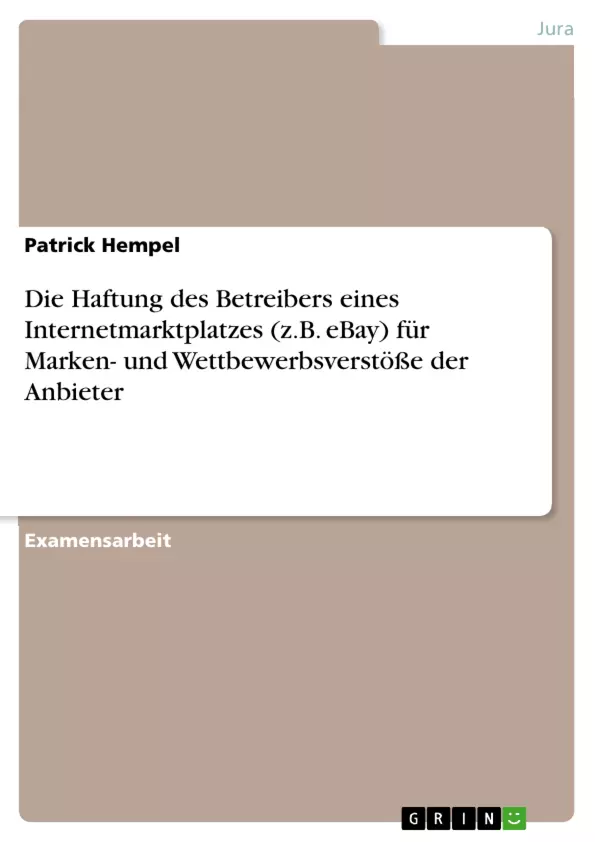A. Einleitung
Das Internet ist aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Nachdem es 1991 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde , besitzen mittlerweile knapp 80% aller deutschen Haushalte einen Internetanschluss . Es existiert eine Vielzahl von Möglichkeiten, das Internet zu verwenden. So können Nutzer auf der ganzen Welt Informationen abrufen, sich verabreden, in sozialen Netzwerken zueinander finden und miteinander in mannigfaltiger Weise Handel betreiben.
Nahezu jedes Unternehmen, welches in irgendeiner Form Produkte anbietet, leitet mittlerweile auch einen „Internetshop“, in welchem die Nutzer zu jeder Zeit ihre Einkäufe tätigen können. Doch es existieren auch Internetseiten, auf denen der Betreiber selbst keine Waren anbietet, sondern seinen Besuchern eine Plattform für deren Handel bietet. Das wohl berühmteste Beispiel hierfür ist eBay.de. Auf dieser Seite werden die Angebote der Nutzer üblicherweise als „Auktion“ durchgeführt, bei welcher nur der Höchstbietende mit dem Anbieter einen Kaufvertrag abschließt. Außerdem kann man seine Produkte auch in Form eines „Sofortkaufs“ oder - seit Mitte 2009 - im Rahmen eines Kleinanzeigenmarktes verkaufen.
Wenn man sich vorstellt, dass allein bei eBay.de täglich ca. 24.000 Bücher und 13.000 Paar Damenschuhe verkauft werden , ist naheliegend, dass bei diesen enormen Mengen an Produkten rechtliche Probleme vorprogrammiert sind. Im Falle von rechtlichen Verstößen kann es sich für den betroffenen Rechteinhaber äußerst schwierig gestalten, die Anbieter der Produkte ausfindig zu machen. Die Anbieter wählen bei der Anmeldung auf solchen Plattformen üblicherweise sog. „Benutzernamen“, die frei erfunden sein können. Erst nach dem Erwerb eines Artikels erfährt der Käufer die „wahre Identität“, wobei diese unter Umständen nur unzureichend oder unregelmäßig vom Betreiber der Plattform überprüft wird (bei eBay.de wird bspw. nach der Anmeldung einmalig ein Brief mit einer Nummer zum Freischalten an die angegebene Adresse verschickt). Aus diesem Grund widmet sich die vorliegende Arbeit der Frage, ob der Betreiber eines Internetmarktplatzes für eventuelle Marken- oder Wettbewerbsverstöße seiner Anbieter haftbar gemacht werden kann. Als Anwendungsbeispiel soll hierbei eBay.de dienen, da diese Plattform – wie oben bereits angedeutet – zu den weltweit führenden zählt und die rechtliche Würdigung ebenso auf Betreiber von anderen Internetmarktplätzen anwendbar ist.
Inhaltsverzeichnis
- A. EINLEITUNG
- B. ALLGEMEINE HAFTUNGSFRAGEN
- 1. ABLAUF EINES ANGEBOTES
- 2. ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
- 3. HAFTUNGSPRIVILEG DES TMG
- A) ANWENDBARKEIT DES TMG, § 11 TMG
- B) ZWISCHENERGEBNIS
- C) GRUNDSATZ DER VERANTWORTLICHKEIT, § 7 1 TMG
- aa) Eigene oder fremde Informationen?
- bb) Zwischenergebnis
- D) HAFTUNG NACH § 10 TMG
- E) ZWISCHENERGEBNIS
- F) UMFANG DES HAFTUNGSAUSSCHLUSSES
- G) ERGEBNIS
- C. HAFTUNG FÜR MARKENVERLETZUNGEN
- 1. ANSPRÜCHE DES INHABERS EINER NATIONALEN MARKE
- A) ANSPRUCH AUF UNTERLASSUNG, § 14 II NR. 1, V MARKENG
- B) ZWISCHENERGEBNIS
- C) HAFTUNG NACH DEN GRUNDSÄTZEN VON TÄTERSCHAFT UND TEILNAHME
- aa) Voraussetzungen der Haftung
- bb) Stellungnahme
- D) HAFTUNG NACH DEN GRUNDSÄTZEN DER „STÖRERHAFTUNG“
- aa) Wesen der Störerhaftung
- bb) Begriff des Störers
- cc) Der Internetmarktplatz als Störer
- dd) Abwendungsmöglichkeit
- ee) Verletzung zumutbarer Prüf- und Überwachungspflichten
- E) ZWISCHENERGEBNIS
- F) ANSPRUCH AUF SCHADENSERSATZ, § 14 VI MARKENG
- G) AUSKUNFTSANSPRUCH, § 19 I MARKENG
- 2. ANSPRÜCHE DES INHABERS EINER GESCHÄFTLICHEN BEZEICHNUNG
- 3. ANSPRÜCHE DES INHABERS EINER GEMEINSCHAFTSMARKE
- 4. ERGEBNIS
- D. HAFTUNG FÜR WETTBEWERBSVERSTÖßE
- 1. ANSPRUCHSGRUNDLAGEN
- A) ANSPRUCH AUF BESEITIGUNG UND UNTERLASSUNG, § 81 UWG
- B) HAFTUNG NACH DEN GRUNDSÄTZEN VON TÄTERSCHAFT UND TEILNAHME
- aa) Entwicklung der Haftung für Dritte im Wettbewerbsrecht
- bb) „Wettbewerbsrechtliche Verkehrspflicht“
- cc) Ergebnis
- 2. VERHÄLTNIS ZUM MARKENRECHT
- E. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage der Haftung des Betreibers eines Internetmarktplatzes (z.B. eBay) für Marken- und Wettbewerbsverstöße seiner Anbieter. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen und die verschiedenen Haftungsansätze, die im Kontext von Online-Marktplätzen relevant sind.
- Die Anwendbarkeit des Telemediengesetzes (TMG) auf Internetmarktplätze und die damit verbundenen Haftungsfragen
- Die Haftung des Plattformbetreibers für Markenverletzungen, insbesondere für Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche
- Die Haftung des Plattformbetreibers für Wettbewerbsverstöße, einschließlich der Anwendung der Prinzipien von Täterschaft und Teilnahme sowie der „wettbewerbsrechtlichen Verkehrspflicht“
- Die Besonderheiten der Haftung des Plattformbetreibers im Verhältnis zum Markenrecht
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten im Hinblick auf die rechtliche Regulierung von Online-Marktplätzen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik und beleuchtet die allgemeinen Haftungsfragen im Zusammenhang mit Online-Marktplätzen. Anschließend werden die spezifischen Haftungsfragen im Hinblick auf Marken- und Wettbewerbsverstöße der Anbieter untersucht. Dabei wird insbesondere die Anwendbarkeit des TMG auf Internetmarktplätze sowie die verschiedenen Haftungsansätze im Detail analysiert. Die Arbeit beleuchtet die Haftung des Plattformbetreibers für Unterlassungs-, Schadensersatz- und Auskunftsansprüche des Markeninhabers sowie die Haftung für Wettbewerbsverstöße der Anbieter. Abschließend werden die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst und die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit herausgestellt.
Schlüsselwörter
Internetmarktplatz, Haftung, Markenverletzung, Wettbewerbsverstoß, Telemediengesetz (TMG), Täterschaft, Teilnahme, Störerhaftung, Verkehrspflicht, Markenrecht, Wettbewerbsrecht
Häufig gestellte Fragen
Haftet eBay für Markenverletzungen seiner Verkäufer?
Nach den Grundsätzen der Störerhaftung kann ein Betreiber zur Unterlassung verpflichtet sein, wenn er zumutbare Prüf- und Überwachungspflichten verletzt hat.
Welche Rolle spielt das Telemediengesetz (TMG)?
Das TMG (insb. § 10) gewährt Plattformbetreibern Haftungsprivilegien für fremde Informationen, sofern sie keine Kenntnis von der rechtswidrigen Handlung haben.
Was versteht man unter „Störerhaftung“?
Störer ist, wer ohne Täter oder Teilnehmer zu sein, willentlich und adäquat-kausal zur Verletzung eines geschützten Gutes beiträgt.
Wann hat ein Markeninhaber Anspruch auf Schadensersatz gegen eBay?
Schadensersatzansprüche gegen den Betreiber sind schwieriger durchzusetzen als Unterlassungsansprüche und setzen meist eine vorsätzliche oder fahrlässige Pflichtverletzung voraus.
Welche Prüfpflichten haben Online-Marktplätze?
Nach einem Hinweis auf eine Rechtsverletzung muss der Betreiber das konkrete Angebot sperren und Vorsorge treffen, dass es nicht zu weiteren gleichartigen Verstößen kommt.
- Quote paper
- Patrick Hempel (Author), 2011, Die Haftung des Betreibers eines Internetmarktplatzes (z.B. eBay) für Marken- und Wettbewerbsverstöße der Anbieter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175836