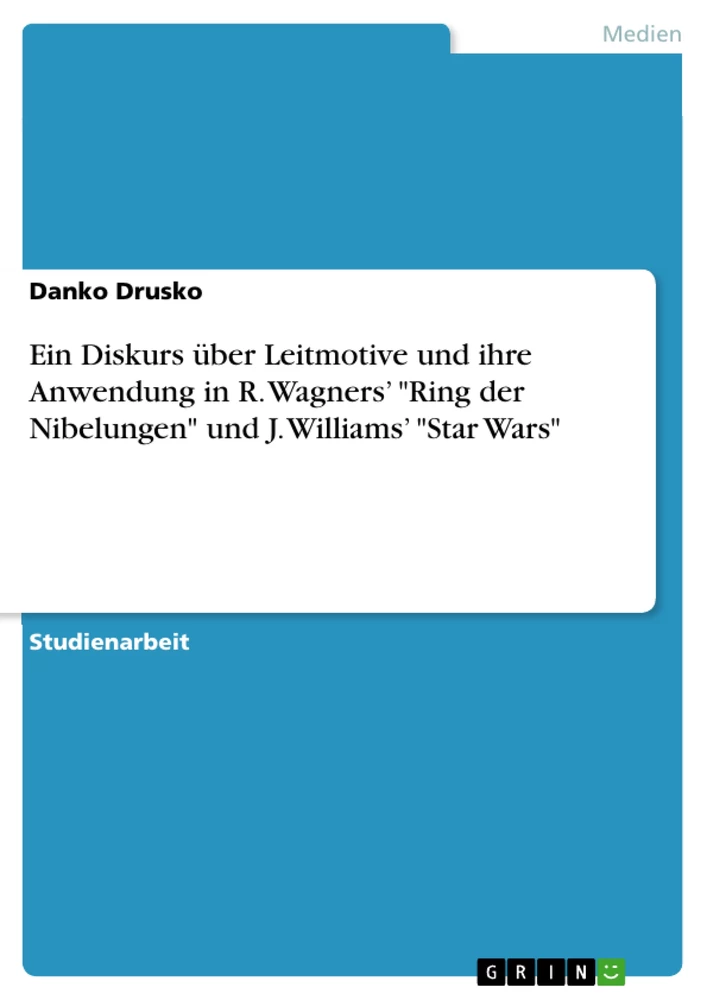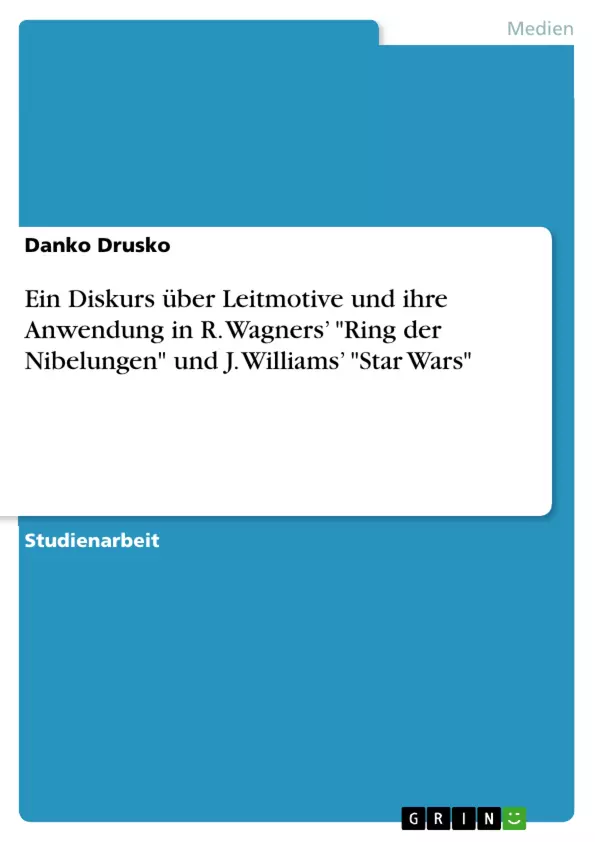Wenn man den Begriff „Leitmotiv“ in Google eingibt, erhält man auf Anhieb circa 912 000
Treffer. Neben zahlreichen Links zu Wagners Leitmotivtechnik sind mindestens genauso
viele darunter, die auf Leitmotive in der Filmmusik führen. Mein Interesse für das Thema
„Ein Diskurs über Leitmotive und ihre Anwendung in R. Wagners’ Ring der Nibelungen und
J. Williams’ Star Wars“ hat sich im Laufe der Zeit einerseits aus Neugier und andererseits aus
einem Unwissen heraus in diese Richtung entwickelt. Die Stadien dieser Arbeit beinhalten
auch die systematische Herangehensweise meinerseits. Zunächst soll von einem allgemeinen
Leitmotivverständnis ausgegangen werden, auf das, im weiteren Verlauf der Arbeit, innerhalb
der Themen eingegangen wird. Zum einen wird die Leitmotivtechnik in Wagners’ Ring der
Nibelungen betrachtet, zum anderen die in der klassischen Filmmusik bzw. die in Williams’
Weltraumoper Star Wars. Abschließend sollen allgemeine Affinitäten vom Musikdrama in
Richtung Filmmusik beobachtet und mögliche Ursachen erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Leitmotiv
- Leitmotivverständnis nach Wagner
- Überleitung zur Filmmusik
- Wagners Leitmotive im Hinblick auf die Filmmusik
- Entspricht die Funktion der Leitmotive im Ring der Nibelungen denen in John Williams' Star Wars?
- Affinitäten vom Musikdrama in Richtung Filmmusik
- Schlussbemerkung
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, die Verwendung von Leitmotiven in Richard Wagners' Ring des Nibelungen und John Williams' Star Wars zu untersuchen und die Parallelen zwischen Musikdrama und Filmmusik aufzuzeigen. Die Arbeit untersucht zunächst das allgemeine Leitmotivverständnis und analysiert anschließend die Anwendung der Leitmotivtechnik in beiden Werken.
- Leitmotivverständnis in der Musikgeschichte
- Die Rolle des Leitmotivs in Wagners' Ring des Nibelungen
- Anwendung von Leitmotiven in Filmmusik, insbesondere in Star Wars
- Vergleich der Leitmotivtechniken in beiden Werken
- Beziehung zwischen Musikdrama und Filmmusik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema „Leitmotive in Musik und Film“ ein und erläutert den Ursprung des Interesses des Autors an dieser Thematik. Sie stellt das allgemeine Leitmotivverständnis vor und skizziert den Aufbau der Arbeit, die sich mit der Leitmotivtechnik in Richard Wagners' Ring des Nibelungen und John Williams' Star Wars auseinandersetzt. Darüber hinaus werden die Hauptfragen und Zielsetzungen der Arbeit dargestellt.
Das Leitmotiv
Dieser Abschnitt definiert den Begriff des Leitmotivs und beleuchtet seine Entwicklung in der Musikgeschichte. Er bezieht sich dabei auf die Definition des Leitmotivs im Riemann-Lexikon und verfolgt die Verwendung von musikalischen Motiven in der Oper des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts.
Leitmotivverständnis nach Wagner
Dieser Abschnitt analysiert die Leitmotivtechnik Richard Wagners und zeigt auf, wie sie sich von der Verwendung von Motiven in früheren Opern unterscheidet. Er beschreibt Wagners Ziel, die Möglichkeiten der Musik in Verbindung mit szenischer Handlung weiter auszuschöpfen, und erklärt die Bedeutung des Orchesters als Erzähler in Wagners Musikdramen.
Schlüsselwörter
Leitmotiv, Richard Wagner, Ring des Nibelungen, John Williams, Star Wars, Musikdrama, Filmmusik, Orchestermelodie, Erinnerungsmotive, Motivverarbeitung, Dramaturgie, musikalische Gestalt, programmatische Musik
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Leitmotiv in der Musik?
Ein Leitmotiv ist ein kurzes musikalisches Thema, das einer bestimmten Person, einem Ort, einem Gegenstand oder einer Idee zugeordnet ist und im Verlauf des Werkes wiederkehrt, um dramaturgische Zusammenhänge zu verdeutlichen.
Wie setzte Richard Wagner Leitmotive ein?
Wagner nutzte Leitmotive im „Ring des Nibelungen“, um das Orchester als Erzähler fungieren zu lassen. Motive verändern sich psychologisch mit der Handlung und verknüpfen Szenen auf einer tieferen Bedeutungsebene.
Welche Parallelen gibt es zwischen Wagner und Star Wars?
John Williams verwendet in „Star Wars“ eine sehr ähnliche Technik wie Wagner. Er ordnet Charakteren wie Luke Skywalker oder Darth Vader feste Themen zu, die sich je nach deren Entwicklung musikalisch verändern.
Was unterscheidet die Leitmotivtechnik in der Filmmusik von der Oper?
Während Wagners Motive oft hochkomplex verwoben sind, dienen Filmmusik-Motive häufig der schnelleren Wiedererkennung und emotionalen Steuerung des Zuschauers, folgen aber demselben dramaturgischen Grundprinzip.
Warum wird Star Wars oft als „Weltraumoper“ bezeichnet?
Dies liegt an der epischen Erzählweise und der orchestralen Untermalung, die stark an das Musikdrama des 19. Jahrhunderts erinnert, insbesondere durch die konsequente Nutzung der Leitmotivtechnik.
- Quote paper
- Danko Drusko (Author), 2007, Ein Diskurs über Leitmotive und ihre Anwendung in R. Wagners’ "Ring der Nibelungen" und J. Williams’ "Star Wars", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176108