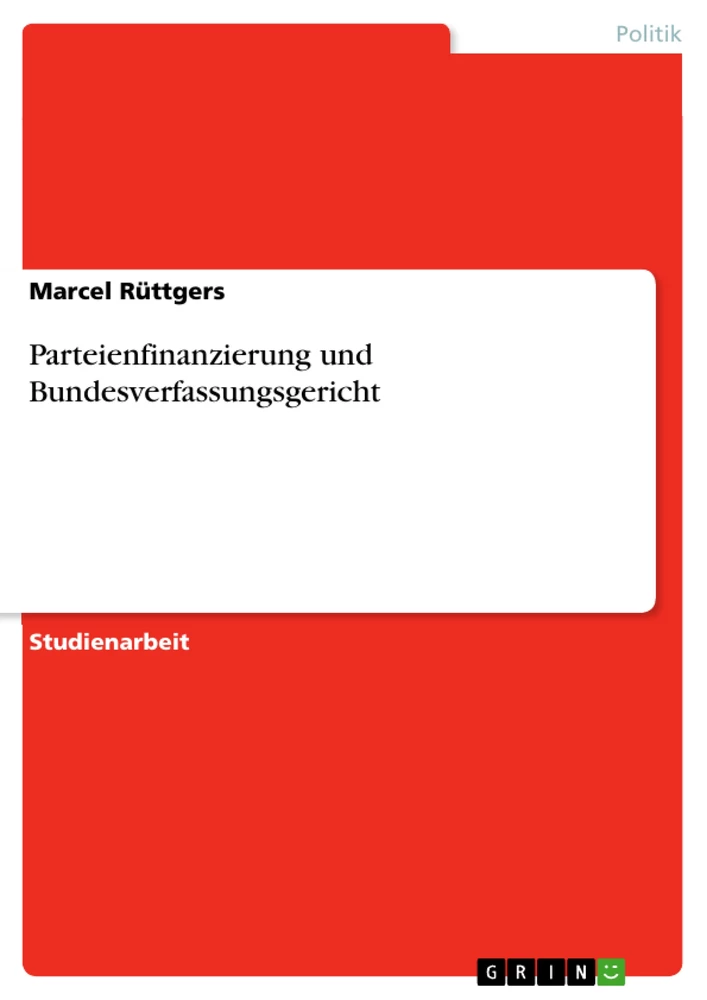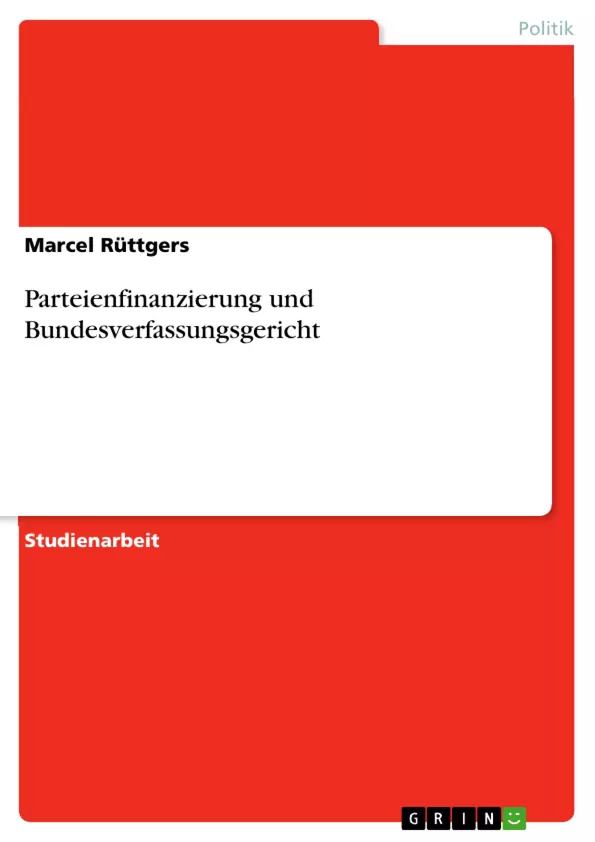Die Geschichte der Parteienfinanzierung in Deutschland ist ein heikles Thema und wird nicht selten mit plakativen und polemischen Formulierungen versehen: der Staat als Beute der Parteien, eine Selbstbedienungsmentalität der Parteien, Parteienfinanzierung als Anzeichen der Problemlösungsschwäche der Politik, übermäßige Selbstversorgung, die Staatsfinanzierung als Krebskrankheit etc. Die Liste an Vergleichen und Beschuldigungen ließe sich sicherlich noch länger ausführen. Die Geschichte der Parteienfinanzierung muss dabei in einer ständigen Wechselwirkung mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gesehen werden. Kaum ein anderes Thema hat die Karlsruher Richter öfter beschäftigt. Auch hinsichtlich der Urteile des Bundesverfassungsgerichts zur Parteienfinanzierungsthematik lassen sich eine Reihe von Phrasen anführen: Urteile als „wiederholte Brems-, Kontroll- und Steuerungsversuche“ , das Gericht als Ersatzgesetzgeber, das Ziehen der Notbremse etc.
Die Bedeutung der Karlsruher Rechtsprechung für die Parteienfinanzierungsgesetzgebung darf dessen ungeachtet aber auch nicht unterschätzt werden, zumal „die Judikate des Bundesverfassungsgerichts […] auf die Parteienfinanzierung und insbesondere auf deren gesetzliche Regelung derart entscheidenen Einfluß gehabt haben, dass Gesetzesnovellen überwiegend der Umsetzung bundesverfassungsgerichtlicher Urteile dienten“ . Die Ursachen und die Berechtigung dieses judicial activism, der durchaus eine Art Kontroll- oder Korrekturfunktion einnimmt, wird in dieser Arbeit noch veranschaulicht werden.
Die vorliegende Arbeit beabsichtigt dabei allerdings weniger einen kompletten Überblick über die Entwicklung der Parteienfinanzierung in Deutschland zu geben. Vielmehr ist es das Ziel das Wechselspiel zwischen der Gesetzgebung und den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts aufzuzeigen. Parteienfinanzierung wird dabei in einem sehr engen Rahmen verstanden, der nur die direkte Finanzierung der Parteien an sich berücksichtigen kann. Anderweitige Aspekte der Parteienfinanzierung (Parteistiftungen, Jugendorganisationen, ‚Parallelkampagnen’, Fraktions- und Abgeordnetenfinanzierung, Finanzierung von unabhängigen Wahlkreisbewerbern und kommunalen Wählergruppen etc.) werden ausgelassen. Ebenfalls unberücksichtigt bleiben diejenigen Einnahmearten, die nicht durch das Verfassungsgericht thematisiert wurden (Kredite, Vermögen, wirtschaftliche Aktivitäten etc.). Aufgrund des beschränkten Umfangs der Arbeit muss deswegen auch......
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Parteienfinanzierung in der Bundesrepublik Deutschland
- Staatliche Parteienfinanzierung am Anfang der Republik
- Steuerliche Abzugsfähigkeit von Parteispenden
- Bundesverfassungsgericht und steuerliche Abzugsfähigkeit
- Direkte Staatsfinanzierung bis 1966
- Das ,,Hessen-Urteil“
- Das Parteiengesetz von 1967
- Die Entwicklung bis zur Novellierung 1983
- Die Novellierung des Parteiengesetzes von 1983
- Das Urteil von 1986
- Das Sondervotum des Richters Böckenförde
- Das Parteiengesetz von 1989
- Das Urteil von 1992
- Die Novelle des Parteiengesetzes von 1994
- Die Parteienfinanzierung ab 1994
- Faktoren einer Parteienfinanzierung
- Finanzbedarf der Parteien
- Entscheidungen in eigener Sache
- Verfassungsrechtliche Prinzipien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, das Wechselspiel zwischen der Gesetzgebung und den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts im Bereich der Parteienfinanzierung in der Bundesrepublik Deutschland aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf der direkten Finanzierung der Parteien, wobei andere Aspekte der Parteienfinanzierung (Parteistiftungen, Jugendorganisationen etc.) ausgelassen werden.
- Entwicklung der staatlichen Parteienfinanzierung in der Bundesrepublik
- Einfluss des Bundesverfassungsgerichts auf die Parteienfinanzierungsgesetzgebung
- Verfassungsrechtliche Prinzipien der Parteienfinanzierung
- Analyse maßgeblicher Urteile des Bundesverfassungsgerichts
- Faktoren, die die Entwicklung der Parteienfinanzierung beeinflussen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit beleuchtet die Geschichte der Parteienfinanzierung in Deutschland und die besondere Rolle des Bundesverfassungsgerichts. Sie beschränkt sich auf die direkte Finanzierung der Parteien und betrachtet verschiedene Aspekte der Debatte um die Finanzierung von Parteien.
- Die Parteienfinanzierung in der Bundesrepublik Deutschland: Dieses Kapitel stellt die historische Entwicklung der staatlichen Parteienfinanzierung dar, beginnend mit der Gründung der Bundesrepublik. Die Entwicklung wird anhand wichtiger Gesetzesänderungen und Urteile des Bundesverfassungsgerichts dargestellt.
- Faktoren einer Parteienfinanzierung: Dieser Abschnitt befasst sich mit den verschiedenen Faktoren, die die Parteienfinanzierung beeinflussen, wie den finanziellen Bedürfnissen der Parteien, den Entscheidungen der Parteien selbst und den verfassungsrechtlichen Prinzipien.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der Parteienfinanzierung in der Bundesrepublik Deutschland, dem Einfluss des Bundesverfassungsgerichts auf die Gesetzgebung, verfassungsrechtlichen Prinzipien der Parteienfinanzierung und relevanten Urteilen des Bundesverfassungsgerichts. Sie konzentriert sich auf die direkte Finanzierung von Parteien und betrachtet die Faktoren, die die Parteienfinanzierung beeinflussen.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hat das Bundesverfassungsgericht auf die Parteienfinanzierung?
Das Gericht fungiert oft als "Ersatzgesetzgeber", da viele Gesetzesnovellen lediglich dazu dienten, die strikten Vorgaben und Urteile aus Karlsruhe umzusetzen.
Was ist das "Hessen-Urteil"?
Ein wegweisendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Grenzen der staatlichen Parteienfinanzierung und der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Spenden definierte.
Dürfen Parteien sich unbegrenzt aus Staatsmitteln finanzieren?
Nein, das Verfassungsgericht hat klare Obergrenzen und das Prinzip der "Staatsfreiheit" festgelegt, um eine zu starke Abhängigkeit der Parteien vom Staat zu verhindern.
Welche Kritik wird an der Parteienfinanzierung oft geäußert?
Kritiker sprechen oft polemisch von einer "Selbstbedienungsmentalität" der Parteien oder dem Staat als "Beute" der politischen Akteure.
Was bedeutet "Judicial Activism" in diesem Kontext?
Es bezeichnet die aktive Rolle der Richter, die durch ihre Rechtsprechung die politische Gestaltung der Parteienfinanzierung maßgeblich korrigieren und steuern.
- Citar trabajo
- Marcel Rüttgers (Autor), 2007, Parteienfinanzierung und Bundesverfassungsgericht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176288