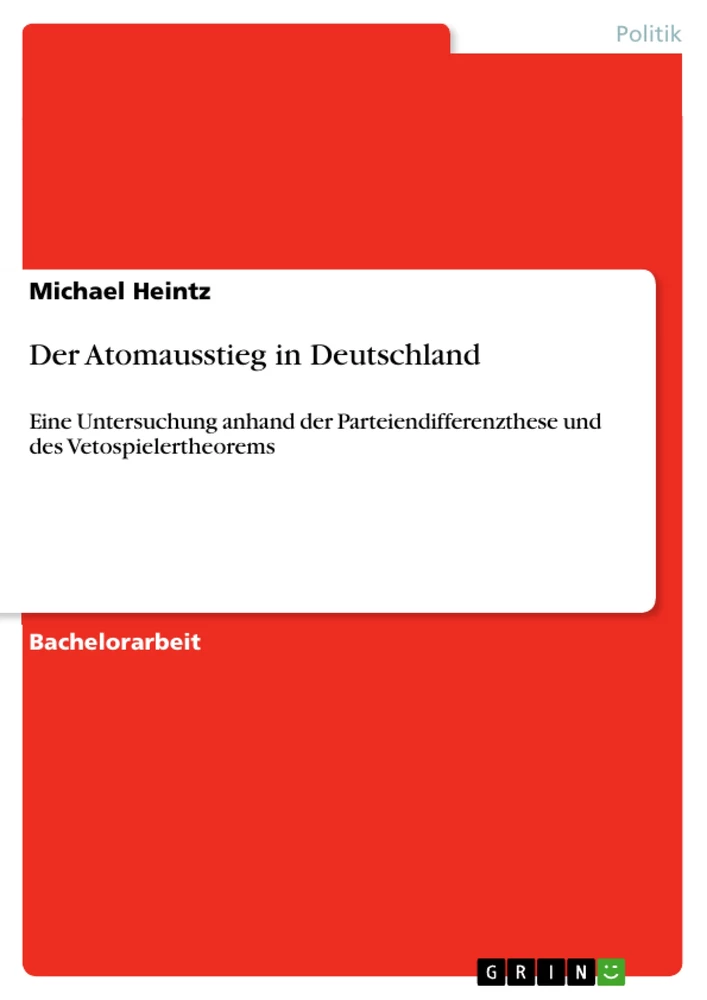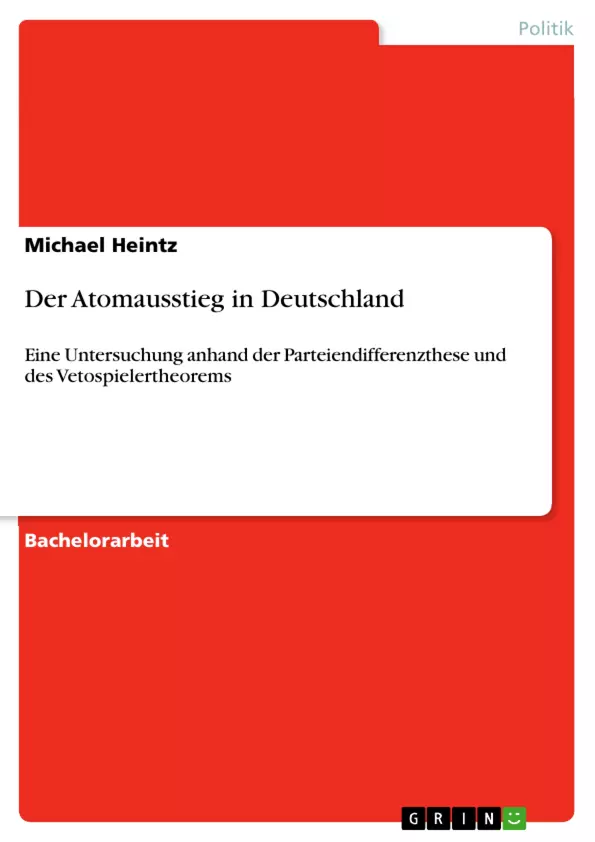Nach der Bundestagswahl 1998 kam es in der Bundesrepublik Deutschland zu einem historischen Regierungswechsel. Erstmals wurde eine amtierende Bundesregierung (CDU /FDP) komplett abgewählt und durch eine völlig neue Regierungskoalition (SPD/Grüne ) ersetzt. Somit wurde erstmals die Bundesregierung aus Parteien gebildet, die beide den Ausstieg aus der Atomenergie forderten. Folglich hatte diese neue Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass der Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie innerhalb der Legislaturperiode umfassend und unumkehrbar gesetzlich geregelt wird. Im Juni 2000 wurde durch den Atomkonsens, einer Vereinbarung zwischen der rot-grünen Bundesregierung und den Energieversorgungsunternehmen, der Atomausstieg in der Bundesrepublik besiegelt.
Die Arbeit untersucht ob ein Zusammenhang zwischen der Parteizusammensetzung der Bundesregierung und dem Atomausstieg belegt werden kann. Hierzu werden Bundestagswahlprogramme und Koalitionsverträge analysiert.
In einem zweiten Schritt werden die entscheidenden Akteure des Atomausstiegs im Bezug auf ihr Vetopotential untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Rahmen
- Parteiendifferenzthese
- Das Vetospielertheorem
- Beschreibung des Atomausstiegs über Konsensverhandlungen
- Analyse anhand der Parteiendifferenzthese und des Vetospielertheorems
- Anwendung der Parteiendifferenzthese
- Quantitative Analyse der Bundestagswahlprogramme 1980 - 2009
- Qualitative Analyse der Bundestagswahlprogramme 1980 - 2009
- Schlussfolgerung
- Anwendung des Vetospielertheorems
- Identifizierung der Vetospieler beim Atomausstieg
- Der Atomausstieg aus Sicht des Vetospielertheorems
- Schlussfolgerung
- Öffentliche Meinung zur Atomenergie
- Anwendung der Parteiendifferenzthese
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Hintergründe des Atomausstiegs in Deutschland im Jahr 2000. Sie befasst sich mit der Frage, warum der Atomausstieg unter der rot-grünen Bundesregierung möglich war und welche Akteure maßgeblich an dem Atomkonsens beteiligt waren.
- Bedeutung der Parteiendifferenzthese für den Atomausstieg
- Rolle von Vetospielern bei der Gestaltung des Atomkonsens
- Analyse der Positionen der relevanten Parteien zur Atomenergie
- Einfluss der öffentlichen Meinung auf die Energiepolitik
- Untersuchung der Auswirkungen des Atomausstiegs auf die deutsche Energiepolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Rahmen der Arbeit vor. Sie beleuchtet den historischen Hintergrund des Atomausstiegs und skizziert die Relevanz der Parteiendifferenzthese und des Vetospielertheorems für die Untersuchung.
Das zweite Kapitel erläutert den theoretischen Rahmen der Arbeit. Es behandelt die Parteiendifferenzthese und das Vetospielertheorem, die als Analyseinstrumente für den Atomausstieg dienen.
Kapitel drei beschreibt den Prozess der Atomausstiegsverhandlungen und die Inhalte des Atomkonsens.
Im vierten Kapitel wird die Parteiendifferenzthese anhand einer Analyse der Bundestagswahlprogramme der relevanten Parteien dargestellt. Es werden die Positionen der Parteien zur Atomenergie und die Bedeutung der Energiepolitik in ihren Wahlprogrammen untersucht.
Anschließend werden die relevanten Vetospieler identifiziert und ihre Positionen zum Atomausstieg aus der Sicht des Vetospielertheorems analysiert. Die öffentliche Meinung zur Atomenergie wird anhand von Umfrageergebnissen dargestellt.
Schlüsselwörter
Atomausstieg, Parteiendifferenzthese, Vetospielertheorem, Atomkonsens, Bundestagswahlprogramme, Energiepolitik, öffentliche Meinung, Deutschland
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde der Atomausstieg in Deutschland beschlossen?
Der sogenannte Atomkonsens wurde im Juni 2000 zwischen der rot-grünen Bundesregierung und den Energieversorgungsunternehmen vereinbart.
Was besagt die Parteiendifferenzthese in diesem Kontext?
Sie untersucht, ob politische Entscheidungen (wie der Atomausstieg) direkt auf die ideologischen Programme und die Zusammensetzung der Regierungsparteien zurückzuführen sind.
Wer sind „Vetospieler“ in der Energiepolitik?
Vetospieler sind Akteure (wie der Bundesrat oder große Energiekonzerne), deren Zustimmung für eine politische Änderung zwingend erforderlich ist.
Warum war der Atomausstieg unter Rot-Grün möglich?
Weil beide Koalitionspartner den Ausstieg in ihren Wahlprogrammen verankert hatten und durch Konsensverhandlungen die Widerstände der Energieversorger minimierten.
Welche Rolle spielte die öffentliche Meinung?
Eine zunehmend kritische Haltung der Bevölkerung gegenüber der Kernenergie erhöhte den politischen Druck auf die Entscheidungsträger.
- Quote paper
- Michael Heintz (Author), 2010, Der Atomausstieg in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176330