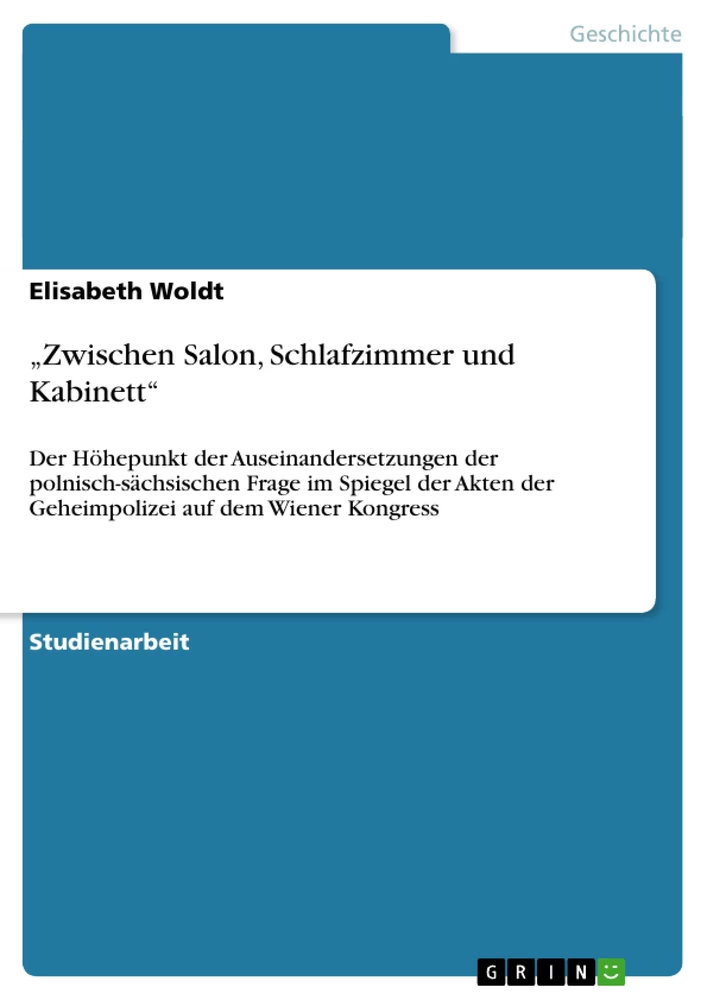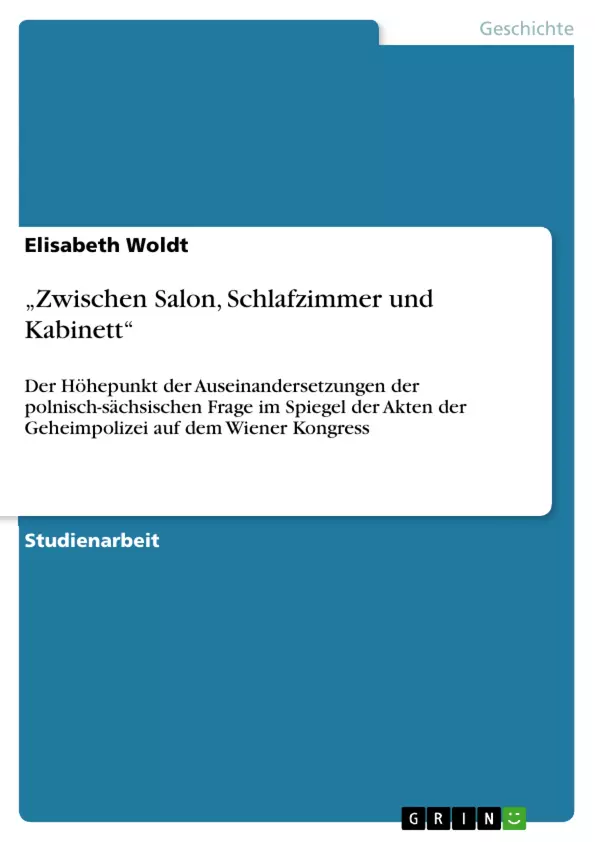Zwischen dem 18. September 1814 und dem 9. Juni 1815 sollte auf dem Wiener Kongress nicht weniger als das beste aller möglichen Europas errichtet werden, nachdem die Staatenwelt in der Napoleonischen Kriegen aus den Fugen geraten zu sein schien. Mehr als 200 Vertreter aus Staaten, Städten und anderer Körperschaften kamen nach Wien, um an den Verhandlungen teilzunehmen.
Die Politik wurde hier nicht mit großen Versammlungen gemacht, die Tatsachen wurden in Ausschüssen, nicht-öffentlichen Konferenzen, im Salon, im Ballsaal und auch im Schlafzimmer geschaffen. Der Beschluss zur Wiener Kongressakte blieb die erste und letzte offizielle Tagung im Palais am Ballhausplatz. Doch die zahlreichen Festivitäten waren dadurch nicht weniger politisch. Viel eher zeigte sich auf dem Wiener Kongress, dass die Verläufe der Geschichte eben nicht nur von alten Herren an Konferenztischen austariert werden, sondern hinter jeder Entscheidung eine riesige Bandbreite an Personen, Kommunikationen und Ereignissen hängt.
Die Begrenzung des Raums, die zahlreichen gesellschaftlichen Veranstaltungen, die Teilhabe so vieler unterschiedlicher Menschen auf so unterschiedlichen Ebenen an den Festivitäten und das beständige Misstrauen der Verhandlungsführer untereinander kreierte eine besonders gut dokumentierte, dichte Situation historischen Geschehens.
Besonders interessant sind dabei die Akten der österreichischen Geheimpolizei, die mit kaum vorstellbaren Aufwand bestimmte Teilnehmer des Kongresses überwachte. Die Dokumente geben Einblick in eine politische Realität, die jenem, der nur die Ergebnisse der Verhandlungen betrachtet, verborgen blieben. Sie eröffnen ein Gelflecht von Beziehungen, Kommunikationen und Stimmungen, die unter anderen Umständen wohl kaum politisch erschienen wären, jedoch in Wien eine europapolitische Dimension entfalteten.
Jenen Akten widmet sich die vorliegende Proseminararbeit. Dabei sollen besonders die Verhandlungen auf Grund der polnisch-sächsischen Frage näher betrachtet werden. Es gilt zu untersuchen, wie sich das Thema in den Berichten widerspiegelt und welche geheimen Informationen, auf welche Weise in die geheime Polizeihofstelle gelangten. Im Hintergrund steht dabei die Frage, welchen zusätzlichen Aufschluss diese Erkenntnisse über Wiener Kongress ermöglichen. Kurze Einführungen in die Thematik der Polnisch-Sächsischen Frage und die Entstehung der Österreichischen Geheimpolizei sollen weitere Hintergrundinformationen für diese Analyse geben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Polnisch-Sächsische Frage
- Spitzel, Confidenten und Chiffons – Die Akten der Wiener Geheimpolizei
- Politische Polizei
- Die Praxis der Geheimpolizei auf dem Wiener Kongress
- Eine kurze Quellenkritik der Polizei-Akten vom Wiener Kongress
- Die Polnisch-Sächsische Frage im Spiegel der Akten der Wiener Geheimpolizei im Dezember 1814
- Fazit: Ein Gesellschaftsstück am Übergang zur Moderne
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Akten der österreichischen Geheimpolizei während des Wiener Kongresses, insbesondere im Dezember 1814, als die Verhandlungen um die Polnisch-Sächsische Frage besonders angespannt waren. Sie befasst sich mit den Informationen, die die Geheimpolizei sammelte, und den Methoden, die sie anwendete. Die Arbeit analysiert, welchen zusätzlichen Aufschluss diese Erkenntnisse über den Wiener Kongress liefern.
- Die Polnisch-Sächsische Frage als zentrale Streitpunkt des Wiener Kongresses
- Die Rolle der österreichischen Geheimpolizei und ihre Überwachungsmethoden
- Die geheimen Informationen, die die Geheimpolizei sammelte, und ihre Bedeutung für die Verhandlungen
- Die Auswirkungen der Polnisch-Sächsischen Frage auf die internationalen Beziehungen
- Der Wiener Kongress als Schauplatz politischer Machtkämpfe und gesellschaftlicher Veränderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert den historischen Hintergrund des Wiener Kongresses und seine Bedeutung für die europäische Staatenwelt. Sie stellt die Polnisch-Sächsische Frage als einen zentralen Streitpunkt des Kongresses vor und erläutert die Bedeutung der Akten der österreichischen Geheimpolizei für die Untersuchung dieser Frage. Die Arbeit konzentriert sich auf den Dezember 1814, als die Verhandlungen um die Polnisch-Sächsische Frage besonders angespannt waren.
Das Kapitel „Die Polnisch-Sächsische Frage“ beleuchtet die Entstehung des Großherzogtums Warschau und die verschiedenen Interessen der Großmächte in Bezug auf Polen und Sachsen. Es analysiert die Positionen der wichtigsten Akteure, wie Zar Alexander, Metternich, Hardenberg und Castlereagh, und die Verhandlungen, die zur Eskalation des Konflikts führten.
Das Kapitel „Spitzel, Confidenten und Chiffons – Die Akten der Wiener Geheimpolizei“ gibt Einblicke in die Funktionsweise der österreichischen Geheimpolizei während des Wiener Kongresses. Es erläutert die Methoden der Überwachung, die Quellen der Informationen und die Bedeutung der Akten für die politische Analyse des Kongresses.
Das Kapitel „Die Polnisch-Sächsische Frage im Spiegel der Akten der Wiener Geheimpolizei im Dezember 1814“ analysiert die Informationen, die die Geheimpolizei im Dezember 1814 sammelte, und stellt deren Bedeutung für die Verhandlungen und die internationalen Beziehungen in den Vordergrund.
Schlüsselwörter
Wiener Kongress, Polnisch-Sächsische Frage, Geheimpolizei, Überwachung, politische Verhandlungen, internationale Beziehungen, Europa, Großmächte, Restauration, Monarchie, Machtpolitik, Gesellschaftsgeschichte, Moderne.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel des Wiener Kongresses (1814-1815)?
Ziel war die Neuordnung Europas nach den Napoleonischen Kriegen und die Wiederherstellung eines stabilen Gleichgewichts zwischen den Großmächten.
Welche Rolle spielte die Geheimpolizei auf dem Kongress?
Die österreichische Geheimpolizei überwachte Teilnehmer mit großem Aufwand, um Informationen über Stimmungen, geheime Absprachen und Beziehungen in Salons und Schlafzimmern zu sammeln.
Was war die „Polnisch-Sächsische Frage“?
Es war einer der schwierigsten Streitpunkte: Russland wollte Polen für sich, während Preußen das Königreich Sachsen beanspruchte, was fast zu einem neuen Krieg zwischen den Großmächten führte.
Warum sind die Polizei-Akten historisch so wertvoll?
Sie geben Einblick in die informelle Politik hinter den Kulissen, die in offiziellen Protokollen nicht auftaucht, und zeigen das dichte Geflecht aus Kommunikation und Misstrauen.
Wer waren die Hauptakteure des Wiener Kongresses?
Zu den wichtigsten Figuren zählten Metternich (Österreich), Zar Alexander I. (Russland), Hardenberg (Preußen), Castlereagh (Großbritannien) und Talleyrand (Frankreich).
- Quote paper
- Elisabeth Woldt (Author), 2011, „Zwischen Salon, Schlafzimmer und Kabinett“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176405