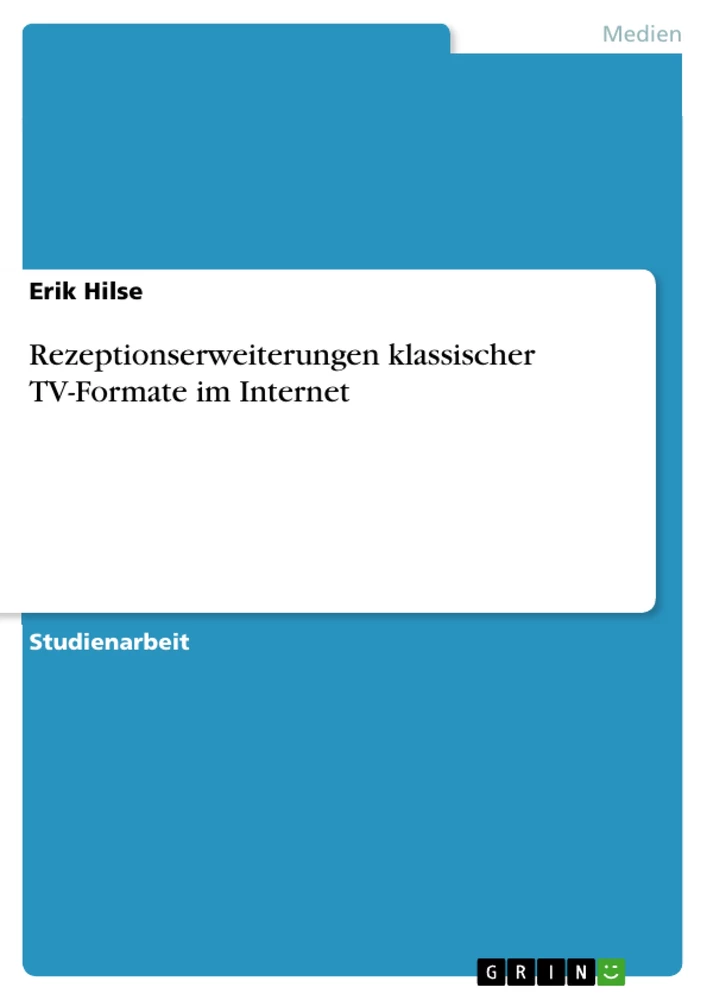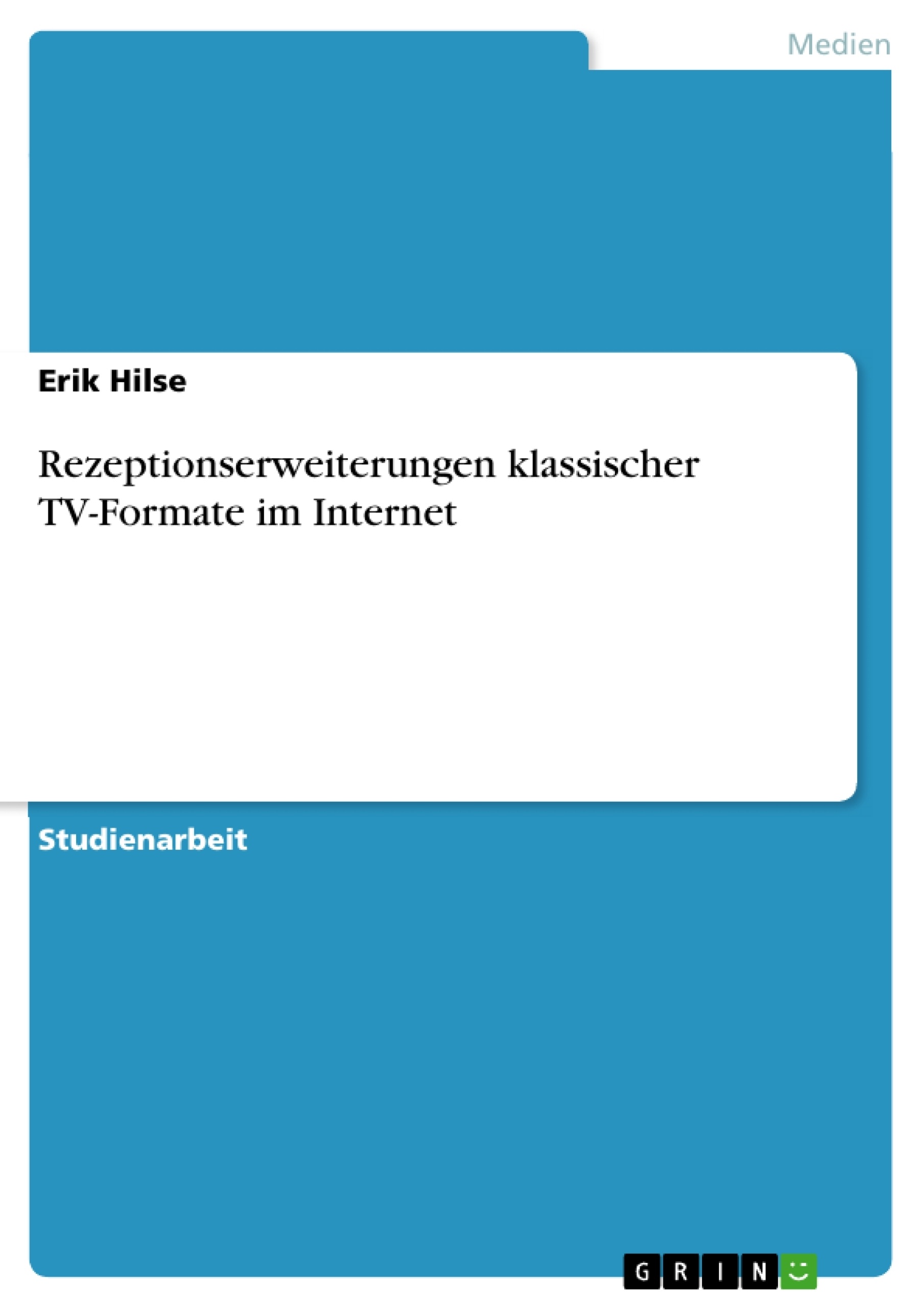Für klassische TV-Programme ergeben sich mit dem Medium Internet neue Rezeptionserweiterungen. Durch die Nutzung von TV-Programmen online und die damit verbundene Verlagerung der Verbreitungswege ins Internet, soll diese Arbeit die neuen Möglichkeiten für Vertrieb und Monetarisierung des TV-Contents aufzeigen und betrachten. Überblicksartig wird dem Leser der aktuelle Markt sowie entsprechende Plattformen und Formate vorgestellt.
Es wird eruiert, auf welchen Wegen der Zuschauer aktiv am Programm partizipieren kann und welche Einflussmöglichkeiten sich daraus auf das Nutzungsverhalten des Zuschauers bzw. die Inhalte des Anbieters ergeben. Mit einem Blick in die Zukunft des TV-Konsums auf mobilen Endgeräten schließt diese Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Vorgehensweise
- 1.3 Ziele dieser Arbeit
- 1.4 Zielgruppe
- 1.5 Begriffsklärung
- 2. Vom Konsumenten zum Produzenten
- 2.1 Wandel des TV-Konsums
- 2.2 Zeitvorteil von Mediatheken
- 3. Partizipationsmöglichkeiten im TV
- 3.1 Einbindung des Zuschauers in das Programm
- 3.1.1 E-Mail
- 3.1.2 Call In
- 3.1.3 Internet
- 3.1.4 SMS
- 3.2 Übersicht der Mediatheken
- 3.3 Interaktivität
- 3.3.1 Meinungs-Buttons
- 3.3.2 Facebook
- 3.3.3 Foren
- 4. Formen und Formate
- 4.1 TV-Formate
- 4.2 Hörfunk-Formate
- 4.3 IPTV
- 4.3.1 Funktionsweise
- 4.3.2 Anbieter von IPTV
- 4.4 Videoportale
- 4.4.1 YouTube
- 4.4.2 MySpass
- 4.4.3 Fernsehkritik.tv
- 5. Zukünftige Entwicklungen
- 5.1 Web-TV auf mobilen Endgeräten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Mini-Bachelorarbeit untersucht die Rezeptionserweiterungen klassischer TV-Formate im Internet. Ziel ist es, den Wandel des TV-Konsums und die damit verbundenen neuen Partizipationsmöglichkeiten zu analysieren. Dabei werden verschiedene interaktive Elemente und neue Plattformen wie Mediatheken und Videoportale betrachtet.
- Wandel des Fernseh-Konsums vom passiven Rezipienten zum aktiven Produzenten
- Partizipationsmöglichkeiten durch Internet, soziale Medien und interaktive Formate
- Entwicklung und Verbreitung von Mediatheken und Videoportalen
- Technologische Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf den TV-Konsum (z.B. IPTV, mobile Endgeräte)
- Vergleich verschiedener TV- und Online-Formate
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Rezeptionserweiterungen klassischer TV-Formate im Internet ein. Es beschreibt die Problemstellung, die Vorgehensweise der Arbeit, die Ziele, die Zielgruppe und klärt wichtige Begriffe. Der Fokus liegt auf der Untersuchung des Wandels im Fernseh-Konsum und der Integration neuer interaktiver Möglichkeiten.
2. Vom Konsumenten zum Produzenten: Dieses Kapitel analysiert den Wandel des Fernseh-Konsums. Es beschreibt den Übergang vom passiven Zuschauer zum aktiven Teilnehmer und Konsumenten. Die zunehmende Bedeutung von Mediatheken und deren Vorteil hinsichtlich der zeitlichen Flexibilität werden beleuchtet. Der Paradigmenwechsel von reinem Konsum zu aktivem Mitwirken und Mitgestaltung wird als zentraler Punkt herausgestellt.
3. Partizipationsmöglichkeiten im TV: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Möglichkeiten der Zuschauerbeteiligung an Fernsehprogrammen. Es beleuchtet klassische Methoden wie E-Mail, Call-in und SMS, aber konzentriert sich vor allem auf die Rolle des Internets als Plattform für Interaktion. Die Analyse von Mediatheken und die verschiedenen interaktiven Funktionen wie Meinungs-Buttons, Facebook-Integration und Foren stehen im Mittelpunkt. Es wird der Einfluss der neuen Medien auf die Partizipation der Zuschauer an TV-Inhalten dargestellt.
4. Formen und Formate: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene TV- und Online-Formate und deren Entwicklung. Es vergleicht klassische TV-Formate mit Hörfunkformaten und geht detailliert auf IPTV und seine Funktionsweise sowie Anbieter ein. Schließlich werden populäre Videoportale wie YouTube, MySpass und Fernsehkritik.tv im Hinblick auf ihre Rolle in der Rezeption von TV-Inhalten untersucht. Die verschiedenen Verbreitungs- und Präsentationswege von Inhalten werden vergleichend dargestellt.
5. Zukünftige Entwicklungen: In diesem Kapitel werden zukünftige Entwicklungen im Bereich des Fernsehens und der Mediennutzung prognostiziert. Der Fokus liegt auf der Verbreitung von Web-TV auf mobilen Endgeräten und den damit verbundenen Chancen und Herausforderungen. Es wird die Entwicklung der Mediennutzung und der damit verbundenen technologischen Fortschritte in den Mittelpunkt gestellt.
Schlüsselwörter
Rezeptionserweiterungen, klassische TV-Formate, Internet, Mediatheken, Videoportale, IPTV, Interaktivität, Partizipation, Zuschauerbeteiligung, Wandel des TV-Konsums, Web-TV, mobile Endgeräte, soziale Medien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Mini-Bachelorarbeit: Rezeptionserweiterungen klassischer TV-Formate im Internet
Was ist der Gegenstand dieser Mini-Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Veränderungen im Fernseh-Konsum durch das Internet. Im Fokus stehen die neuen Möglichkeiten der Zuschauerbeteiligung und der Wandel vom passiven Rezipienten zum aktiven Produzenten von Inhalten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Wandel des Fernseh-Konsums, den Partizipationsmöglichkeiten durch Internet und soziale Medien, der Entwicklung von Mediatheken und Videoportalen, technologischen Entwicklungen wie IPTV und deren Auswirkungen, sowie dem Vergleich verschiedener TV- und Online-Formate. Die zukünftige Entwicklung des Web-TV auf mobilen Endgeräten wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem einzelnen Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein und definiert die Ziele und die Methodik. Kapitel 2 ("Vom Konsumenten zum Produzenten") analysiert den Wandel des Fernseh-Konsums. Kapitel 3 ("Partizipationsmöglichkeiten im TV") untersucht verschiedene Möglichkeiten der Zuschauerbeteiligung. Kapitel 4 ("Formen und Formate") gibt einen Überblick über verschiedene TV- und Online-Formate. Kapitel 5 ("Zukünftige Entwicklungen") beschäftigt sich mit zukünftigen Trends, insbesondere Web-TV auf mobilen Endgeräten.
Welche konkreten Beispiele für Partizipationsmöglichkeiten werden genannt?
Die Arbeit nennt E-Mail, Call-in, SMS, Internetforen, Meinungs-Buttons und Facebook-Integration als Beispiele für interaktive Möglichkeiten der Zuschauerbeteiligung an Fernsehprogrammen.
Welche Plattformen und Technologien werden im Detail betrachtet?
Die Arbeit analysiert Mediatheken, Videoportale (YouTube, MySpass, Fernsehkritik.tv) und IPTV, inklusive Funktionsweise und Anbieter.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Wandel des TV-Konsums und die damit verbundenen neuen Partizipationsmöglichkeiten zu analysieren und zu verstehen.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Zielgruppe ist im Text nicht explizit definiert, aber sie richtet sich vermutlich an Personen, die sich für Medienwissenschaften, Kommunikationswissenschaften, oder den Wandel der Medienlandschaft interessieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Rezeptionserweiterungen, klassische TV-Formate, Internet, Mediatheken, Videoportale, IPTV, Interaktivität, Partizipation, Zuschauerbeteiligung, Wandel des TV-Konsums, Web-TV, mobile Endgeräte, soziale Medien.
- Quote paper
- Erik Hilse (Author), 2011, Rezeptionserweiterungen klassischer TV-Formate im Internet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176408