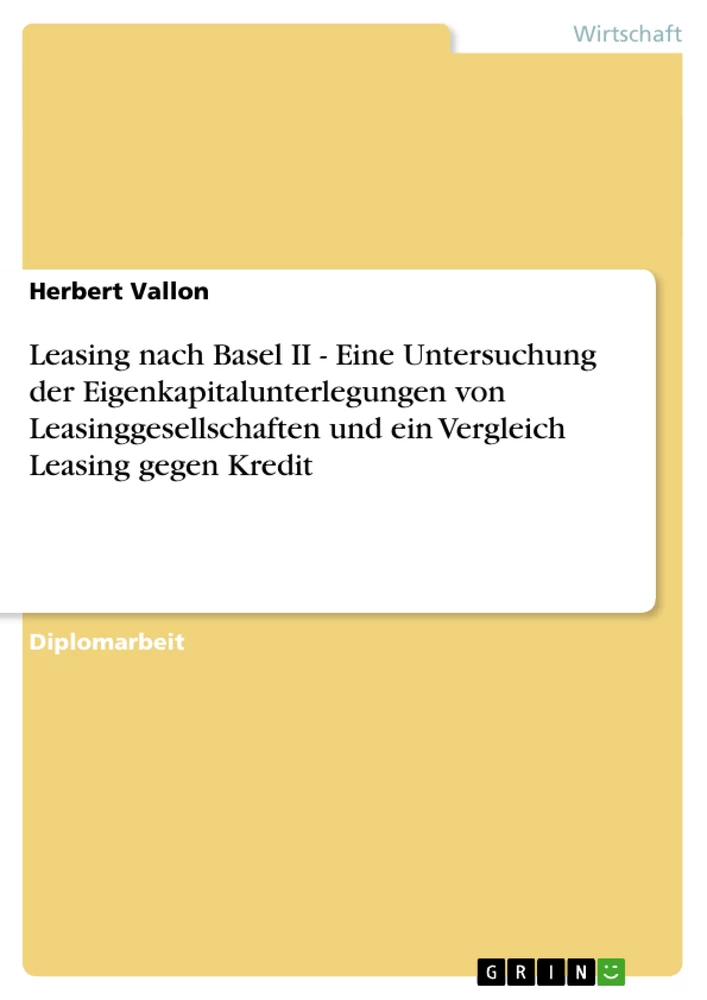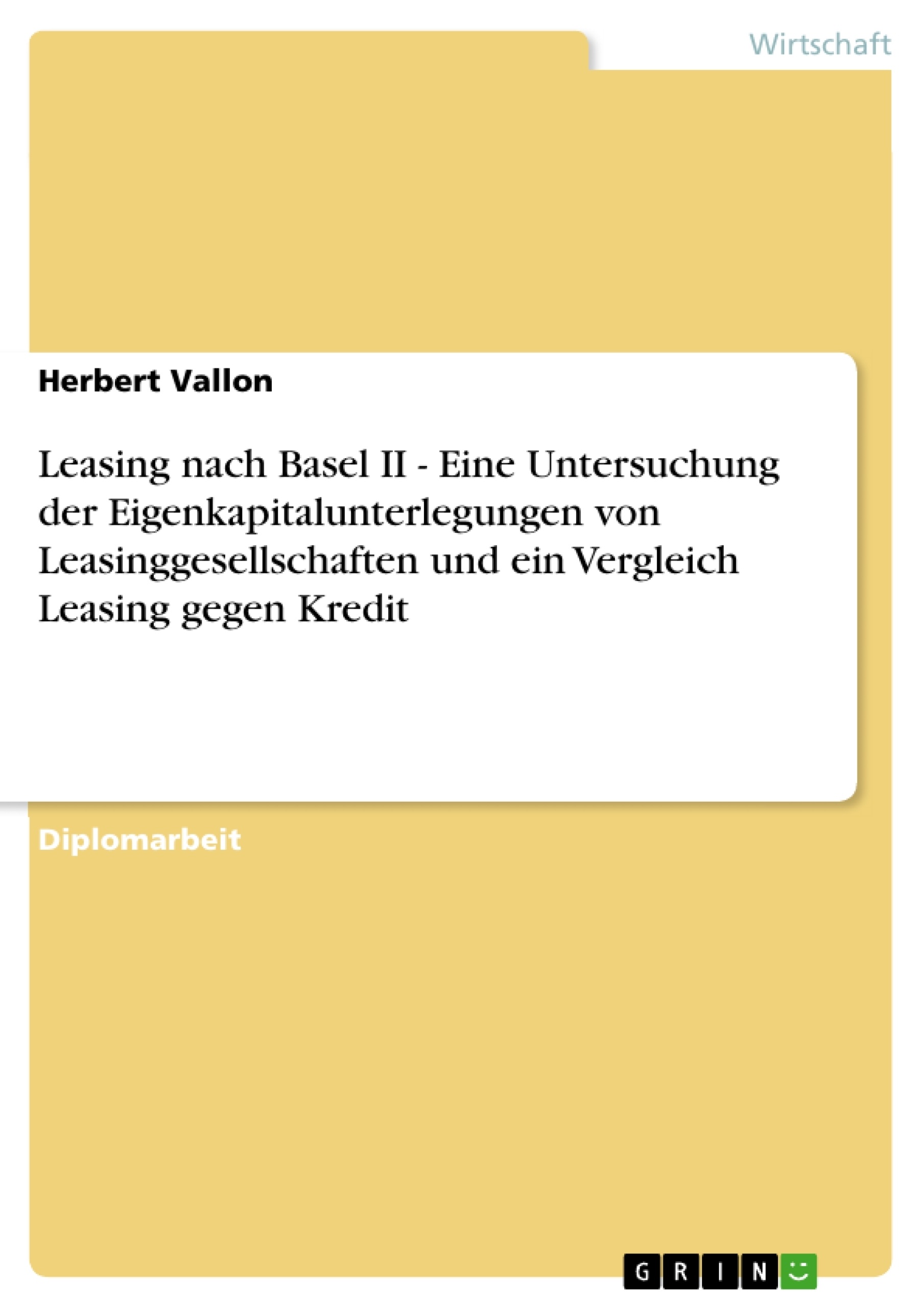Kleine Veränderungen bewirken oft Großes.
Dies trifft nicht nur auf Abstraktes zu, sondern auch auf tatsächliche, tagtägliche Vorgänge, wie sie zum Beispiel in der Finanzwelt ablaufen. Zunehmender Wettbewerb in der Bankenbranche bringen Entwicklungen mit eklatanter Intensität mit sich, die vor zehn Jahren noch undenkbar waren. Die Mischung aus einer Globalisierung, die Ländergrenzen fast unsichtbar werden lassen, unterstützt von einer rasenden Entwicklung in den Informations- und Kommunikationstechnologien und verstärktem Wettbewerb, ermöglichen völlig neue Perspektiven der Unternehmensfinanzierung. Banken konkurrieren zunehmend mit Fondsgesellschaften, Pensionskassen und Versicherungen. Zunehmend holen sich Unternehmen direkt am Kapitalmarkt Geld, ohne ein Geldinstitut als Zwischenstation einzuschalten. Die Bedeutung dieses Marktes lässt Anpassungen in den Finanzierungsstrukturen zu, die Unternehmen erlauben, mehrere Alternativen in Anspruch zu nehmen. Die – unter dem landläufigen Begriff verstandene - „Hausbank“ gerät zunehmend unter Druck, allen Bedürfnissen der Unternehmerkunden gerecht zu werden.
Insolvenzen von Banken haben aber schweren, negativen Einfluss auf jede Volkswirtschaft, sodass ein Konsortium der finanzstärksten Länder der Welt sich zu einer Interessensgemeinschaft zusammengeschlossen hat. Der Baseler Ausschuss hat bereits im Jahre 1988 weitreichende Kriterien für die Eigenkapitalunterlegung von Finanzierungen der Banken und Kreditinstitute beschlossen. Eine Neuregelung dieser Bestimmungen findet nun Beachtung im zweiten Konsultationspapier dieses Ausschusses, auch kurz Basel II genannt.
Im Zuge reger Diskussionen zur Finanzierung nach der Einführung von Basel II wird häufig Leasing als Alternative genannt. In der Tat kann Leasing zur Verbesserung der Außendarstellung eines Unternehmens herangezogen werden, wenngleich Rating-Agenturen Leasingverpflichtungen sehr wohl in die Bewertungen einfließen lassen. Zudem ist Leasing bereits lange bei vielen Unternehmen fixer Bestandteil der Finanzierung. Leasing ist bereits seit Jahrzehnten in Österreich zu finden. Besonders die hohe Flexibilität und die bilanzentlastende Wirkung haben dem Leasing zu einem starken Aufschwung verholfen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Kapitelübersicht
- 2. Die neuen Basler Eigenkapitalvereinbarungen
- 2.1 Die Geschichte von Basel II
- 2.2 Die drei Säulen der Neuen Eigenkapitalvereinbarungen
- 2.2.1 Mindestkapitalanforderungen
- 2.2.2 Überprüfungsverfahren durch die Bankenaufsicht
- 2.2.3 Marktdisziplin
- 2.3 Rating unter Basel II
- 2.3.1 Der Standardansatz
- 2.3.2 Der IRB-Ansatz
- 3. Leasing in Österreich
- 3.1 Definition von Leasing
- 3.1.1 Anwendung von Leasing
- 3.1.2 Geschichtlicher Hintergrund
- 3.1.3 Einordnung von Leasing in die betriebliche Finanzierung
- 3.1.4 Leasing in Österreich
- 3.2 Formen des Leasing
- 3.2.1 Operating-Leasing
- 3.2.2 Finanzierungs-Leasing
- 3.3 Betriebswirtschaftliche Aspekte des Leasings
- 3.3.1 Pro Leasing
- 3.3.1.1 Finanzierungsargumente
- 3.3.1.2 Steuerliche Argumente
- 3.3.1.3 Qualitative Argumente
- 3.3.2 Contra Leasing
- 3.3.1 Pro Leasing
- 3.1 Definition von Leasing
- 4. Leasinggesellschaften unter der Betrachtung von Basel II
- 5. Kalkulation von Leasinggesellschaften
- 5.1 Mindestmargenkalkulation
- 5.2 Kostenzurechnungen in der Leasingkalkulation
- 5.2.1 Refinanzierung
- 5.2.2 Risikokosten
- 5.2.2.1 Arten von Risiken
- 5.2.2.2 Berechnung der Risikokosten
- 5.2.3 Verwaltungs- und Betriebskosten
- 5.2.4 Overheadkosten
- 5.2.5 Eigenkapitalkosten
- 5.2.6 Gewinnmarge
- 5.3 Abschließende Betrachtung
- 5.4 Kurzbeispiel einer Kalkulation
- 5.5 Zinsszenario nach Basel II
- 6. Risikobetrachtung von Leasinggesellschaften
- 6.1 Bonitätsrisiken
- 6.2 Objektrisiken
- 6.3 Marktrisiken
- 6.4 Sonstige Risiken
- 6.4.1 Zinsänderungsrisiken
- 6.4.2 Währungsrisiken
- 6.4.3 Risiken rechtlicher Natur
- 6.5 Schlussbemerkungen
- 7. Verteilung des Risikos bei Leasinggesellschaften
- 7.1 Definition des Diversifikationseffekts
- 7.2 Wirksamkeit des Diversifikationseffekts
- 7.3 Übertragbarkeit des Diversifikationseffekts auf Leasinggesellschaften
- 8. Vorteile von Leasinggesellschaften nach Basel II
- 8.1 Eigenkapitalunterlegung von Leasinggesellschaften
- 8.2 Ausnützen des Diversifikationseffekts
- 8.3 Weitere Argumente für Leasing
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen der Basler Eigenkapitalvereinbarungen (Basel II) auf Leasinggesellschaften. Ziel ist es, die Eigenkapitalunterlegung von Leasinggesellschaften zu analysieren und einen Vergleich zwischen Leasing und Kreditfinanzierung im Kontext von Basel II zu ziehen. Die Arbeit beleuchtet die spezifischen Risiken im Leasinggeschäft und deren Behandlung nach Basel II.
- Eigenkapitalunterlegung von Leasinggesellschaften unter Basel II
- Risikoprofile und -bewertung im Leasinggeschäft
- Vergleich Leasing vs. Kreditfinanzierung
- Auswirkungen von Basel II auf die Kalkulation von Leasinggesellschaften
- Diversifikationseffekte im Leasinggeschäft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Diplomarbeit ein, indem es die Problemstellung der Eigenkapitalunterlegung von Leasinggesellschaften im Kontext der Basler Eigenkapitalvereinbarungen (Basel II) darlegt und einen Überblick über die Struktur der Arbeit gibt. Es stellt die Relevanz des Themas heraus und skizziert die folgenden Kapitel.
2. Die neuen Basler Eigenkapitalvereinbarungen: Dieses Kapitel beschreibt die neuen Basler Eigenkapitalvereinbarungen (Basel II) detailliert, einschließlich ihrer Geschichte, der drei Säulen (Mindestkapitalanforderungen, Aufsichtsüberprüfung und Marktdisziplin) und der verschiedenen Rating-Ansätze (Standardansatz und IRB-Ansatz). Es beleuchtet die Bedeutung der neuen Regelungen für die Finanzindustrie und die damit verbundenen Herausforderungen.
3. Leasing in Österreich: Dieses Kapitel definiert Leasing, beschreibt seine verschiedenen Formen (Operating-Leasing und Finanzierungs-Leasing) und untersucht seine geschichtlichen Hintergründe sowie seine betriebswirtschaftlichen Aspekte in Österreich. Es werden sowohl die Vor- als auch die Nachteile des Leasings gegenüber anderen Finanzierungsformen umfassend diskutiert. Dabei werden finanzielle, steuerliche und qualitative Argumente berücksichtigt.
4. Leasinggesellschaften unter der Betrachtung von Basel II: Dieses Kapitel befasst sich mit der spezifischen Situation von Leasinggesellschaften im Rahmen der Basler Eigenkapitalvereinbarungen. Es definiert Leasinggesellschaften, beschreibt ihre Bedeutung im Finanzsystem und analysiert, wie sie unter Basel I und II reguliert werden. Der Fokus liegt auf den besonderen Herausforderungen und Chancen, die sich für Leasinggesellschaften aus den neuen Regeln ergeben.
5. Kalkulation von Leasinggesellschaften: In diesem Kapitel wird die Kalkulation von Leasinggesellschaften im Detail erklärt. Es werden verschiedene Kostenfaktoren (Refinanzierung, Risikokosten, Verwaltungs- und Betriebskosten, Overheadkosten und Eigenkapitalkosten) analysiert und in ein umfassendes Kalkulationsschema integriert. Ein Beispiel einer konkreten Kalkulation unter Berücksichtigung verschiedener Bonitätsstufen und Zinsszenarien nach Basel II verdeutlicht die praktische Anwendung.
6. Risikobetrachtung von Leasinggesellschaften: Dieses Kapitel widmet sich den verschiedenen Risiken, denen Leasinggesellschaften ausgesetzt sind. Es analysiert Bonitätsrisiken, Objektrisiken, Marktrisiken und sonstige Risiken wie Zinsänderungs-, Währungs- und rechtliche Risiken. Die unterschiedlichen Risikotypen werden detailliert beschrieben und deren Bedeutung für die Kapitalunterlegung unter Basel II hervorgehoben.
7. Verteilung des Risikos bei Leasinggesellschaften: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Diversifikationseffekt und dessen Bedeutung für die Risikominderung bei Leasinggesellschaften. Es definiert den Diversifikationseffekt, analysiert seine Wirksamkeit und untersucht, inwieweit dieser Effekt auf Leasinggesellschaften übertragbar ist. Der Zusammenhang zwischen Diversifikation und Risikoreduktion wird ausführlich erläutert.
8. Vorteile von Leasinggesellschaften nach Basel II: Dieses Kapitel fasst die Vorteile zusammen, die Leasinggesellschaften im Kontext der Basler Eigenkapitalvereinbarungen haben. Es behandelt die Eigenkapitalunterlegung, die Möglichkeit, den Diversifikationseffekt auszunutzen und weitere Argumente, die für die Wahl von Leasing sprechen. Die Kapitel verdeutlicht die positive Stellung von Leasinggesellschaften nach den neuen Regulierungen.
Schlüsselwörter
Basel II, Eigenkapitalunterlegung, Leasing, Leasinggesellschaften, Risikomanagement, Kreditfinanzierung, Diversifikation, Kalkulation, Bonitätsprüfung, Rating, Österreich.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Auswirkungen der Basler Eigenkapitalvereinbarungen (Basel II) auf Leasinggesellschaften
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen der Basler Eigenkapitalvereinbarungen (Basel II) auf Leasinggesellschaften in Österreich. Im Mittelpunkt stehen die Eigenkapitalunterlegung, die Risikobetrachtung und der Vergleich von Leasing mit der Kreditfinanzierung im Kontext von Basel II.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Eigenkapitalunterlegung von Leasinggesellschaften unter Basel II, Risikoprofile und -bewertung im Leasinggeschäft, Vergleich Leasing vs. Kreditfinanzierung, Auswirkungen von Basel II auf die Kalkulation von Leasinggesellschaften und Diversifikationseffekte im Leasinggeschäft. Die Arbeit definiert Leasing, beschreibt verschiedene Leasingformen (Operating- und Finanzierungsleasing) und analysiert die spezifischen Risiken von Leasinggesellschaften (Bonitäts-, Objekt-, Markt- und weitere Risiken).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert: Einleitung mit Problemstellung und Kapitelübersicht, detaillierte Beschreibung der Basler Eigenkapitalvereinbarungen (Basel II), umfassende Darstellung des Leasings in Österreich, Betrachtung von Leasinggesellschaften unter Basel II, detaillierte Kalkulation von Leasinggesellschaften inklusive Kostenfaktoren und Beispielrechnung, Risikobetrachtung von Leasinggesellschaften, Analyse des Diversifikationseffekts bei Leasinggesellschaften und Zusammenfassung der Vorteile von Leasinggesellschaften nach Basel II.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine deskriptive und analytische Methode. Sie beschreibt die Basler Eigenkapitalvereinbarungen und das Leasingwesen, analysiert die Auswirkungen von Basel II auf Leasinggesellschaften und vergleicht Leasing mit anderen Finanzierungsformen. Eine detaillierte Kalkulation veranschaulicht die praktische Anwendung der theoretischen Erkenntnisse.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die konkreten Schlussfolgerungen lassen sich nur durch das Lesen der vollständigen Diplomarbeit entnehmen. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet jedoch einen Überblick über die behandelten Aspekte und die zentralen Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Basel II, Eigenkapitalunterlegung, Leasing, Leasinggesellschaften, Risikomanagement, Kreditfinanzierung, Diversifikation, Kalkulation, Bonitätsprüfung, Rating, Österreich.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit den Auswirkungen von Basel II auf die Finanzindustrie und insbesondere auf Leasinggesellschaften befassen. Dies umfasst Studierende, Wissenschaftler, Mitarbeiter von Leasinggesellschaften, Bankenaufsichtsbehörden und alle Interessierten an den Themen Leasing, Risikomanagement und Finanzregulierung.
Wo finde ich die vollständige Diplomarbeit?
Die vollständige Diplomarbeit ist nicht in diesem FAQ enthalten. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit der Arbeit müssen über den Herausgeber eingeholt werden.
- Citar trabajo
- Herbert Vallon (Autor), 2003, Leasing nach Basel II - Eine Untersuchung der Eigenkapitalunterlegungen von Leasinggesellschaften und ein Vergleich Leasing gegen Kredit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17647