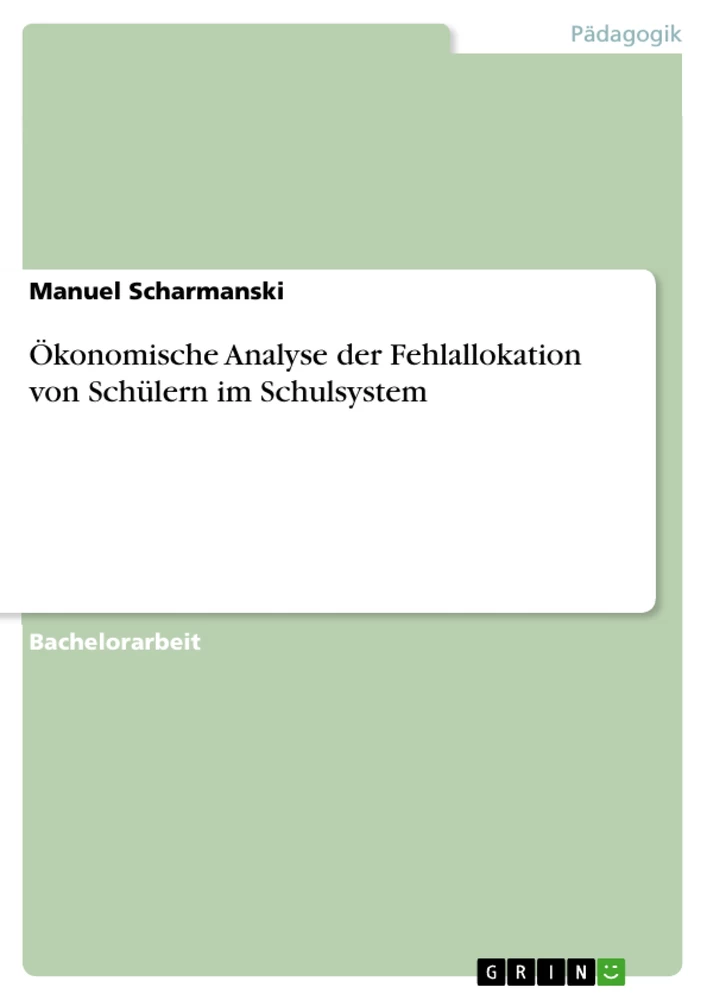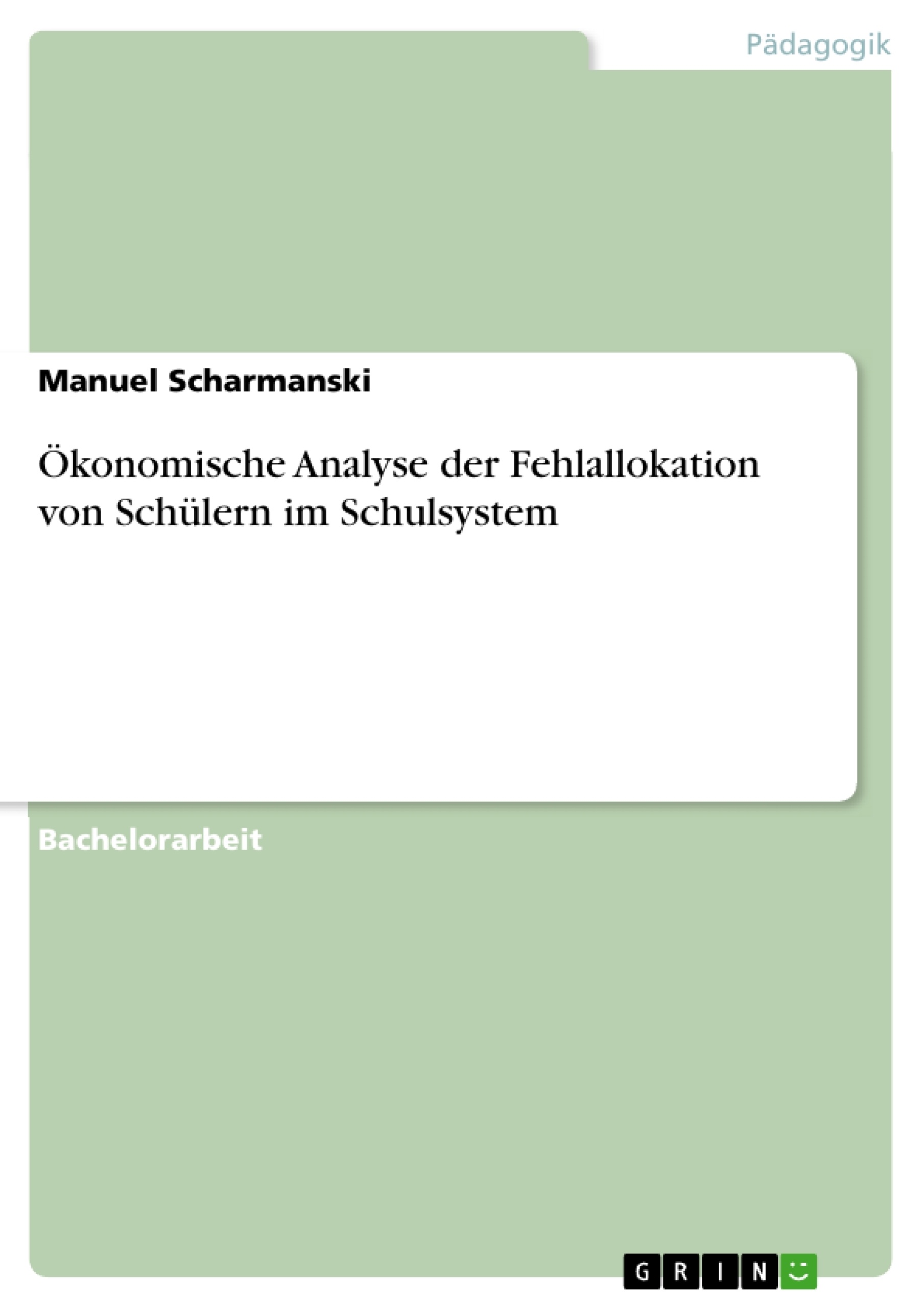Lehrkräfte sind gezwungen, ihre Empfehlungen für Schüler im Hinblick auf weiterführende Schulen vor dem Hintergrund subjektiver Leistungsnormen zu treffen. Aufgrund dieser Tatsache ist eine Fehlallokation von Schülern nach der ersten schulischen Selektion, die sich dadurch erkennbar zeigt, dass nicht nur nach den Fähigkeiten der Schüler sortiert wird, sehr wahrscheinlich. Und gerade weil der Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe als entscheidende Weichenstellung im deutschen Schulsystem gilt, kann eine solche Bildungsbenachteiligung einen massiven Einschnitt für den zukünftigen Lebensweg der betroffenen Schüler bedeuten.
Doch wie entstehen Fehlallokationen überhaupt und welche Ursachen liegen diesen zugrunde? Wie kann sichergestellt werden, dass Schüler entsprechend ihrer tatsächlichen Leistungsfähigkeit auf adäquate Schultypen selektiert werden? Gibt es Schülergruppen die besonders gefährdet sind, falsch aufgeteilt zu werden? Dies sind einige Kernfragen, die in der vorliegenden Arbeit „Ökonomische Analyse der Fehlallokation von Schülern im Schulsystem“ beantwortet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Anlass und Zielsetzung
- 2. Schullaufbahnpräferenzen und Empfehlungsverhalten
- 2.1 Schulrecht versus Elternrecht in ausgewählten Bundesländern
- 2.2 Schulformempfehlung und Schulformentscheidung
- 2.3 Übergangsempfehlung aus Sicht der Lehrkräfte
- 2.4 Zwischenfazit
- 3. Determinanten für die Prognose des künftigen Schulerfolgs
- 3.1 Schulnahe Kriterien
- 3.2 Leistungsmerkmale
- 3.3 Zusammenschau
- 4. Utopie Bildungsgerechtigkeit - Disparitäten im deutschen Schulsystem
- 4.1 Sozioökonomische Aspekte bei der Schullaufbahnempfehlung
- 4.2 Unterschiede im Empfehlungsverhalten gegenüber Jungen und Mädchen
- 4.3 Migrationshintergrund und Schullaufbahnempfehlung von Lehrkräften
- 4.4 Regionale Divergenzen bei der Schullaufbahnempfehlung
- 4.5 Zwischenfazit und Hypothesen
- 5. Empirische Untersuchung bildungspolitischer Ungleichheiten
- 5.1 Theoretisches Modell zur Bestimmung der Übertrittswahrscheinlichkeit
- 5.2 Zentrale Ergebnisse
- 5.3 Zusammenfassung
- 6. Fehlallokationen im deutschen Schulsystem
- 6.1 Testleistungen und Schullaufbahnpräferenzen der Lehrkräfte
- 6.2 Die Grenzen Schulnoten als Prognoseinstrument
- 7. Zusammenschau
- 8. Warum eine leistungsgerechte Aufteilung von Schülern so wichtig ist
- 8.1 Beschränkte Wechselmöglichkeiten zwischen Schulformen
- 8.2 Bildungsentscheidung und beruflicher Werdegang
- 8.3 Zusammenfassung
- 9. Lösungsansätze - wie Fehlallokationen eingeschränkt werden können
- 9.1 Die Förderung diagnostischer Kompetenzen
- 9.2 Das Problem der frühen Bildungsselektion
- 9.3 Frühkindliche Bildung
- 9.4 Das zweigliedrige Schulsystem
- 9.5 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit „Ökonomische Analyse der Fehlallokation von Schülern im Schulsystem“ befasst sich mit dem Problem der Bildungsungleichheit im deutschen Schulsystem. Sie analysiert die Ursachen und Auswirkungen von Fehlallokationen im Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I.
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Schullaufbahnempfehlung
- Einflussfaktoren auf die Schullaufbahnempfehlung
- Empirische Untersuchung von Bildungsungleichheiten
- Analyse der Prognosefähigkeit von Schulnoten
- Lösungsansätze zur Reduzierung von Fehlallokationen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Schullaufbahnpräferenz und dem Empfehlungsverhalten der Lehrkräfte. Es werden die rechtlichen Rahmenbedingungen in Hessen und Baden-Württemberg sowie die Unterschiede in der Gewichtung von Elternwillen und Lehrereinschätzung aufgezeigt. Zudem werden die Unterschiede zwischen Schulformempfehlung und Schulformentscheidung sowie die subjektiven Empfehlungskriterien der Lehrkräfte beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich den Determinanten für die Prognose des zukünftigen Schulerfolgs. Es wird ein einfaches prognostisches Modell vorgestellt, das schulnahe Kriterien und Leistungsmerkmale einbezieht. Kapitel 4 behandelt die Problematik sozialer und regionaler Bildungsungleichheiten bezüglich der Übergangsempfehlung. Die Hypothesen, die in diesem Kapitel aufgestellt werden, werden in Kapitel 5 empirisch untersucht.
Kapitel 6 geht der Frage nach, wie Fehlallokationen im deutschen Schulsystem nachgewiesen und die Grenzen von Schulnoten als Prognoseinstrument aufgezeigt werden können. Kapitel 7 beleuchtet die Wichtigkeit einer leistungsgerechten Aufteilung von Schülern. Die Durchlässigkeit der Sekundarstufe I und die wirtschaftliche Bedeutung der Selektionsentscheidung werden erörtert.
Kapitel 8 präsentiert potentielle Handlungsempfehlungen an die Politik, mit deren Hilfe Chancenungleichheiten im Bildungsverlauf verringert werden können. Kapitel 9 fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit noch einmal zusammen.
Schlüsselwörter
Bildungsgerechtigkeit, Fehlallokation, Schullaufbahnempfehlung, Übergangsempfehlung, Schulrecht, Elternrecht, Leistungsmerkmale, Bildungsungleichheit, soziale Herkunft, Migrationshintergrund, Kompetenzniveau, Prognosefähigkeit, Schulnoten, Handlungsempfehlungen, Bildungsselektion
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Fehlallokation im Schulsystem?
Fehlallokation bedeutet, dass Schüler nicht entsprechend ihrer tatsächlichen Leistungsfähigkeit auf die weiterführenden Schulformen (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) verteilt werden.
Welche Rolle spielen Lehrkräfte beim Übergang in die Sekundarstufe?
Lehrkräfte geben Empfehlungen ab, die jedoch oft auf subjektiven Leistungsnormen basieren und durch soziale Faktoren beeinflusst werden können.
Welche Schülergruppen sind besonders von Bildungsbenachteiligung betroffen?
Besonders gefährdet sind Kinder aus einkommensschwachen Familien, Kinder mit Migrationshintergrund und teilweise gibt es auch Unterschiede im Empfehlungsverhalten gegenüber Jungen und Mädchen.
Sind Schulnoten ein zuverlässiges Prognoseinstrument?
Die Arbeit zeigt die Grenzen von Schulnoten auf, da diese oft nicht die tatsächlichen Kompetenzniveaus widerspiegeln und regional stark variieren können.
Wie kann man Fehlallokationen reduzieren?
Lösungsansätze sind die Förderung diagnostischer Kompetenzen der Lehrer, eine spätere Bildungsselektion oder die Einführung zweigliedriger Schulsysteme.
- Quote paper
- Manuel Scharmanski (Author), 2010, Ökonomische Analyse der Fehlallokation von Schülern im Schulsystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176477