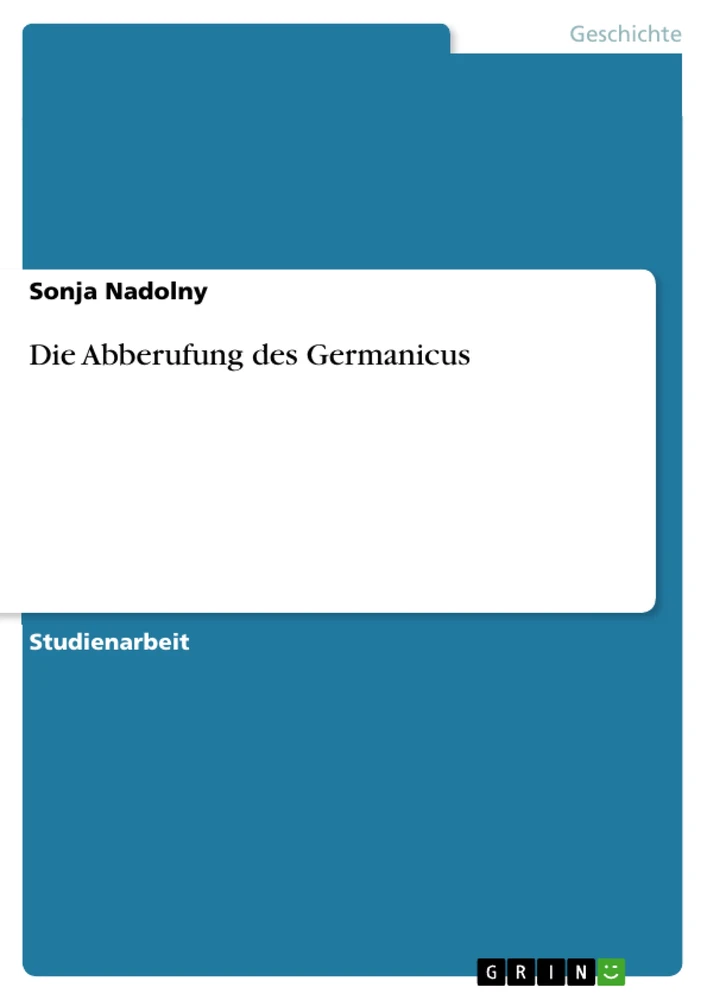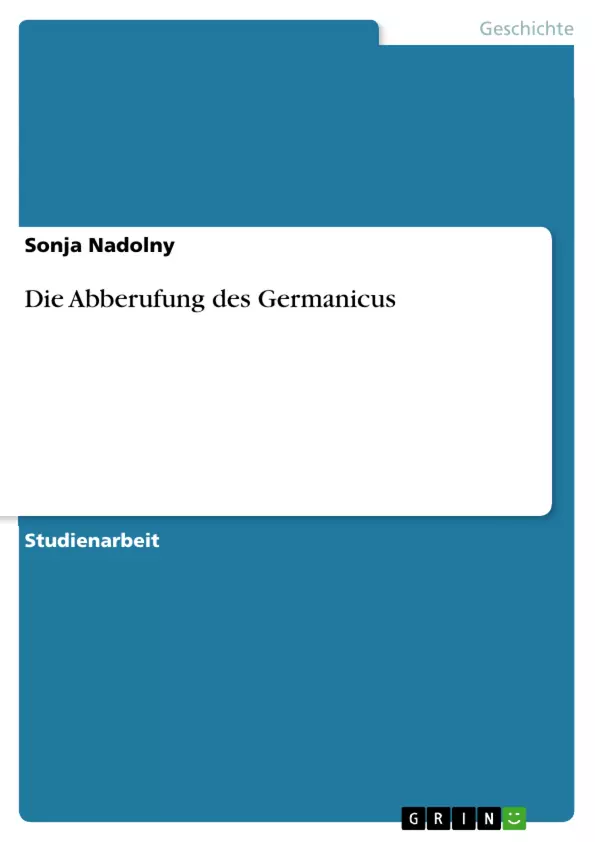Am 26. Mai 17 wurde Germanicus Caesar mit einem Triumph „de Cheruscis Chattisque et Angrivariis quaeque aliae nationes usque ad Albim colunt“ geehrt. Dieser Triumph bildete den offiziellen Abschluss einer Reihe von Feldzügen im rechtsrheinischen Germanien, deren Ziele und Strategie entscheidend durch die Varus-Niederlage im Jahre 9 n.Chr. bestimmt worden waren. Die Schmach der Niederlage lastete schwer auf dem römischen Selbstbewusstsein und verlangte nach Rache. Umso bedeutender war ein erfolgreicher Abschluss der Feldzüge, der das Prestige der römischen Waffen vor den Germanen, anderen Völkern und der römischen Öffentlichkeit wiederherstellen sollte. Der Triumph des Germanicus über die Völker bis zur Elbe war damit ein weithin sichtbares Symbol der Stärke und des Stolzes Roms.
Über das tatsächliche Ergebnis der Feldzüge konnte er jedoch nicht lange hinwegtäuschen: Zwar konnten die Germanen in mehreren Schlachten besiegt und zwei der drei unter Varus verlorenen Legionsadler zurückgewonnen werden. Zum Zeitpunkt der Abberufung des Germanicus durch Tiberius konnte von einer Unterwerfung der Gegner im Gebiet bis zur Elbe jedoch keine Rede sein. Die triumphale Ehrung des Germanicus entsprach in keinster Weise dem, was wirklich erreicht worden war. So markiert das Ende der Germanicus-Feldzüge nicht etwa den Beginn einer römischen Herrschaft im rechtsrheinischen Germanien, sondern im Gegenteil die Aufgabe der offensiven Politik im Nordosten und den dauerhaften Rückzug Roms auf die Rheingrenze.
Die Fiktion eines besiegten Germaniens, die durch den Triumph heraufbeschworen wurde, überlebte den Tod des Germanicus nicht - dafür waren die tatsächlichen Verhältnisse zu offensichtlich. Es stellt sich also die Frage, warum der Kaiser seinen Feldherren abberief, bevor jener die Rückeroberung des rechtsrheinischen Gebietes abgeschlossen hatte? Die Paradoxie des Triumphs konnte schließlich nicht lange verborgen bleiben. Was waren also die Gründe für den Abbruch des Germanienkrieges?
Zwei Themenkomplexe sollen dabei im Zentrum meiner Betrachtung stehen: Zum einen wird nach den persönlichen Differenzen zwischen Tiberius und Germanicus zu fragen sein, die uns vor allem in der Darstellung des Tacitus als ausschlaggebendes Kriterium für den Abbruch der Feldzüge begegnen. In einem zweiten Schritt gilt es dann aufzuzeigen, welche etwaigen sachlichen und strategischen Überlegungen Grund für eine Abberufung gewesen sein können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Quellen
- Strabon, Velleius Paterculus und Sueton
- Cassius Dio
- Tacitus
- Kritische Bewertung der Darstellung des Tacitus
- Der Brief des Tiberius
- Die Erfüllung des Racheanspruchs
- Die Kriegsführung des Tiberius und Germanicus im Vergleich
- Die Feldzüge des Tiberius
- Die Feldzüge des Germanicus unter dem Aspekt des consiliums
- Verzicht auf Germanien?
- Das Vermächtnis des Augustus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Hintergründe der Abberufung des Germanicus von seinen Feldzügen in Germanien im Jahre 16 n. Chr. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Frage, ob der Triumph des Germanicus über die germanischen Stämme im Jahre 17 n. Chr. ein Ausdruck tatsächlichen Sieges war oder lediglich eine politische Fiktion, um die Niederlage von Varus im Jahre 9 n. Chr. zu vergessen. Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Perspektiven der römischen Geschichtsschreiber auf die Ereignisse und versucht, die historischen Fakten von der römischen Propaganda zu trennen.
- Die Rolle der römischen Propaganda in der Darstellung der Germanicus-Feldzüge
- Die Bedeutung des Triumphs des Germanicus im Kontext der römischen Politik
- Der Einfluss der persönlichen Differenzen zwischen Tiberius und Germanicus auf die Kriegsführung
- Die strategischen Gründe für den Abbruch der Feldzüge in Germanien
- Die Kontroversen um die tatsächlichen Erfolge der römischen Feldzüge
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel stellt die Ausgangssituation der Germanicus-Feldzüge dar und beleuchtet die Bedeutung des Triumphs des Germanicus im Jahre 17 n. Chr. als Symbol der römischen Macht. Es wird auch die Frage nach den wahren Hintergründen der Abberufung des Germanicus angesprochen.
- Die Quellen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Quellenlage zur Thematik der Germanicus-Feldzüge. Es analysiert die wichtigsten Quellen, wie die Werke von Tacitus, Strabon, Velleius Paterculus, Sueton und Cassius Dio, und beleuchtet deren unterschiedliche Perspektiven auf die Ereignisse.
- Kritische Bewertung der Darstellung des Tacitus: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung der Germanicus-Feldzüge durch Tacitus in seinen Annalen. Dabei werden die Schwerpunkte seiner Darstellung und die Gründe für seine Interpretation der Ereignisse untersucht.
- Der Brief des Tiberius: Das Kapitel beschäftigt sich mit einem Brief des Tiberius, in dem er die Abberufung des Germanicus begründet. Es werden die Inhalte des Briefes analysiert und deren Bedeutung im Kontext der politischen Situation der Zeit bewertet.
- Die Kriegsführung des Tiberius und Germanicus im Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht die Kriegsführung des Tiberius und des Germanicus in Germanien. Es werden die Strategien und die Erfolge der beiden Feldherren analysiert.
- Das Vermächtnis des Augustus: Das Kapitel betrachtet die Germanicus-Feldzüge im Kontext der römischen Expansionspolitik unter Augustus. Es beleuchtet die Herausforderungen der römischen Herrschaft in Germanien und die Bedeutung der Varus-Niederlage für die römische Strategie.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen dieser Arbeit sind: Germanicus, Tiberius, Feldzüge, Triumph, Germanien, Varus-Niederlage, römische Propaganda, Militärgeschichte, römische Expansionspolitik, römische Geschichtsschreibung. Diese Begriffe sind zentral für das Verständnis der komplexen historischen und politischen Zusammenhänge, die im Mittelpunkt der Arbeit stehen.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde Germanicus im Jahr 16 n. Chr. abberufen?
Die Arbeit untersucht, ob persönliche Differenzen mit Kaiser Tiberius oder strategische Überlegungen zum Rückzug auf die Rheingrenze ausschlaggebend waren.
War der Triumph des Germanicus im Jahr 17 n. Chr. gerechtfertigt?
Obwohl als Sieg über die Germanen gefeiert, war die Region bis zur Elbe nicht dauerhaft unterworfen; der Triumph diente daher teils als politische Fiktion.
Welche Rolle spielt Tacitus als Quelle für diese Ereignisse?
Tacitus stellt die Abberufung oft als Ergebnis von Tiberius' Neid dar, was in der Arbeit kritisch hinterfragt und mit anderen Quellen verglichen wird.
Wie unterschied sich die Strategie von Tiberius und Germanicus?
Während Germanicus auf offensive Feldzüge setzte, verfolgte Tiberius eine vorsichtigere, eher auf Diplomatie und Grenzsicherung basierende Politik.
Was war die Bedeutung der Varus-Niederlage für diese Feldzüge?
Die Schmach von 9 n. Chr. verlangte nach Rache und prägte die Ziele der römischen Operationen im rechtsrheinischen Germanien entscheidend.
- Quote paper
- Sonja Nadolny (Author), 2007, Die Abberufung des Germanicus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176537