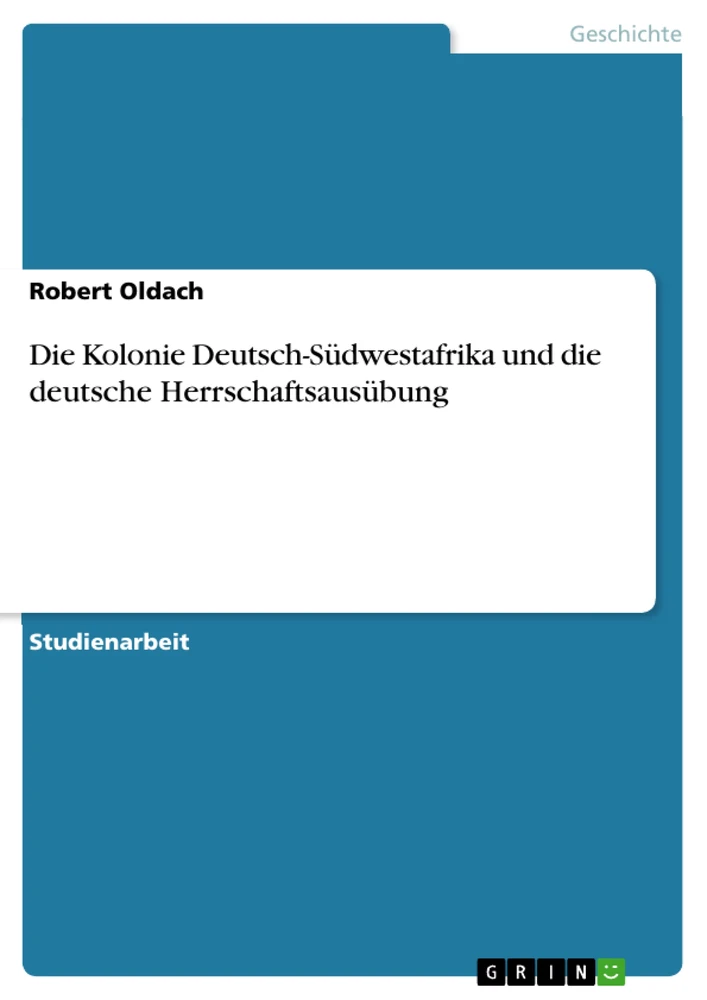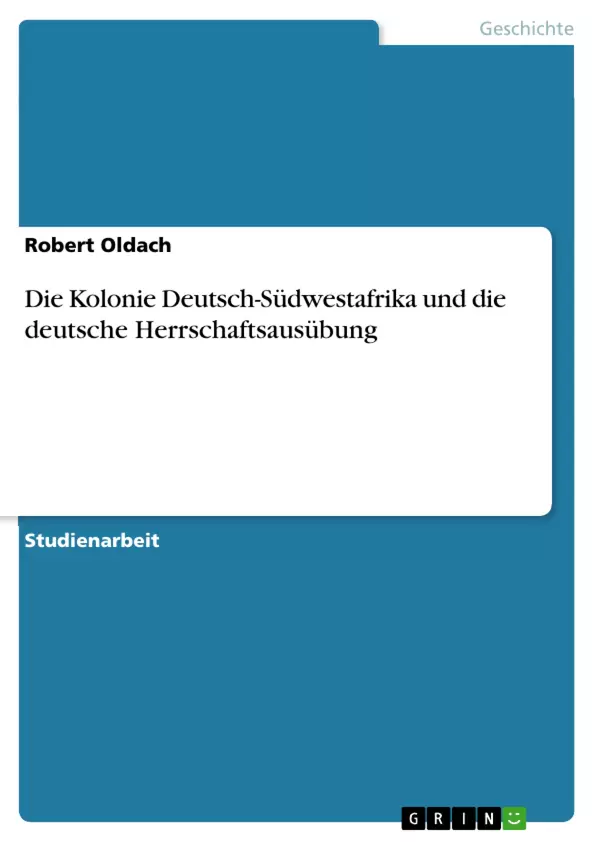Die Arbeit unternimmt zunächst den Versuch, die Motive für den Erwerb von Kolonien durch das Deutsche Kaiserreich zu analysieren. Der Fokus liegt sodann auf die Kolonie Deutsch-Südwestafrika und die deutsche Herrschaftsausübung durch das sog. "System Leutwein". Die Ursachen für den herero-Aufstand werden analysiert und die Niederschlagung als entscheidener Wendepunkt der Kolonialgeschichte Deutsch-Südwestafrikas. Daraufhin erfolgt die Skizzierung der letzten Jahre deutscher Herrschaft anhand einer forcierten wirtschaftlichen und personellen Erschließung. Abschließend wird der Verlust der Kolonie im Ersten Weltkrieg und die Instrumentalisierung des kolonialen Gedankens im Dritten Reich analysiert. Auf diese Weise entwirft die Arbeit einen kurzen und eindringlichen Überblick über die Geschichte Deutsch-Südwestafrikas sowie des deutschen Kolonialismus.
Inhaltsverzeichnis
- Vorrede
- Deutsch-Südwestafrika
- Bismarck und die koloniale Idee im Deutschen Reich
- Der Griff nach Afrika
- Zwischen Flaggenhissung und Hereroaufstand (1884-1904)
- Der Hereroaufstand
- Deutsch-Südwestafrika nach 1907
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die deutsche Kolonialgeschichte in Deutsch-Südwestafrika, insbesondere das Zusammenleben von Ureinwohnern und Kolonialmacht. Der Fokus liegt auf dem Hereroaufstand, seinen Ursachen, Verlauf und Auswirkungen. Ziel ist es, die Rolle der deutschen Kolonialpolitik und den Zeitgeist zu analysieren und deren Einfluss auf den Konflikt zu beleuchten.
- Zusammenleben von Ureinwohnern und Kolonialmacht
- Ursachen und Verlauf des Hereroaufstands
- Auswirkungen des Hereroaufstands auf die deutsche Präsenz in Deutsch-Südwestafrika
- Analyse der deutschen Kolonialpolitik
- Bewertung der Rolle des Zeitgeists
Zusammenfassung der Kapitel
Vorrede: Die Vorrede erläutert die Wahl des Themas Deutsch-Südwestafrika für die Hausarbeit und hebt die Bedeutung der deutschen Kolonialgeschichte hervor, die oft im Schatten der Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich steht. Sie begründet die Fokussierung auf das Zusammenleben von Ureinwohnern und Kolonialmacht, den Hereroaufstand und dessen Ursachen, sowie die Analyse der deutschen Kolonialpolitik und deren Auswirkungen. Die begrenzte Quellenlage, insbesondere für die Sichtweise der Herero, wird angesprochen, ebenso die Verwendung der Begriffe "Schutzgebiet" und "Kolonie".
Deutsch-Südwestafrika: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die deutsche Kolonialherrschaft in Südwestafrika. Es beleuchtet die Rolle Bismarcks und die koloniale Idee im Deutschen Reich, den Prozess der deutschen Aneignung Afrikanischer Gebiete, sowie die Ereignisse zwischen der Flaggenhissung und dem Hereroaufstand. Es analysiert die Ursachen des Hereroaufstands und seine langfristigen Konsequenzen für die Beziehung zwischen den deutschen Kolonisten und der indigenen Bevölkerung. Die Entwicklungen nach 1907 werden ebenfalls skizziert.
Schlüsselwörter
Deutsch-Südwestafrika, Hereroaufstand, Kolonialismus, Deutsches Kaiserreich, Kolonialpolitik, Ureinwohner, Bismarck, Imperialismus, Siedlungskolonie, Schutzgebiet.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu "Deutsch-Südwestafrika: Kolonialgeschichte und Hereroaufstand"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der deutschen Kolonialgeschichte in Deutsch-Südwestafrika. Der Schwerpunkt liegt auf dem Hereroaufstand, seinen Ursachen, seinem Verlauf und seinen langfristigen Folgen. Die Arbeit analysiert die deutsche Kolonialpolitik, den Zeitgeist und deren Einfluss auf das Zusammenleben von Kolonialmacht und Ureinwohnern.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: das Zusammenleben von Ureinwohnern und Kolonialmacht, die Ursachen und den Verlauf des Hereroaufstands, die Auswirkungen des Aufstands auf die deutsche Präsenz in Deutsch-Südwestafrika, die Analyse der deutschen Kolonialpolitik und die Bewertung der Rolle des Zeitgeists. Es wird auch die Rolle Bismarcks und die koloniale Idee im Deutschen Reich beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Vorrede, ein Kapitel über Deutsch-Südwestafrika (unterteilt in Unterkapitel zu Bismarck und der kolonialen Idee, dem Griff nach Afrika, den Ereignissen zwischen Flaggenhissung und Hereroaufstand, dem Hereroaufstand selbst und der Entwicklung nach 1907) und ein Resümee.
Was wird in der Vorrede erläutert?
Die Vorrede begründet die Themenwahl, hebt die Bedeutung der deutschen Kolonialgeschichte hervor, erläutert die Fokussierung auf das Zusammenleben von Ureinwohnern und Kolonialmacht und den Hereroaufstand, spricht die begrenzte Quellenlage an und diskutiert die Verwendung der Begriffe "Schutzgebiet" und "Kolonie".
Was wird im Kapitel "Deutsch-Südwestafrika" behandelt?
Das Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die deutsche Kolonialherrschaft in Südwestafrika. Es untersucht die Rolle Bismarcks, den Prozess der deutschen Aneignung afrikanischer Gebiete, die Ereignisse vor und während des Hereroaufstands und dessen langfristige Konsequenzen. Die Entwicklungen nach 1907 werden ebenfalls skizziert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Deutsch-Südwestafrika, Hereroaufstand, Kolonialismus, Deutsches Kaiserreich, Kolonialpolitik, Ureinwohner, Bismarck, Imperialismus, Siedlungskolonie, Schutzgebiet.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Rolle der deutschen Kolonialpolitik und den Zeitgeist zu analysieren und deren Einfluss auf den Hereroaufstand und das Zusammenleben von Kolonialmacht und Ureinwohnern zu beleuchten.
- Quote paper
- Magister artium Robert Oldach (Author), 2003, Die Kolonie Deutsch-Südwestafrika und die deutsche Herrschaftsausübung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176541