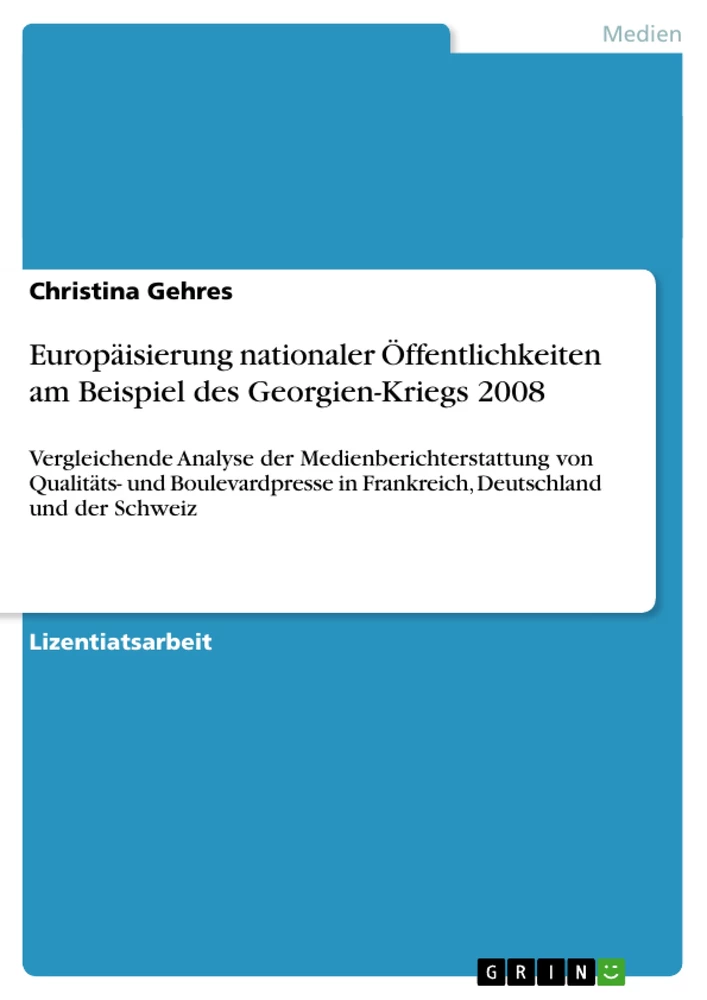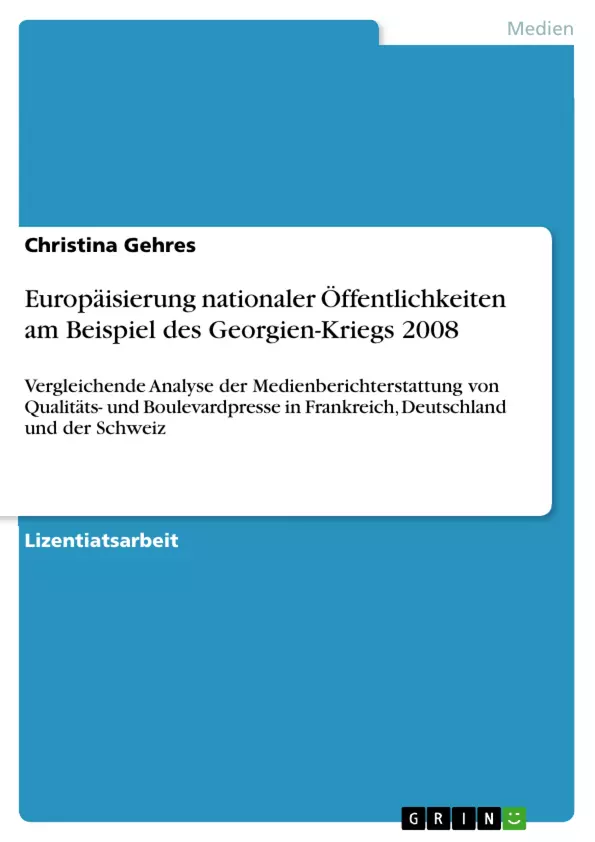Auszug aus der Einleitung der Arbeit
„Wer in europäischen Dingen nicht
an Wunder glaubt, ist kein Realist.“
(W. Hallstein, 1964)
1. Einleitung: Zur Bedeutung europäischer Öffentlichkeit
1.1 Das Öffentlichkeits- und das Demokratiedefizit in der Europäischen
Union
Das Jahr 2008 kann in einer pessimistischen Sichtweise als ein ‚Jahr der Krise’ für die
Europäische Union bilanziert werden. Zu nennen wären das gescheiterte Referendum
der Iren über die Ratifizierung des Vertrags von Lissabon im Juni, der unerwartete
Ausbruch des Georgien-Kriegs im August und die Entwicklung der globalen Finanzund
Wirtschaftskrise, der die Mitgliedsstaaten zunächst mit nationalem Protektionismus
begegneten. Optimistisch gewendet könnten die gleichen Ereignisse, die in die Chronik
der europäischen Geschichte eingehen, auch als Herausforderungen für die Europäische
Union (EU) bezeichnet werden, als fordernde Aufgaben, die auf die wachsende
Bedeutung der EU hinweisen (vgl. Simon 2008).
Anfang Juni 2009 stehen in den 27 Mitgliedsstaaten die Wahlen zum Europäischen
Parlament (EP), das 1980 erstmals frei gewählt wurde, an. Viele EU-Bürgerinnen
wissen nicht einmal, dass sie das EP überhaupt wählen können. In einer Umfrage der
Europäischen Kommission vom Herbst 2007 war dies nur 48% der Befragten bekannt
(vgl. European Commission 2008a: 10 zit. nach Brüggemann 2009: 1). Hieraus kann
also bereits auf bestehende Schwierigkeiten in der kommunikativen Vermittlung
zwischen der Ebene der EU-Institutionen und den Bürgern Europas geschlossen werden.
In der Entwicklung der europäischen Integration, ausgehend von der beginnenden
Formierung des wirtschaftlichen und politischen Europas, nach dem Zweiten Weltkrieg
aus Friedensmotiven heraus durch die Hauptprotagonisten Frankreich und Deutschland
und der primären Ausrichtung an wirtschaftlicher Effizienz und Wohlstand, kann
aufgezeigt werden, dass inzwischen eine Europäisierung nicht nur in der Ökonomie,
sondern auch in Politik und Recht mit entsprechenden vertraglichen Absicherungen
stattgefunden hat, während parallel dazu die Entwicklung einer europäischen
Öffentlichkeit gerade nicht vollzogen wurde (vgl. Gerhards 2000). Bezüglich der
europäischen Integration enthielt der EWG-Vertrag von Beginn an eine Klausel zur
Ausdehnung der Kompetenzen der Gemeinschaft (vgl. Gostmann 2009: 10).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Zur Bedeutung europäischer Öffentlichkeit
- Das Öffentlichkeits- und das Demokratiedefizit in der Europäischen Union
- Europäische Öffentlichkeit am Beispiel des Georgien-Kriegs 2008: Krieg als Kommunikationsereignis
- Fragestellungen und Aufbau der Arbeit
- Forschungsfragen
- Exkurs: Strukturwandel der Öffentlichkeit
- Forschungsstand zu europäischer Öffentlichkeit
- Ambivalente Befunde
- Die EU und ihre politischen Institutionen
- Transnationale Medien und transnationale Medienunternehmen
- Europäische Öffentlichkeit am Beispiel von Kriegen
- Zwischenfazit
- Theorie
- Öffentlichkeitsbegriff und Nicht-Existenz einer Theorie „europäischer Öffentlichkeit“
- Gegenüberstellung von Jürgen Gerhards und Klaus Eder: „impossibility school“ versus „automatism school“
- Europäische Öffentlichkeit bei Jürgen Gerhards
- Europäische Öffentlichkeit bei Klaus Eder
- Kritik an den Konzeptionen Gerhards' und Eders
- Zusammenführung in einem integrativen Modell bei Hartmut Wessler
- Arenamodell von Öffentlichkeit
- Darlegungen zur EU-Berichterstattung
- Georgien-Krieg 2008: Chronologie des Krieges
- Methode: Inhaltsanalyse
- Inhaltsanalyse der Medienberichterstattung
- Definition von Auswahl- und Analyseeinheiten
- Untersuchungszeitraum und Zeitungsartikel
- Operationalisierung und Codebuch
- Inhaltsanalyse von EU-Dokumenten
- Befunde im synchronen Vergleich
- Qualitätszeitungen
- Medienarena NZZ
- Medienarena FAZ
- Medienarena Le Monde
- Boulevardzeitungen
- Medienarena Der Blick
- Medienarena BILD-Zeitung
- Medienarena Le Parisien
- Quantitative Befunde und diachroner Vergleich
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Europäisierung nationaler Öffentlichkeiten am Beispiel des Georgien-Kriegs 2008. Durch eine vergleichende Analyse der Medienberichterstattung von Qualitäts- und Boulevardpresse in Frankreich, Deutschland und der Schweiz werden die unterschiedlichen Perspektiven und Narrative auf den Konflikt beleuchtet. Die Analyse zielt darauf ab, die Rolle von Medien in der Konstruktion einer europäischen Öffentlichkeit im Kontext eines internationalen Konflikts zu untersuchen.
- Die Bedeutung der europäischen Öffentlichkeit im Kontext des Öffentlichkeits- und Demokratiedefizits in der EU
- Der Georgien-Krieg 2008 als Kommunikationsereignis und seine Auswirkungen auf die europäische Öffentlichkeit
- Die Rolle der Medien in der Konstruktion von Narrativen und Meinungsbildung
- Der Einfluss von Qualitäts- und Boulevardpresse auf die Wahrnehmung des Konflikts
- Die Relevanz des Arenamodells von Öffentlichkeit für die Analyse der Medienlandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas europäische Öffentlichkeit im Kontext der europäischen Integration dar. Sie beleuchtet das Öffentlichkeits- und Demokratiedefizit in der EU sowie die Bedeutung des Georgien-Kriegs 2008 als Kommunikationsereignis.
- Exkurs: Dieses Kapitel widmet sich dem Strukturwandel der Öffentlichkeit und den Herausforderungen, die sich durch die Digitalisierung und die Globalisierung für die öffentliche Meinungsbildung ergeben.
- Forschungsstand: Der Forschungsstand analysiert die bestehende Literatur zu europäischer Öffentlichkeit, wobei sowohl ambivalente Befunde als auch die Rolle der EU-Institutionen, transnationaler Medien und transnationale Medienunternehmen im Fokus stehen. Darüber hinaus wird der Forschungsstand zur europäischen Öffentlichkeit im Kontext von Kriegen beleuchtet.
- Theorie: Dieses Kapitel widmet sich der theoretischen Fundierung des Begriffs „europäische Öffentlichkeit“ und diskutiert verschiedene Ansätze, darunter die „impossibility school“ und die „automatism school“. Es wird auch das Arenamodell von Öffentlichkeit vorgestellt, das als theoretischer Rahmen für die Analyse der Medienlandschaft dient.
- Darlegungen zur EU-Berichterstattung: Das Kapitel behandelt die Berichterstattung über die EU in den untersuchten Medien und beleuchtet die Rolle der EU in der Wahrnehmung des Georgien-Kriegs.
- Georgien-Krieg 2008: Chronologie des Krieges: Dieses Kapitel bietet eine chronologische Darstellung des Georgien-Kriegs 2008 und zeichnet den Verlauf des Konflikts nach.
- Methode: Das Kapitel erläutert die angewandte Methode der Inhaltsanalyse, die für die Untersuchung der Medienberichterstattung zum Georgien-Krieg verwendet wurde. Die Auswahl- und Analyseeinheiten, der Untersuchungszeitraum und die Operationalisierung werden detailliert beschrieben.
- Befunde im synchronen Vergleich: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Inhaltsanalyse, die auf einem synchronen Vergleich der Medienberichterstattung von Qualitäts- und Boulevardpresse in Frankreich, Deutschland und der Schweiz basiert. Die Analyse konzentriert sich auf die verschiedenen Perspektiven und Narrative, die in den jeweiligen Medienarenen konstruiert werden.
- Quantitative Befunde und diachroner Vergleich: Das Kapitel stellt quantitative Befunde aus der Inhaltsanalyse vor und führt einen diachronen Vergleich der Medienberichterstattung über den Georgien-Krieg durch. Die Analyse fokussiert auf die Entwicklung von Narrativen und die Veränderungen in der medialen Darstellung des Konflikts im Laufe der Zeit.
Schlüsselwörter
Europäische Öffentlichkeit, Georgien-Krieg 2008, Medienberichterstattung, Qualitätspresse, Boulevardpresse, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Arenamodell, Transnationalisierung, Inhaltsanalyse, Narrativ, Wir-Bezüge, Fremd-Bezüge, Öffentlichkeit, Demokratie, Integration, Konflikt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Demokratiedefizit in der Europäischen Union?
Es beschreibt die mangelnde kommunikative Vermittlung zwischen EU-Institutionen und Bürgern sowie die geringe Beteiligung und das fehlende Wissen über Prozesse wie die Europawahl.
Wie wird der Georgien-Krieg 2008 in der Arbeit genutzt?
Der Krieg dient als Fallbeispiel für ein "Kommunikationsereignis", um zu untersuchen, ob und wie eine grenzüberschreitende europäische Öffentlichkeit in Krisenzeiten entsteht.
Was besagt das "Arenamodell" von Öffentlichkeit?
Das Arenamodell betrachtet Öffentlichkeit als einen Raum, in dem verschiedene Akteure (Medien, Politik, Bürger) um Aufmerksamkeit und Deutungshoheit konkurrieren.
Wie unterscheiden sich Qualitäts- und Boulevardzeitungen in der Berichterstattung?
Die Arbeit vergleicht Narrative in Zeitungen wie der FAZ und NZZ mit Boulevardblättern wie BILD oder Blick, um Unterschiede in der Konstruktion europäischer Wir-Bezüge aufzuzeigen.
Existiert eine einheitliche Theorie der "europäischen Öffentlichkeit"?
Nein, es gibt gegensätzliche Ansätze wie die "impossibility school" (Öffentlichkeit nur national möglich) und die "automatism school" (Öffentlichkeit entsteht durch Integration automatisch).
Welche Länder wurden in der Medienanalyse verglichen?
Die Inhaltsanalyse vergleicht die Medienberichterstattung aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz.
- Citar trabajo
- Christina Gehres (Autor), 2009, Europäisierung nationaler Öffentlichkeiten am Beispiel des Georgien-Kriegs 2008, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176669