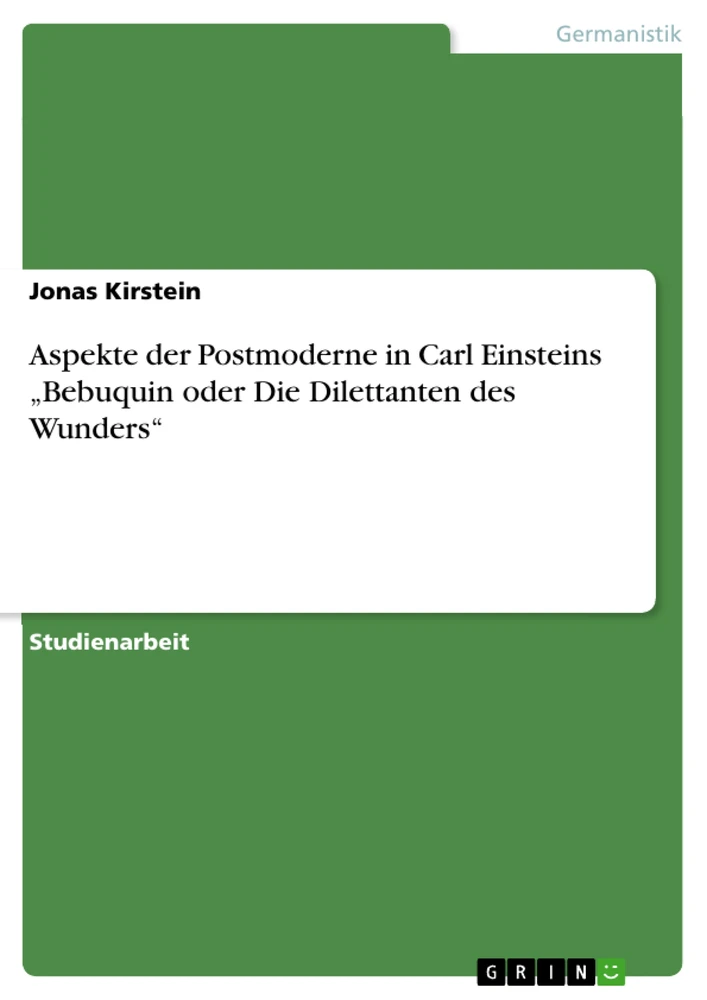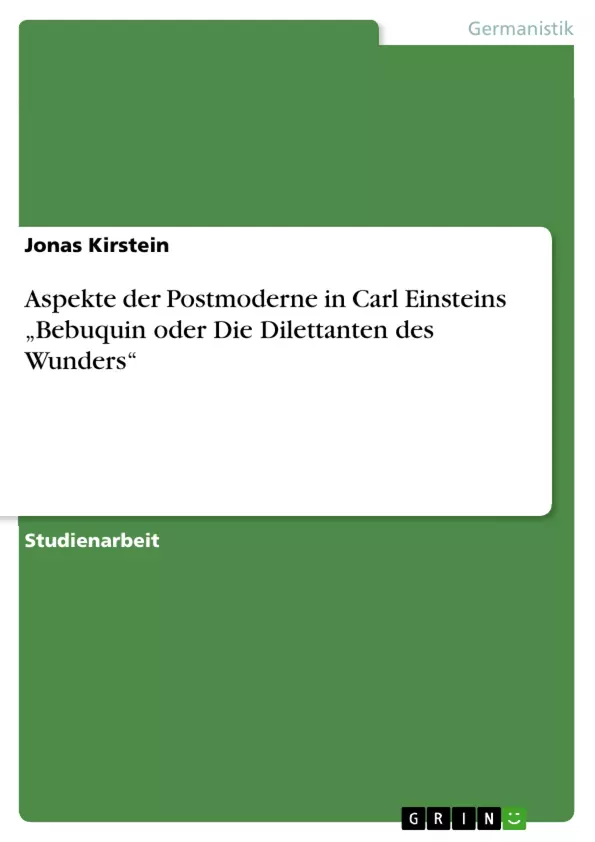Carl Einsteins „Bebuquin oder Die Dilettanten des Wunders“ enthält zahlreiche Rezeptionshinweise, logozentrische Schlussfolgerungen respektive vereinheitlichende Interpretationsansätze fallen zu lassen. Wie sich im Fortgang der Arbeit zeigen wird, werden in dem Werk traditionelle Muster, die Einheit an sich, sowie Vernunft und
Logik, generell abgelehnt. In Anbetracht dessen erweisen sich logozentrische Deutungen als einschränkende Mittel, die den erkennbar gewollt offenen Zugang zum Text verschließen. Vielmehr ist eine Kritik an eindeutigen Sinneszuweisungen ein augenscheinliches Motiv des Textes. Obendrein wird der Rezipient durch eine Fülle an Widersprüchen, auch unter Verwendung von Ironie und phantastischen Elementen, bei dem Versuch, eine einheitliche Bedeutung herauszuarbeiten, geradezu verschaukelt. Das Werk bietet somit vielmehr eine Multiperspektivität an, als bisher in der Forschung
angenommen.Die Darstellungsweise des Textes und die im Text enthaltenen
Proklamationen erinnern offenkundig an die Postmoderne-Diskussion, obgleich der Text schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts verfasst wurde.
Diese Feststellung ist zugleich die Grundlage der vorliegenden Arbeit. Es soll gezeigt werden, dass sich der erste Eindruck der Lektüre hinsichtlich der Postmoderne bestätigt. Infolgedessen setzt
sich vorliegende Arbeit zum Ziel, die postmodernen Strukturmerkmale, das postmoderne Potenzial des Textes, näher zu bestimmen. Zu diesem Zweck wird der Text unter Bezugnahme der parataktischen Liste postmoderner Literaturproduktion und –reflexion von Ihab Hassan analysiert. Zudem werden auch weitere theoretische Äußerungen der Postmoderne-Diskussion von Francoise Lyotard, Roland Barthes und
Jacques Derrida herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ihab Hassans parataktische Liste
- Intertextualität
- Hybridisierung
- Auflösung des Kanons
- Das Nicht-Zeigbare, das Nicht-Darstellbare
- Immanenz
- Selbstreflexivität
- Konstruktcharakter
- Ironie
- Offenheit
- Verlust von Ich und Tiefe
- Fragmentarisierung
- Unbestimmtheit
- Das Ende des Romans
- Performanz, Teilnahme
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Carl Einsteins Roman „Bebuquin oder Die Dilettanten des Wunders“ im Hinblick auf seine postmodernen Merkmale und zeigt auf, wie das Werk traditionelle Muster und Logik ablehnt, um eine Multiperspektivität zu schaffen. Ziel ist es, das postmoderne Potenzial des Textes aufzudecken und zu beleuchten, wie es die Postmoderne-Diskussion vorwegnimmt, obwohl es bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts geschrieben wurde.
- Die parataktische Liste von Ihab Hassan als analytisches Werkzeug
- Intertextualität und die Hybridisierung von Texten
- Auflösung des Kanons und die Ablehnung traditioneller Deutungsmodelle
- Selbstreflexivität und der Konstruktcharakter des Romans
- Offenheit und die Fragmentierung des Textes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 stellt Ihab Hassans parataktische Liste vor, die als analytisches Werkzeug für die Untersuchung des postmodernen Potenzials von „Bebuquin“ dient. Kapitel 3 widmet sich dem Aspekt der Intertextualität und untersucht die Hybridisierung von Texten, die Auflösung des Kanons, das Nicht-Zeigbare und die Immanenz. Kapitel 4 analysiert die Selbstreflexivität des Romans, insbesondere den Konstruktcharakter und die Verwendung von Ironie.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Textes sind: Postmoderne, Intertextualität, Selbstreflexivität, Offenheit, Hybridisierung, Auflösung des Kanons, Nicht-Zeigbares, Immanenz, Konstruktcharakter, Ironie, Fragmentarisierung, Multiperspektivität.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Carl Einsteins „Bebuquin“ als Vorläufer der Postmoderne betrachtet?
Obwohl Anfang des 20. Jahrhunderts verfasst, nutzt der Text Strukturen wie Multiperspektivität, Fragmentarisierung und die Ablehnung von Logik, die typisch für die Postmoderne-Diskussion sind.
Welche Rolle spielt die Intertextualität in diesem Werk?
Die Arbeit untersucht die Hybridisierung von Texten und die Auflösung des literarischen Kanons als zentrale postmoderne Merkmale in Einsteins Roman.
Was bedeutet „Selbstreflexivität“ im Kontext von „Bebuquin“?
Es bezieht sich auf den Konstruktcharakter des Romans, bei dem der Text seine eigene Entstehung und Form durch Ironie und Widersprüche thematisiert und hinterfragt.
Welche Theoretiker werden zur Analyse herangezogen?
Die Analyse stützt sich auf Ihab Hassans parataktische Liste sowie Theorien von Lyotard, Barthes und Derrida.
Wie geht der Text mit dem Leser um?
Durch eine Fülle an Widersprüchen und die Ablehnung eindeutiger Sinneszuweisungen wird der Leser aktiv herausgefordert, traditionelle Interpretationsmuster fallen zu lassen.
- Citar trabajo
- M.A. Jonas Kirstein (Autor), 2008, Aspekte der Postmoderne in Carl Einsteins „Bebuquin oder Die Dilettanten des Wunders“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176721