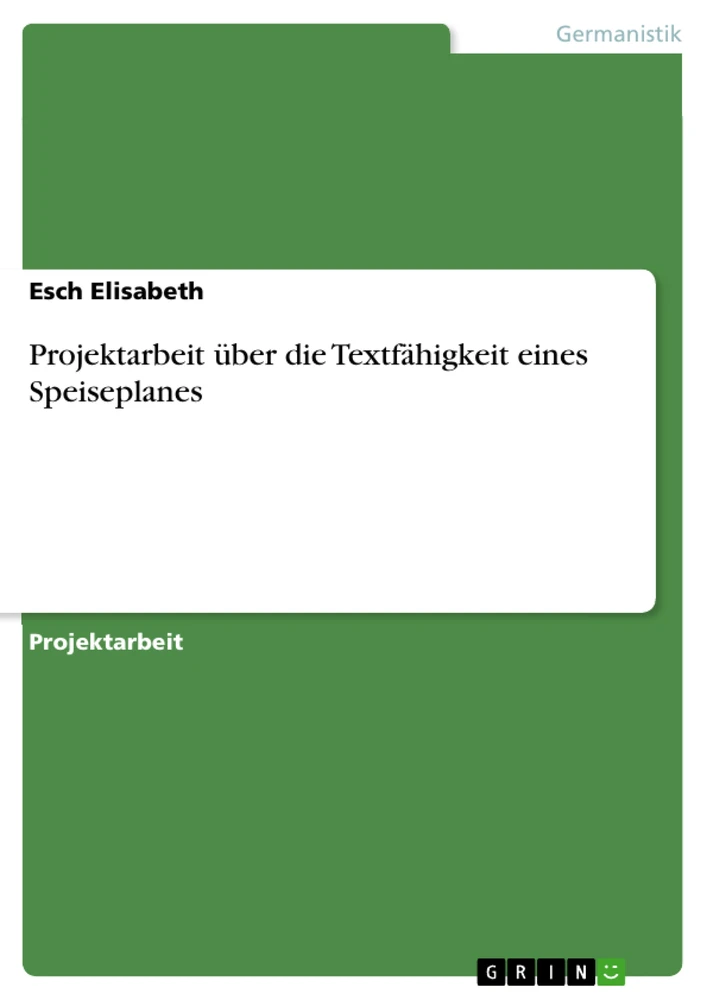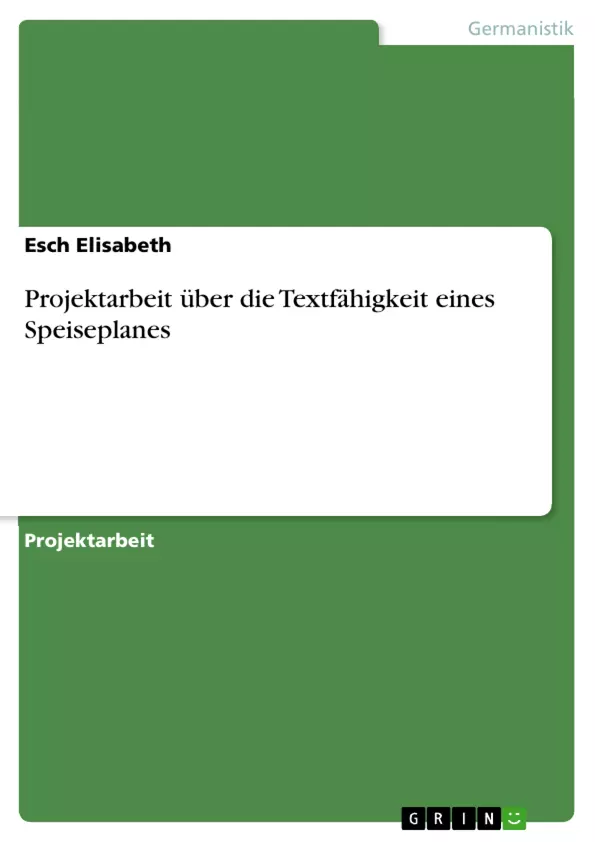Texte begegnen uns in unserem Alltag ständig, ohne dass wir sie konkret als Text wahrnehmen und uns fragen, ob sie überhaupt alle Merkmale eines Textes besitzen. Doch ab wann kann man von einem Text sprechen und wie begründet man diese Textualität?
Die Linguisten Robert-Alain de Beaugrande und Wolfgang U. Dressler haben in ihrer Theorie sieben Kriterien entwickelt, die die Textualität beschreiben. Dort heißt es, dass ein Text eine „kommunikative Okkuranz“ darstellt, also ein Vorkommnis, bei dem alle sieben Kriterien erfüllt sein müssen .
Wir fragen uns nun in dieser Projektarbeit, ob ein Mensaplan der Universität Siegen alle Textualitätskriterien nach de Beaugrande und Dressler erfüllt und somit ein Text darstellt oder ob es Einschränkungen gibt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Textualitätskriterien
- 2.1 Kohäsion
- 2.2 Kohärenz
- 2.3 Intentionalität
- 2.4 Akzeptabilität
- 2.5. Informativität
- 2.6. Situationalität
- 2.7. Intertextualität
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Projektarbeit befasst sich mit der Frage, ob ein Mensaplan der Universität Siegen alle Kriterien der Textualität nach de Beaugrande und Dressler erfüllt und somit als Text betrachtet werden kann.
- Analyse der Kohäsion im Mensaplan
- Bewertung der Kohärenz des Mensaplans
- Anwendung weiterer Textualitätskriterien auf den Mensaplan
- Bewertung der Textualität des Mensaplans anhand der Ergebnisse
- Diskussion der Ergebnisse im Kontext von Texttheorie und Alltagssprache
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Projektarbeit vor: Ist ein Mensaplan ein Text? Sie führt kurz die Textualitätstheorie von de Beaugrande und Dressler ein und erläutert das Ziel der Arbeit, die sieben Kriterien auf den Mensaplan der Universität Siegen anzuwenden.
2. Textualitätskriterien
2.1 Kohäsion
Dieser Abschnitt analysiert die Kohäsion des Mensaplans, d.h. die grammatischen Verknüpfungen innerhalb des Textes. Es werden verschiedene Aspekte wie Rekurrenz, Interpunktion, Phorik und Ellipsen im Detail untersucht.
2.2 Kohärenz
Der Abschnitt fokussiert sich auf die Kohärenz des Mensaplans, d.h. den inhaltlichen Zusammenhang. Die Analyse untersucht die Struktur des Mensaplans und die semantischen Beziehungen zwischen den einzelnen Elementen.
Schlüsselwörter
Textualität, Kohäsion, Kohärenz, de Beaugrande und Dressler, Mensaplan, Universität Siegen, Textlinguistik, Alltagssprache.
Häufig gestellte Fragen
Ist ein Mensaplan ein Text?
Die Projektarbeit untersucht genau diese Frage anhand der sieben Textualitätskriterien von Beaugrande und Dressler.
Was sind die sieben Kriterien der Textualität?
Diese sind Kohäsion, Kohärenz, Intentionalität, Akzeptabilität, Informativität, Situationalität und Intertextualität.
Wie zeigt sich Kohäsion in einem Speiseplan?
Kohäsion bezieht sich auf den grammatischen Zusammenhalt, etwa durch Interpunktion, Abkürzungen oder die Anordnung der Gerichte.
Was bedeutet Kohärenz bei einem Mensaplan?
Kohärenz meint den inhaltlichen Zusammenhang – also ob der Leser versteht, welches Gericht an welchem Tag angeboten wird und welche Beilagen dazugehören.
Warum ist Situationalität für einen Mensaplan wichtig?
Situationalität bedeutet, dass der Text in einem bestimmten Kontext (hier: Universität/Hunger) relevant sein muss, um als solcher zu funktionieren.
Erfüllt der Mensaplan der Uni Siegen alle Kriterien?
Die Arbeit analysiert kritisch, ob es Einschränkungen gibt, da ein Plan oft eher eine Liste als ein klassischer Fließtext ist.
- Citation du texte
- Esch Elisabeth (Auteur), 2009, Projektarbeit über die Textfähigkeit eines Speiseplanes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176765