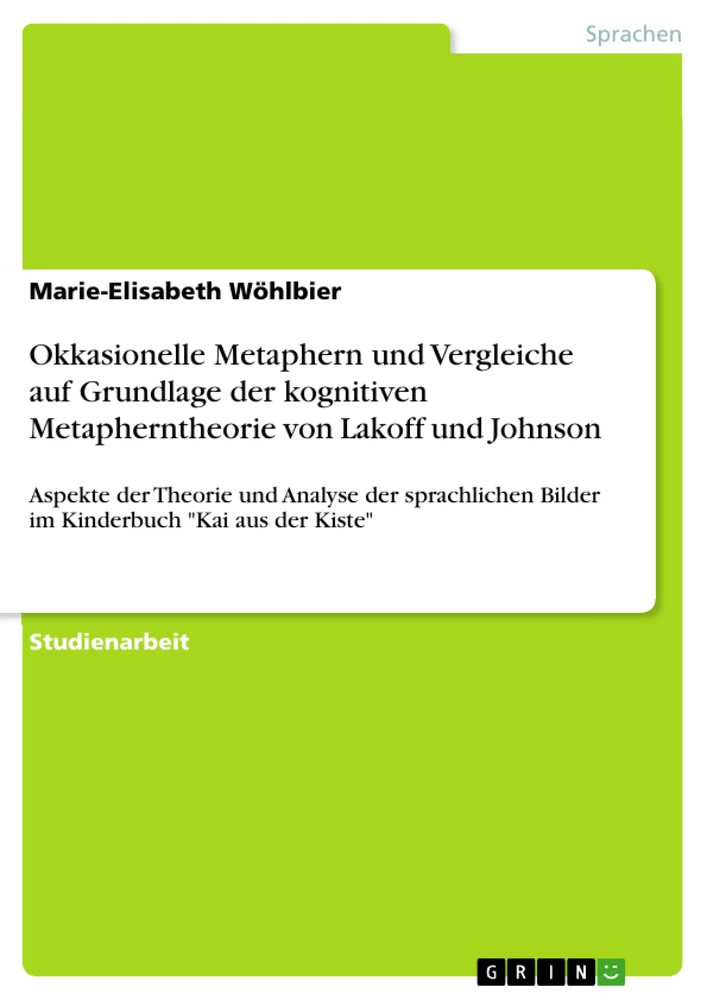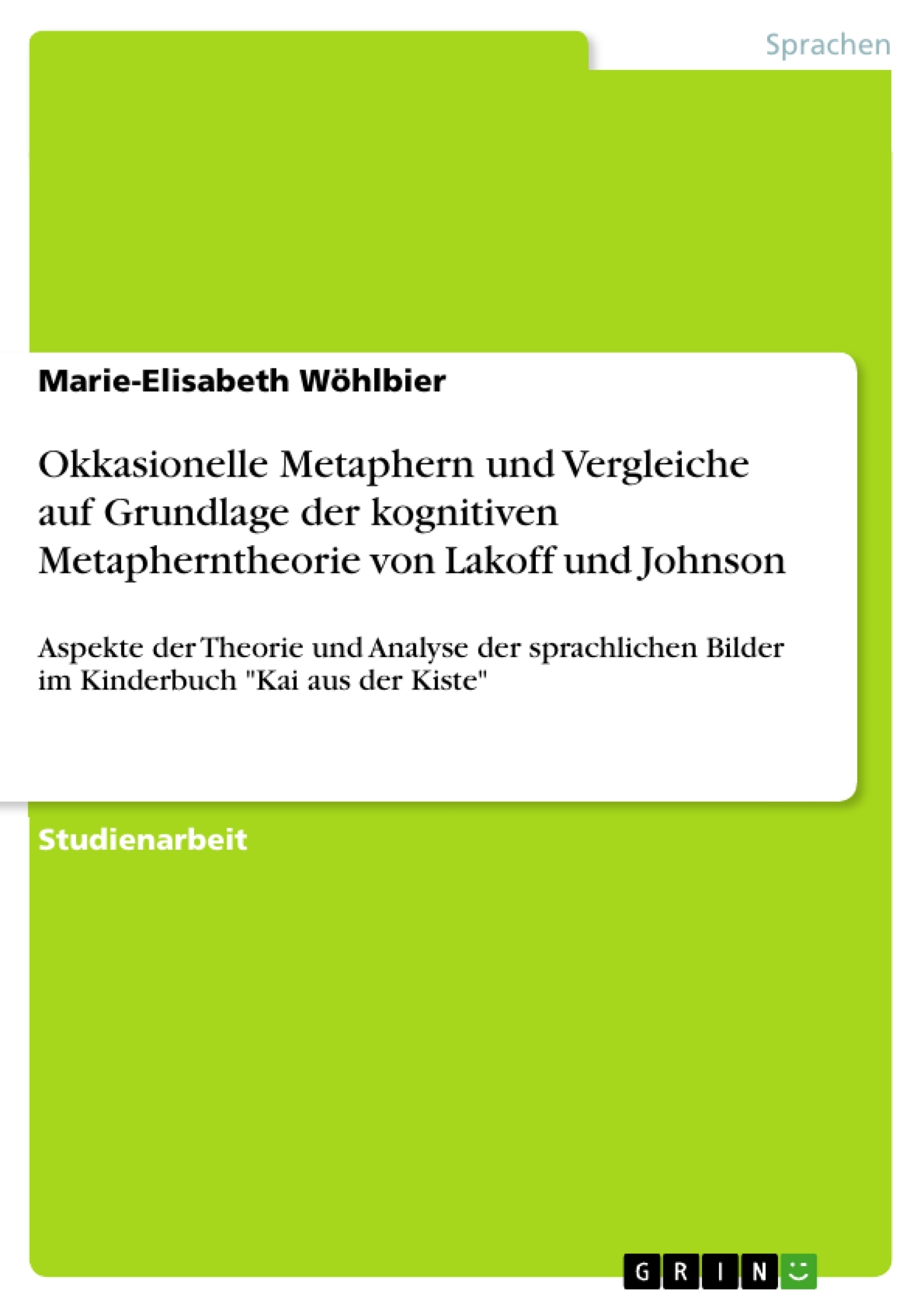Diese Arbeit beschäftigt sich mit der kognitiven Metapherntheorie, die zunächst in ihren Grundzügen vorgestellt wird. Die theoretischen Feststellungen der Theorie von Lakoff und Johnson werden dann zum Teil praktisch nachgewiesen am Text des Kinderbuches "Kai aus der Kiste". Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Untersuchung okkasioneller Metaphern und ihrer Verwendung in Kinderbuch "Kai aus der Kiste". Es erfolgt auch eine Bewertung dieser Metaphern.
Inhaltsverzeichnis
- Prolegomenon
- Sprachliche Bilder
- Der Metaphernbegriff von Aristoteles zu Lakoff und Johnson
- Konzeptuelle Metaphern als Untersuchungsgegenstand in der kognitiven Linguistik
- Kognitive Funktionen der Metapher
- Die Fokussierungs-Funktion der Metapher
- Erklärungs-und Verständnisfunktion der Metapher
- Kreatives Potential der Metapher
- Metaphern und Vergleiche
- Metaphern-Typen nach dem Grade ihrer Konventionalität
- Okkasionelle Metaphern
- Lexikalisierte Metaphern
- Zusammenfassung wesentlicher Aspekte der kognitiven Metapherntheorie nach Lakoff und Johnson
- Untersuchungsgegenstand Kinderbuch: „Kai aus der Kiste“
- Allgemeine Angaben zum Werk
- Inhaltsangabe zum Kinderbuch „Kai aus der Kiste“
- Vorstellung, Interpretation und Einschätzung der Untersuchungsergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der kognitiven Metapherntheorie von Lakoff und Johnson und analysiert anhand des Kinderbuches „Kai aus der Kiste“ die Verwendung von okkasionellen Metaphern und Vergleichen.
- Entwicklung des Metaphernbegriffs in der kognitiven Linguistik
- Kognitive Funktionen der Metapher
- Abgrenzung des Vergleichs von der Metapher
- Analyse der okkasionellen Metaphern im Kinderbuch „Kai aus der Kiste“
- Bewertung der Verwendung von Metaphern im Kontext des Kinderbuches
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine theoretische Fundierung der kognitiven Metapherntheorie und beschreibt die Entwicklung des Metaphernbegriffs von Aristoteles bis Lakoff und Johnson. Es beleuchtet die wichtigsten Aspekte der Theorie und geht auf die vielfältigen Funktionen der Metapher ein. Im zweiten Kapitel werden Vergleiche von Metaphern abgegrenzt und die verschiedenen Typen der Metapher hinsichtlich ihrer Konventionalität unterschieden.
Im dritten Kapitel wird ein Überblick über die wichtigsten Ansichten der kognitiven Metapherntheorie gegeben. Das vierte Kapitel stellt das Kinderbuch „Kai aus der Kiste“ vor und untersucht die Verwendung von okkasionellen Metaphern und Vergleichen im Werk. Die Ergebnisse werden vorgestellt, interpretiert und hinsichtlich ihrer Funktion charakterisiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich den Themen Metapher, kognitive Metapherntheorie, Lakoff und Johnson, okkasionelle Metaphern, Vergleiche, Kinderbuch, „Kai aus der Kiste“ und Sprachliche Bilder.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die kognitive Metapherntheorie von Lakoff und Johnson?
Sie besagt, dass Metaphern nicht nur schmückendes Beiwerk der Sprache sind, sondern unser gesamtes Denken und Handeln strukturieren (konzeptuelle Metaphern).
Was ist eine „okkasionelle Metapher“?
Eine okkasionelle Metapher ist eine Neuschöpfung, die für eine bestimmte Situation erfunden wurde und (noch) nicht in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist.
Wie unterscheiden sich Metaphern von Vergleichen?
Während ein Vergleich zwei Bereiche mit „wie“ oder „als ob“ nebeneinanderstellt, setzt die Metapher einen Bereich direkt mit einem anderen gleich („A ist B“).
Warum wird das Kinderbuch „Kai aus der Kiste“ untersucht?
Das Buch dient als praktisches Beispiel, um die Verwendung und Wirkung von Metaphern und Sprachbildern in der Literatur für Kinder zu analysieren.
Welche Funktionen haben Metaphern laut der Theorie?
Zu den Funktionen gehören die Fokussierung auf bestimmte Aspekte, die Erleichterung des Verständnisses komplexer Themen und die Entfaltung kreativen Potenzials.
Was sind lexikalisierte Metaphern?
Das sind Metaphern, die so fest im Sprachgebrauch verankert sind, dass sie oft nicht mehr als Bild wahrgenommen werden (z.B. „Tischbein“).
- Quote paper
- Marie-Elisabeth Wöhlbier (Author), 2011, Okkasionelle Metaphern und Vergleiche auf Grundlage der kognitiven Metapherntheorie von Lakoff und Johnson , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176936