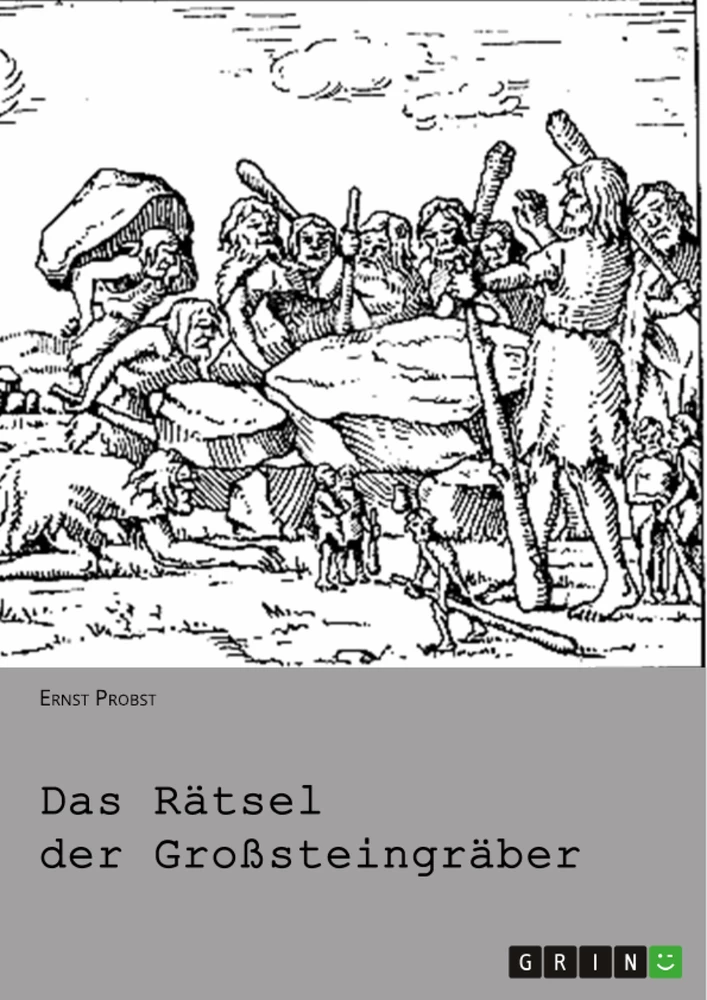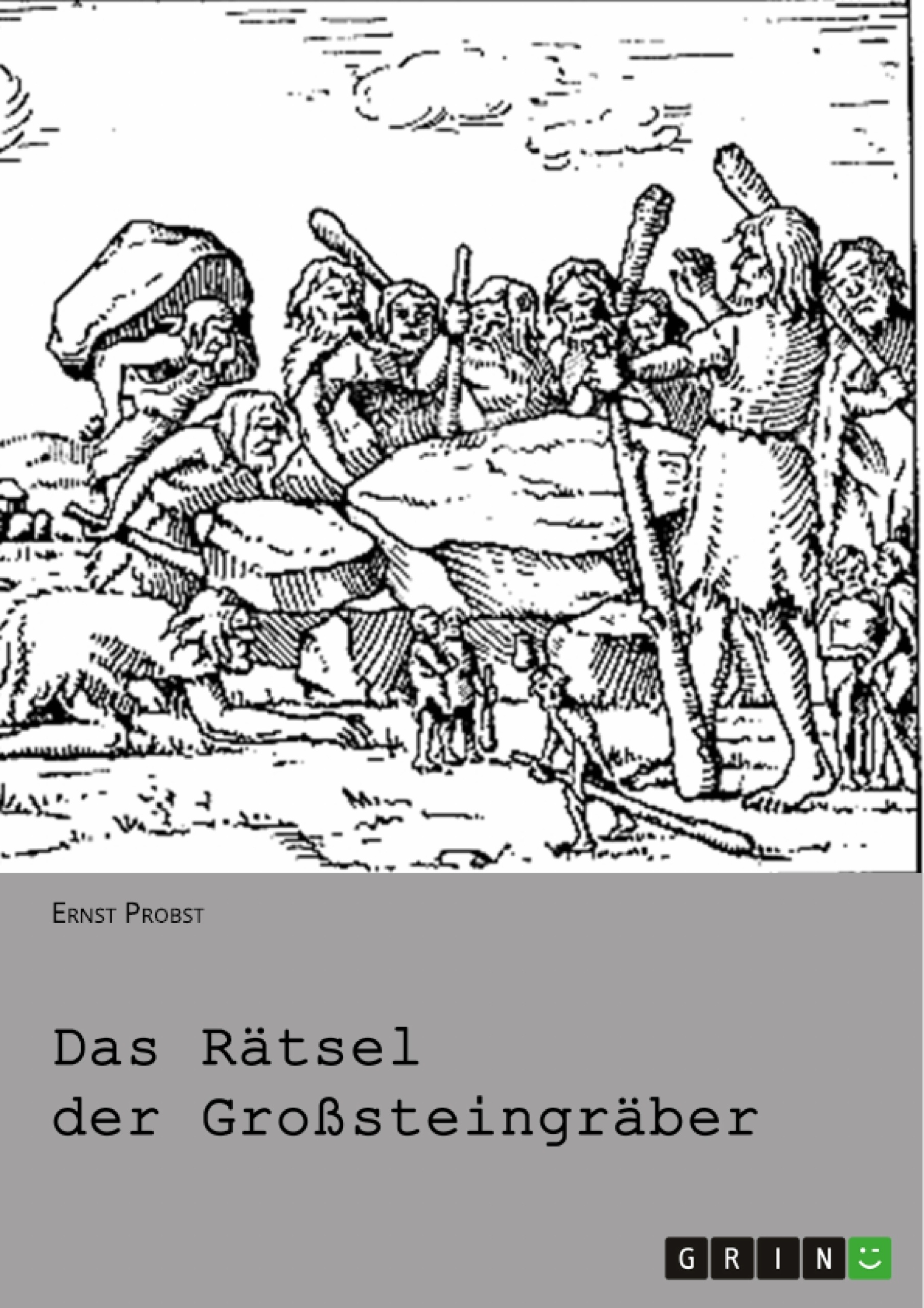Geradezu schlagartig haben in der Jungsteinzeit vor rund 5.500 Jahren die Ackerbauern und Viehzüchter in Nordwestdeutschland eine völlig neue Bestattungssitte übernommen. Sie war mit dem mühseligen Bau von monumentalen Großsteingräbern verbunden. Die mit tonnenschweren Steinblöcken errichteten riesigen Grabbauten aus jener Zeit wirken so eindrucksvoll, dass man sie früher Riesen statt Menschen zuschrieb.
Mit den tüchtigen Erbauern der Dolmen, Ganggräber und Steinkistengräber in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg befasst sich das Taschenbuch „Das Rätsel der Großsteingräber. Die nordwestdeutsche Trichterbecher-Kultur“. Es schildert ihre Anatomie, Krankheiten, Häuser, Siedlungen, Landwirtschaft, Verkehrswesen, Werkzeuge und Waffen, ihren Schmuck, ihre Kunst sowie ihre Religion.
Autor des Taschenbuches „Das Rätsel der Großsteingräber“ ist der Wiesbadener Wissenschaftsautor Ernst Probst. Er hat sich durch zahlreiche Bücher aus den Themenbereichen Archäologie und Paläontologie einen Namen gemacht. Das 136 Seiten umfassende Taschenbuch ist reich mit Zeichnungen und Fotos bebildert.
Inhaltsverzeichnis
- Die Trichterbecher-Kultur
- Die nordwestdeutsche Trichterbecher-Kultur
- Die Rosenhof-Gruppe
- Die Satrup-Gruppe
- Die Fuchsberg-Gruppe
- Die Troldebjerg-Gruppe
- Die Klintebakken-Gruppe
- Die Curslack-Gruppe
- Lebensweise der Trichterbecher-Leute
- Siedlungen
- Jagd und Fischfang
- Ackerbau und Viehzucht
- Handel und Tausch
- Kleidung und Schmuck
- Kunst und Musik
- Keramik
- Werkzeuge und Waffen
- Bestattungssitten
- Großsteingräber
- Urdolmen
- Erweiterte Dolmen
- Großdolmen
- Ganggräber
- Steinkammergräber
- Erdgräber
- Flachgräber
- Religion und Gesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der nordwestdeutschen Trichterbecher-Kultur der Jungsteinzeit. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die Lebensweise, die Bestattungssitten und die religiösen Vorstellungen dieser Kultur zu geben, basierend auf archäologischen Funden und wissenschaftlichen Interpretationen.
- Lebensweise der Trichterbecher-Leute (Siedlungen, Wirtschaft, Handel)
- Bestattungspraktiken und die verschiedenen Grabformen (Urdolmen, Ganggräber, Steinkammergräber etc.)
- Materialkultur (Keramik, Werkzeuge, Waffen, Schmuck)
- Religiöse Vorstellungen und Rituale (Großsteingräber, Schälchen, Kunst)
- Gesellschaftliche Strukturen und Hierarchien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Trichterbecher-Kultur: Dieses Kapitel führt in die Trichterbecher-Kultur ein, die sich über ein riesiges Gebiet in Mitteleuropa erstreckte und ihren Namen von der charakteristischen Form ihrer Keramikgefäße ableitet. Es wird erläutert, dass der Begriff Trichterbecherkultur eigentlich mehrere eng verwandte Kulturen umfasst und die nordwestdeutsche Trichterbecher-Kultur als einer der ältesten Zweige dieser Kulturfamilie betrachtet wird. Das Kapitel legt den zeitlichen und geographischen Rahmen fest und kündigt die weiteren Kapitel an, die sich detailliert mit den verschiedenen Aspekten der nordwestdeutschen Trichterbecherkultur befassen.
Die nordwestdeutsche Trichterbecher-Kultur: Dieses Kapitel beschreibt im Detail die nordwestdeutsche Trichterbecher-Kultur, die von ca. 4300 bis 3000 v. Chr. existierte und sich über Schleswig-Holstein, Nordniedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern erstreckte. Es wird die Gliederung der Kultur in verschiedene regionale Gruppen (Rosenhof, Satrup, Fuchsberg, Troldebjerg, Klintebakken, Curslack) anhand des Fundguts erläutert. Der Übergang zur Nutzung monumentaler Großsteingräber wird als jüngere Entwicklung innerhalb dieser Kultur beschrieben, ebenso wie die klimatischen Bedingungen des Atlantikums und des Subboreals, in denen die Kultur existierte. Die Kapitel geben Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt und die physischen Merkmale der damaligen Bevölkerung.
Lebensweise der Trichterbecher-Leute: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit der Lebensweise der Trichterbecher-Leute. Es beschreibt ihre sesshaften Siedlungen, die sich an verschiedenen Standorten wie Flussauen, Anhöhen oder in Meeresnähe befanden, manche davon sogar befestigt. Die Kapitel erläutern die Jagdpraktiken, den Fischfang und vor allem die Bedeutung des Ackerbaus und der Viehzucht für die Ernährung. Der Handel und Tausch von Rohstoffen und Gütern über größere Distanzen wird anhand von Funden aus verschiedenen Regionen belegt. Die Kapitel beschreibt Kleidung und Schmuck, die kunstvollen Keramikgefäße, die Herstellung von Werkzeugen und Waffen aus Stein, Knochen und Geweih, sowie die Verwendung von Kupfer. Die Bedeutung der Musik, anhand von Funden von Tontrommeln wird ebenfalls behandelt.
Bestattungssitten: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Bestattungssitten der Trichterbecher-Kultur. Es beschreibt die verschiedenen Arten von Gräbern, beginnend mit den einfacheren Erdgräbern und Flachgräbern, bis hin zu den monumentalen Großsteingräbern. Die Kapitel analysiert die unterschiedlichen Typen von Großsteingräbern (Urdolmen, erweiterte Dolmen, Großdolmen, Ganggräber, Steinkammergräber) hinsichtlich ihrer Bauweise, Größe und Verbreitung. Die verschiedenen Interpretationen der Funktion der Großsteingräber – als Erbbegräbnisse, Beinhäuser oder kultische Anlagen – werden diskutiert. Es werden Beispiele aus verschiedenen Regionen Deutschlands vorgestellt.
Religion und Gesellschaft: Dieses Kapitel untersucht die religiösen Vorstellungen und die gesellschaftlichen Strukturen der Trichterbecher-Kultur. Die Errichtung der aufwändigen Großsteingräber wird als Ausdruck religiöser Ideen interpretiert. Die Bedeutung von Symbolen wie Sonnenräder, Hände, Füße und Äxte, sowie die Rolle von Schälchen auf Steinen, werden diskutiert. Hinweise auf gesellschaftliche Hierarchien, einschließlich der möglichen Existenz von Häuptlingen und Priestern, werden basierend auf den archäologischen Funden und deren Interpretationen dargelegt. Die Kapitel schließt mit einer Diskussion um rituellen Kannibalismus und die ungeklärten Fragen der damaligen religiösen Praktiken ab.
Schlüsselwörter
Trichterbecher-Kultur, Nordwestdeutschland, Jungsteinzeit, Megalithgräber, Siedlungen, Ackerbau, Viehzucht, Jagd, Fischfang, Keramik, Werkzeuge, Waffen, Schmuck, Religion, Gesellschaft, Bestattungssitten, Archäologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Nordwestdeutschen Trichterbecherkultur
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die nordwestdeutsche Trichterbecherkultur der Jungsteinzeit. Sie behandelt die Lebensweise, Bestattungssitten und religiösen Vorstellungen dieser Kultur, basierend auf archäologischen Funden und wissenschaftlichen Interpretationen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Lebensweise der Trichterbecher-Leute (Siedlungen, Wirtschaft, Handel), Bestattungspraktiken und verschiedene Grabformen (Urdolmen, Ganggräber, Steinkammergräber etc.), Materialkultur (Keramik, Werkzeuge, Waffen, Schmuck), religiöse Vorstellungen und Rituale (Großsteingräber, Schälchen, Kunst), und gesellschaftliche Strukturen und Hierarchien.
Welche regionalen Gruppen der Trichterbecherkultur werden unterschieden?
Die nordwestdeutsche Trichterbecherkultur wird in verschiedene regionale Gruppen unterteilt: Rosenhof, Satrup, Fuchsberg, Troldebjerg, Klintebakken und Curslack. Diese Unterteilung basiert auf den charakteristischen Merkmalen des gefundenen Materials.
Wann und wo existierte die nordwestdeutsche Trichterbecherkultur?
Die nordwestdeutsche Trichterbecherkultur existierte von ca. 4300 bis 3000 v. Chr. in den Gebieten Schleswig-Holstein, Nordniedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.
Wie war die Lebensweise der Trichterbecher-Leute?
Die Trichterbecher-Leute lebten in sesshaften Siedlungen, betrieben Ackerbau und Viehzucht, gingen jagen und fischen und beteiligten sich an Handel und Tausch. Ihre Materialkultur umfasste kunstvolle Keramik, Werkzeuge aus Stein, Knochen und Geweih, sowie Waffen und Schmuck.
Welche Arten von Gräbern sind charakteristisch für die Trichterbecherkultur?
Die Bestattungssitten umfassen einfache Erdgräber und Flachgräber, aber vor allem die monumentalen Großsteingräber. Diese werden in verschiedene Typen unterteilt: Urdolmen, erweiterte Dolmen, Großdolmen, Ganggräber und Steinkammergräber.
Welche religiösen Vorstellungen werden in der Arbeit diskutiert?
Die Errichtung der aufwändigen Großsteingräber wird als Ausdruck religiöser Ideen interpretiert. Die Bedeutung von Symbolen wie Sonnenräder, Hände, Füße und Äxte, sowie die Rolle von Schälchen auf Steinen, werden diskutiert. Die Arbeit beleuchtet auch die möglichen Hinweise auf rituellen Kannibalismus.
Welche gesellschaftlichen Strukturen werden angenommen?
Die Arbeit untersucht Hinweise auf mögliche gesellschaftliche Hierarchien, einschließlich der Existenz von Häuptlingen und Priestern, basierend auf archäologischen Funden und deren Interpretationen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Trichterbecher-Kultur, Nordwestdeutschland, Jungsteinzeit, Megalithgräber, Siedlungen, Ackerbau, Viehzucht, Jagd, Fischfang, Keramik, Werkzeuge, Waffen, Schmuck, Religion, Gesellschaft, Bestattungssitten, Archäologie.
Wo finde ich weitere Informationen?
Diese FAQ bietet einen Überblick. Für detailliertere Informationen verweisen wir auf die Vollversion der Arbeit.
- Quote paper
- Ernst Probst (Author), 2011, Das Rätsel der Großsteingräber, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177043