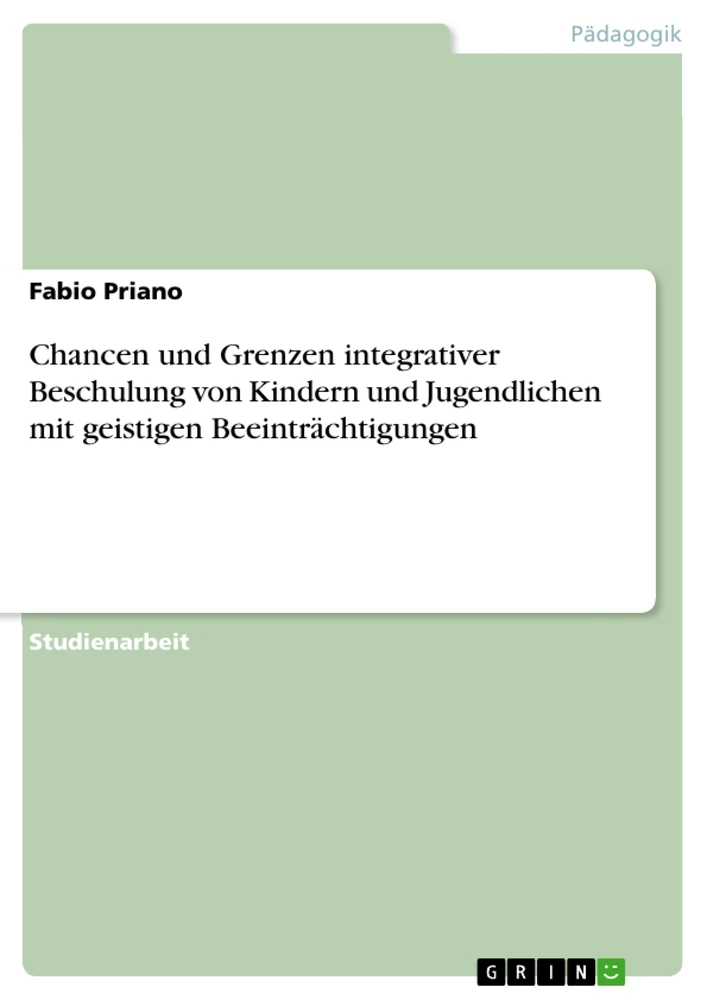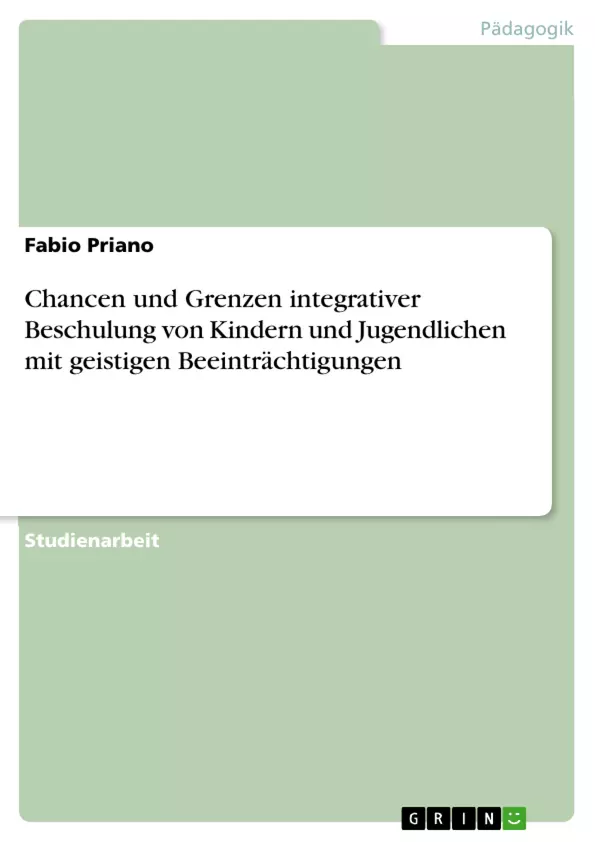„Egal wie ein Kind beschaffen ist, es hat das Recht, alles Wichtige über diese Welt zu erfahren, weil es in dieser Welt lebt.“ (Feuser, 1995, S. 220). Die Integration be-hinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschulen wird zunehmend präsenter. Spätestens seit den internationalen Vergleichsstudien PISA und TIMMS sind auch die Auswirkungen und Konsequenzen der Integrationsbemühungen deutlich.
In der Hausarbeit werden Chancen und Grenzen der Integration geistig behinderter Kinder thematisiert und diskutiert. Dabei stehen vor allem die Schüler-Schüler-Interaktionen, die Schüler-Lehrer-Interaktionen / Lehrer-Schüler-Interaktionen und die Lehrer-Lehrer/Pädagogen-Interaktionen im Themenfokus. In diesem Bezug sollen neben den positiven Eindrücken, auch mögliche kritische und problematische Aspekte der pädagogischen Arbeit betrachtet werden. Zudem gilt es auch, Rahmen-bedingungen zu hinterfragen, die eine pädagogische Arbeit überhaupt ermöglichen und gewährleisten.
Neben dem Schwerpunktthema werden die Begriffe Heterogenität und Integrations-pädagogik thematisiert. Zudem wird der Begriff bzw. das Konstrukt „geistige Behin-derung“ definiert und in den Bezug der Schulintegration gesetzt. Ein Fazit mit per-sönlicher Einschätzung und Stellungnahme schließt die Hausarbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Definition „Geistige Behinderung“
- 2. Heterogenität
- 3. Integrationspädagogik
- 4. Chancen und Grenzen integrativer Beschulung geistig behinderter SuS
- 4.1 Schüler-Schüler-Interaktionen
- 4.2 Schüler-Lehrer-Interaktion / Lehrer-Schüler-Interaktion
- 4.3 Lehrer-Lehrer/Pädagogen-Interaktion
- 4.4 Exklusive Bedingungen
- 5. Fazit
- 6. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit den Chancen und Grenzen der Integration geistig behinderter Kinder in die Regelschule. Dabei werden die unterschiedlichen Interaktionen zwischen Schülern, Lehrern und Pädagogen im Kontext der Integration beleuchtet. Neben den positiven Aspekten werden auch kritische und problematische Aspekte der pädagogischen Arbeit berücksichtigt. Darüber hinaus werden Rahmenbedingungen untersucht, die eine erfolgreiche Integration gewährleisten.
- Definition des Begriffs "geistige Behinderung"
- Die Bedeutung von Heterogenität im integrativen Schulsetting
- Chancen und Herausforderungen der Integrationspädagogik
- Analyse von Schüler-Schüler-, Schüler-Lehrer- und Lehrer-Lehrer-Interaktionen
- Exklusive Bedingungen, die die Integration von Kindern mit geistigen Beeinträchtigungen beeinflussen können
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Integration geistig behinderter Kinder in die Regelschule ein und stellt den aktuellen Stand der Diskussion dar. Sie setzt sich mit der Definition des Begriffs „geistige Behinderung“ auseinander und beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema. Das Kapitel "Heterogenität" betrachtet die vielfältigen Unterschiede in heterogenen Lerngruppen, die durch kulturelle, nationale und soziale Faktoren sowie unterschiedliche Lernvoraussetzungen entstehen.
Das Kapitel "Integrationspädagogik" beleuchtet die pädagogischen Ansätze und Konzepte, die im Kontext der Integration von Kindern mit Behinderungen relevant sind. Es werden die Ziele und Herausforderungen der Integrationspädagogik im Hinblick auf die Förderung aller Schüler und deren Teilhabe am gemeinsamen Lernen diskutiert.
Das Kapitel "Chancen und Grenzen integrativer Beschulung geistig behinderter SuS" widmet sich den Interaktionen, die sich im integrativen Schulalltag abspielen. Hierbei werden die Schüler-Schüler-, Schüler-Lehrer- und Lehrer-Lehrer-Interaktionen im Detail betrachtet. Die Chancen und Grenzen der Integration werden anhand von konkreten Beispielen aus der Praxis erörtert.
Schlüsselwörter
Integration, geistig Behinderung, Heterogenität, Integrationspädagogik, Interaktion, Schüler-Schüler-Interaktion, Schüler-Lehrer-Interaktion, Lehrer-Lehrer-Interaktion, Inklusion, Exklusion.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet integrative Beschulung bei geistiger Behinderung?
Es ist der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und ohne geistige Beeinträchtigungen in einer Regelschule, anstatt in einer Sonderschule.
Welche Chancen bietet die Integration für Schüler?
Sie fördert soziale Kompetenzen, den Abbau von Vorurteilen und ermöglicht behinderten Kindern eine bessere Teilhabe an der Gesellschaft.
Wo liegen die Grenzen der schulischen Integration?
Grenzen ergeben sich oft durch mangelnde personelle Ressourcen, unzureichende räumliche Ausstattung oder eine zu starke Fixierung auf Leistungsnormen.
Was ist Heterogenität im Klassenzimmer?
Es beschreibt die Vielfalt der Schüler hinsichtlich ihrer Lernvoraussetzungen, sozialen Herkunft und körperlichen/geistigen Fähigkeiten.
Wie wichtig ist die Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Pädagogen?
Eine erfolgreiche Integration erfordert multiprofessionelle Teams, in denen Regelschullehrer und Sonderpädagogen eng kooperieren.
- Quote paper
- Fabio Priano (Author), 2010, Chancen und Grenzen integrativer Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit geistigen Beeinträchtigungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177067