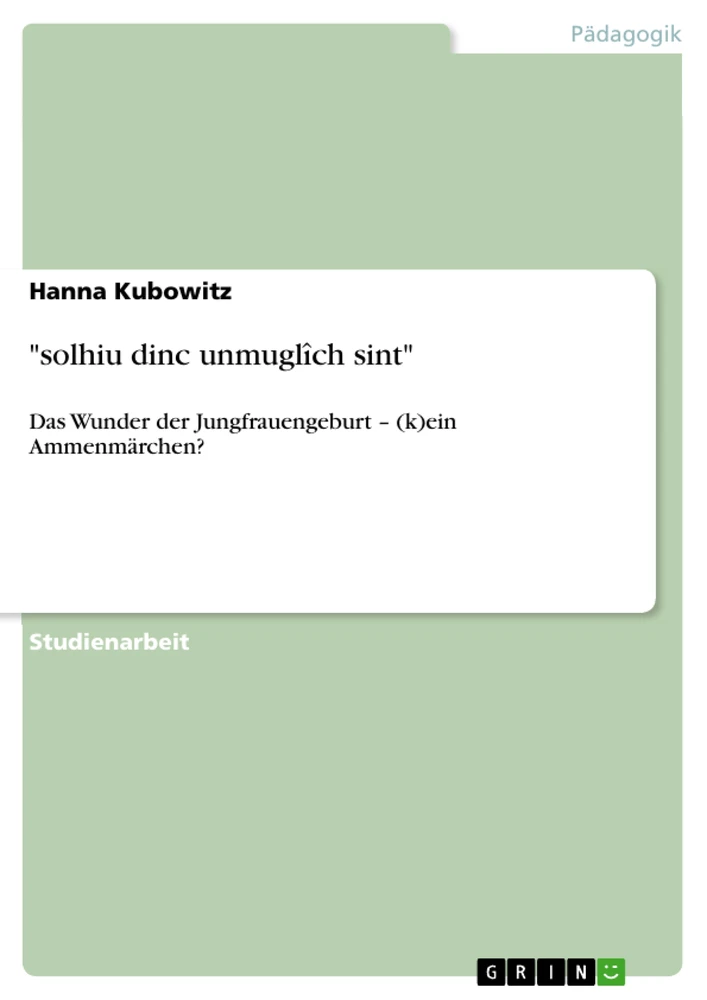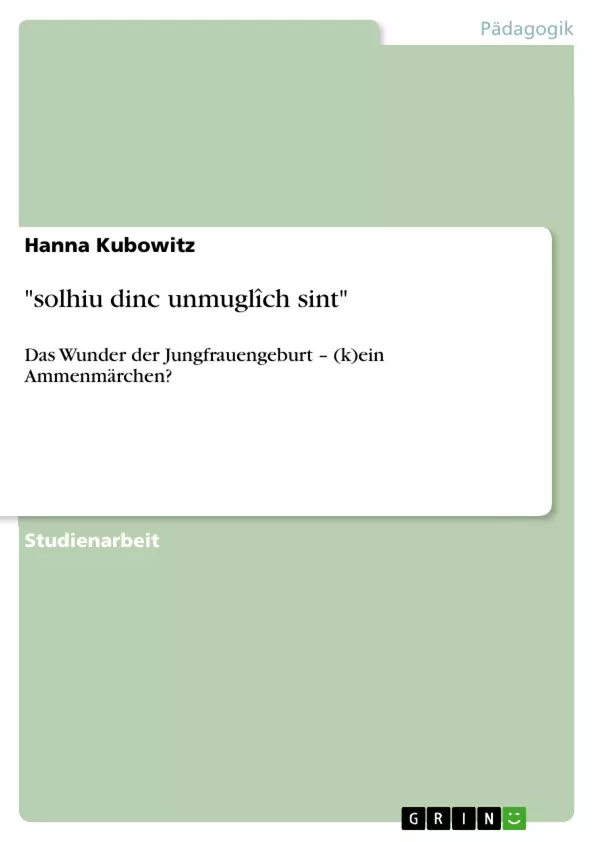„Auf eine Erörterung der zumeist geringfügigen sachlichen Differenzen kann hier verzichtet werden“, so schrieb Achim Masser vor nunmehr gut vierzig Jahren mit Blick auf die Darstellung der Jungfrauengeburt und der damit verknüpften so genannten ‚Hebammenszene’ in verschiedenen Apokryphen und Legendendichtungen. Diese Einschätzung wurde in der einschlägigen Forschung bis heute nicht infrage gestellt, zumindest wurde die Hebammenszene auch in der jüngeren Forschung bislang nicht eingehender untersucht.
Die vorliegende Arbeit dagegen speist sich aus einem grundlegenden Zweifel an dieser Einschätzung und hat zum Ziel, diese kritisch zu überdenken und gegebenenfalls zu revidieren. Mehr noch, hier wird nahezu das genaue Gegenteil behauptet: Die Darstellung des Wunders der Jungfrauengeburt und der Hebammenszene in den verschiedenen Apokryphen und mittelalterlichen Legendendichtungen weist einige auffällige und äußerst aussagekräftige Differenzen auf, die einer näheren Betrachtung bedürfen. Besondere Aufmerksamkeit verdient dabei die Darstellung der fraglichen Szene in der Kindheit Jesu Konrads von Fußesbrunnen, da hier eine Vielzahl bemerkenswert elaborierter Erzählstrategien Anwendung finden, deren Ziel es ist, den Grad der Glaubwürdigkeit des Erzählten und insbesondere die Glaubwürdigkeit des im Grunde unglaublichen ‚Wunders der Jungfrauengeburt’ zu erhöhen.
Welche narrativen Strategien es im Einzelnen sind, die in diesem Text besonders effektiv zur Erhöhung der Authentizität, Plastizität und Plausibilität des Erzählten beitragen, darüber kann am deutlichsten eine textnahe Untersuchung Aufschluss geben, die die Darstellung der fraglichen Szene in der Kindheit Jesu der Darstellung derselben Szene in einem geeigneten Kontrolltext vergleichend gegenüber stellt. Als ebensolcher Kontrolltext dient hier das Marienleben Bruder Philipps des Carthäusers. Entsprechend werden im Folgenden die Darstellungen der Geburts- und Hebammenszene in der KJ (KJ, vv. 749–964) und im ML (ML, vv. 2000–2187) einander vergleichend gegenüber gestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung oder hie ist ein wunder geschehen
- Hauptteil oder disiu frouwe ist maget unt hât ein chint: Die Hebammen und das Wunder der Jungfrauengeburt in der Kindheit Jesu und dem Marienleben
- Die Darstellung der Hebammenszene in der Kindheit Jesu Konrads von Fußesbrunnen
- Die Darstellung der Hebammenszene im Marienleben Bruder Philipps des Carthäusers
- Schlussbemerkung oder elliu dinc niht unmuglich sint
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung des Wunders der Jungfrauengeburt und der damit verbundenen Hebammenszene in verschiedenen Apokryphen und mittelalterlichen Legendendichtungen. Sie verfolgt das Ziel, die Einschätzung Achim Massers, dass die Unterschiede in den Darstellungen geringfügig sind, kritisch zu hinterfragen und zu revidieren. Die Arbeit argumentiert, dass die Unterschiede in der Darstellung des Wunders der Jungfrauengeburt und der Hebammenszene in verschiedenen Texten signifikant sind und einer detaillierten Analyse bedürfen.
- Vergleich der narrativen Strategien zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit des Wunders der Jungfrauengeburt in der Kindheit Jesu Konrads von Fußesbrunnen und im Marienleben Bruder Philipps des Carthäusers
- Untersuchung der Unterschiede hinsichtlich des Fokus und der Länge der Szene, der Detailgenauigkeit der Schilderung sowie der Rolle, Funktion und Charakterisierung der Hebammen
- Analyse der Rolle der Hebammenszene in der apokryph-religiösen Literatur und deren Einfluss auf das weltliche Publikum
- Bedeutung des Wunders der Jungfrauengeburt für das Dogma der Jungfräulichkeit Marias und die christliche Gläubigkeit
- Vergleich der Darstellung der Hebammenszene in den genannten Werken mit anderen Apokryphen und apokryphen Legendendichtungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung oder hie ist ein wunder geschehen
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage zur Darstellung des Wunders der Jungfrauengeburt und der Hebammenszene in den verschiedenen Apokryphen und Legendendichtungen. Sie kritisiert die bisherige Forschungsmeinung, die die Unterschiede in den Darstellungen als geringfügig erachtet. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, diese Unterschiede zu untersuchen und deren Relevanz für die Interpretation der Texte aufzuzeigen. Als Vergleichstext wird die Kindheit Jesu Konrads von Fußesbrunnen mit dem Marienleben Bruder Philipps des Carthäusers herangezogen.
Hauptteil oder disiu frouwe ist maget unt hât ein chint: Die Hebammen und das Wunder der Jungfrauengeburt in der Kindheit Jesu und dem Marienleben
Der Hauptteil untersucht die Darstellung der Hebammenszene in der Kindheit Jesu und im Marienleben. Er analysiert die narrativen Strategien, die in beiden Werken zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit des Wunders der Jungfrauengeburt eingesetzt werden. Dabei werden Unterschiede hinsichtlich des Fokus und der Länge der Szene, der Detailgenauigkeit der Schilderung sowie der Rolle, Funktion und Charakterisierung der Hebammen herausgearbeitet. Der Abschnitt betrachtet die Rolle der Hebammenszene in der apokryph-religiösen Literatur und deren Einfluss auf das weltliche Publikum.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Jungfrauengeburt, Hebammenszene, Apokryphen, Legendendichtungen, Kindheit Jesu, Marienleben, narrative Strategien, Glaubwürdigkeit, Authentizität, Plausibilität, Textvergleich, Forschungslücke.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die „Hebammenszene“ in der mittelalterlichen Literatur?
Es handelt sich um eine Szene in Apokryphen und Legendendichtungen, in der Hebammen die Jungfräulichkeit Marias nach der Geburt Jesu bezeugen sollen.
Welche Rolle spielen die Hebammen für die Glaubwürdigkeit des Wunders?
Die Hebammen dienen als „Augenzeuginnen“, deren Zweifel und anschließende Überzeugung die Authentizität des biologisch unglaublichen Wunders für das Publikum erhöhen sollen.
Wie unterscheiden sich „Kindheit Jesu“ und „Marienleben“ in dieser Darstellung?
Konrad von Fußesbrunnen nutzt in der „Kindheit Jesu“ elaborierte Erzählstrategien zur Plausibilisierung, während Bruder Philipp im „Marienleben“ andere Schwerpunkte setzt.
Warum wurde die Hebammenszene in der Forschung lange vernachlässigt?
Führende Forscher wie Achim Masser sahen die Unterschiede zwischen den Texten als geringfügig an, was eine detaillierte Analyse über Jahrzehnte verhinderte.
Was bedeutet das Wunder der Jungfrauengeburt für das christliche Dogma?
Es untermauert die Lehre von der unversehrten Jungfräulichkeit Marias (ante, in und post partum) und die göttliche Natur Jesu Christi.
- Arbeit zitieren
- Hanna Kubowitz (Autor:in), 2010, "solhiu dinc unmuglîch sint", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177173