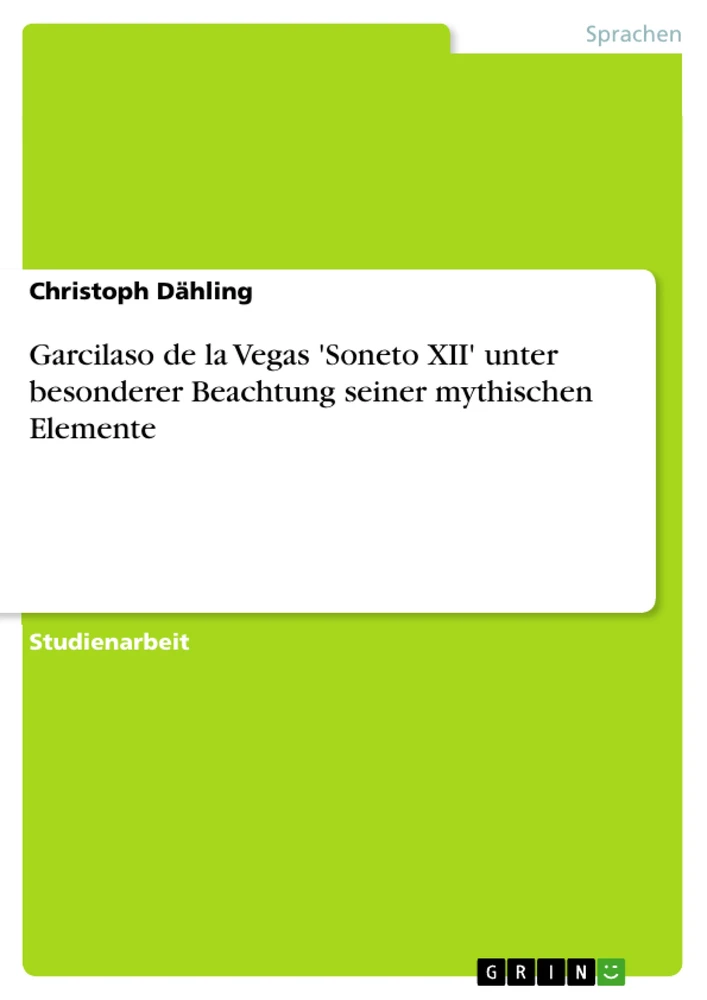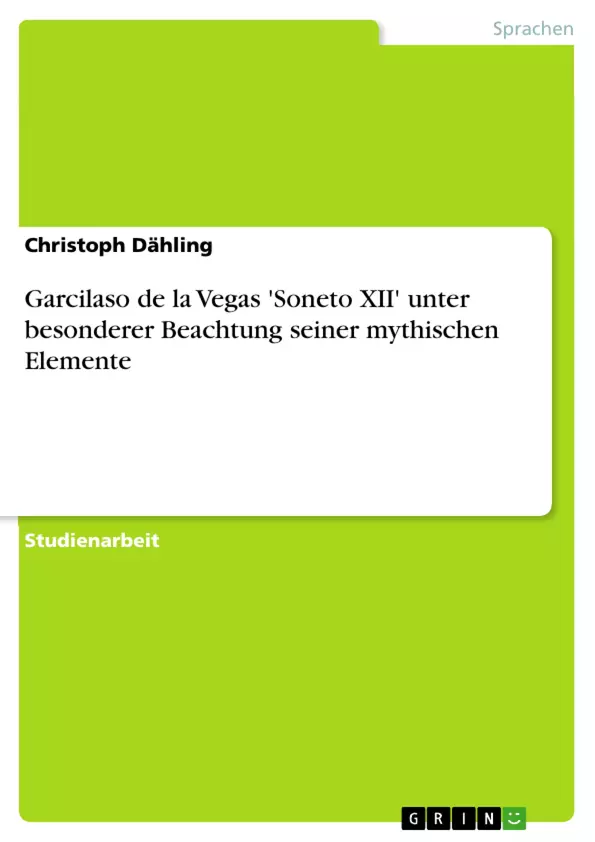Übersetzung und eingehende Analyse des Sonetts XII von Garcilaso de la Vega. Ausführliche Diskussion der verwendeten mythischen Versatzstücke.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Pragmatische Ebene
- I.1 Sprechsituation
- (a) Personaldeixis
- (b) Lokaldeixis
- (c) Temporaldeixis
- I.2 Sprechhandlung und Sprechweise
- (a) Sprechhandlung
- (b) Sprechweise
- I.1 Sprechsituation
- II. Semantische Ebene
- II.1 Ebene der Textbedeutung
- (a) Sprechgegenstand
- (b) Entwicklung des Sprechgegenstandes im Syntagma bzw. Textverlauf
- II.2 Ebene der Wort- und Versbedeutung
- (a) Ambiguitäten und Konnotationen
- (b) Tropen und Topoi
- II.1 Ebene der Textbedeutung
- III. Syntaktische und phonologische Ebene
- III.1 Syntaktische Ebene
- (a) Gliederung und positionale Markierung
- (b) Syntaktische Figuren
- III.2 Phonologische Ebene
- III.1 Syntaktische Ebene
- IV. Analyse der mythischen Elemente
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Garcilaso de la Vegas Sonett XII mit besonderem Fokus auf seine mythischen Elemente. Die Analyse zielt darauf ab, die Bedeutung der Mythen für das Verständnis des Gedichts zu beleuchten und die Art und Weise zu untersuchen, wie der Dichter die mythischen Elemente in seinen Text integriert.
- Die Rolle der mythischen Figuren Ikarus und Phaeton im Kontext des Sonetts
- Die Interpretation des mythischen Stoffes im Sinne des lyrischen Ichs
- Die Verbindung von mythischen Elementen mit den Gefühlen und Erfahrungen des Sprechers
- Die Bedeutung der antiken Mythen für die Literatur der Renaissance
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der mythischen Elemente in der Literatur der Renaissance ein und erläutert den Fokus der Arbeit auf Sonett XII von Garcilaso de la Vega. Sie stellt zudem den literarischen Kontext des Sonetts dar und beleuchtet die Bedeutung der mythischen Figuren Ikarus und Phaeton im Werk des Dichters.
Der erste Teil der Analyse befasst sich mit der pragmatischen Ebene des Sonetts und analysiert die Sprechsituation, die Sprechhandlung und die Sprechweise. Dabei wird die Rolle des lyrischen Ichs sowie die Verwendung von Personaldeixis und anderen sprachlichen Mitteln untersucht.
Der zweite Teil behandelt die semantische Ebene des Gedichts. Hierbei wird die Ebene der Textbedeutung analysiert, indem der Sprechgegenstand und dessen Entwicklung im Textverlauf untersucht werden. Weiterhin werden die Wort- und Versbedeutung unter Berücksichtigung von Ambiguitäten, Konnotationen, Tropen und Topoi beleuchtet.
Der dritte Teil befasst sich mit der syntaktischen und phonologischen Ebene des Sonetts. Hierbei werden die Gliederung und positionale Markierung sowie die syntaktischen Figuren des Gedichts analysiert. Weiterhin wird die phonologische Ebene des Textes untersucht.
Der vierte Teil der Analyse widmet sich den mythischen Elementen im Sonett und analysiert die Bedeutung der Figuren Ikarus und Phaeton im Kontext des Textes.
Schlüsselwörter
Garcilaso de la Vega, Sonett XII, mythische Elemente, Ikarus, Phaeton, Sprechsituation, Semantik, Syntagma, Ambiguität, Konnotation, Tropen, Topoi, Syntaktische Ebene, Phonologie, Renaissance, spanische Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Welche Mythen werden in Garcilaso de la Vegas Sonett XII thematisiert?
Im Zentrum der Analyse stehen die antiken Mythen von Ikarus und Phaeton, die als zentrale Symbole im Sonett verwendet werden.
Welche Rolle spielen Ikarus und Phaeton für das lyrische Ich?
Die Figuren dienen dazu, die Gefühle und Erfahrungen des Sprechers auszudrücken, wobei ihr Scheitern oft mit der emotionalen Situation des lyrischen Ichs verknüpft wird.
Auf welchen Ebenen wird das Sonett analysiert?
Die Arbeit untersucht das Werk auf der pragmatischen Ebene (Sprechsituation), der semantischen Ebene (Bedeutung) sowie auf der syntaktischen und phonologischen Ebene.
Warum war die Mythologie in der Renaissance so wichtig?
In der Renaissance diente der Rückgriff auf antike Mythen dazu, universelle menschliche Erfahrungen literarisch zu verarbeiten und ästhetisch anspruchsvolle Bezüge zur Klassik herzustellen.
Was ist das Ziel der sprachlichen Analyse des Gedichts?
Ziel ist es, durch die Untersuchung von Tropen, Topoi und Ambiguitäten ein tieferes Verständnis für die komplexe Struktur und die Wirkungsweise der Lyrik Garcilasos zu gewinnen.
- Quote paper
- Christoph Dähling (Author), 2010, Garcilaso de la Vegas 'Soneto XII' unter besonderer Beachtung seiner mythischen Elemente, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177217