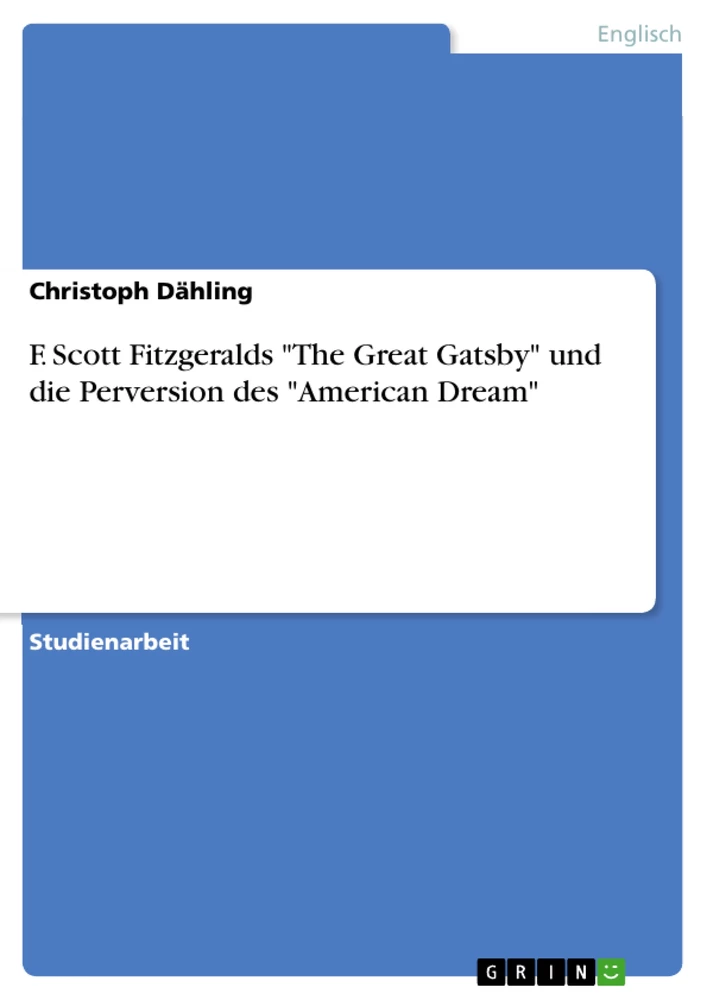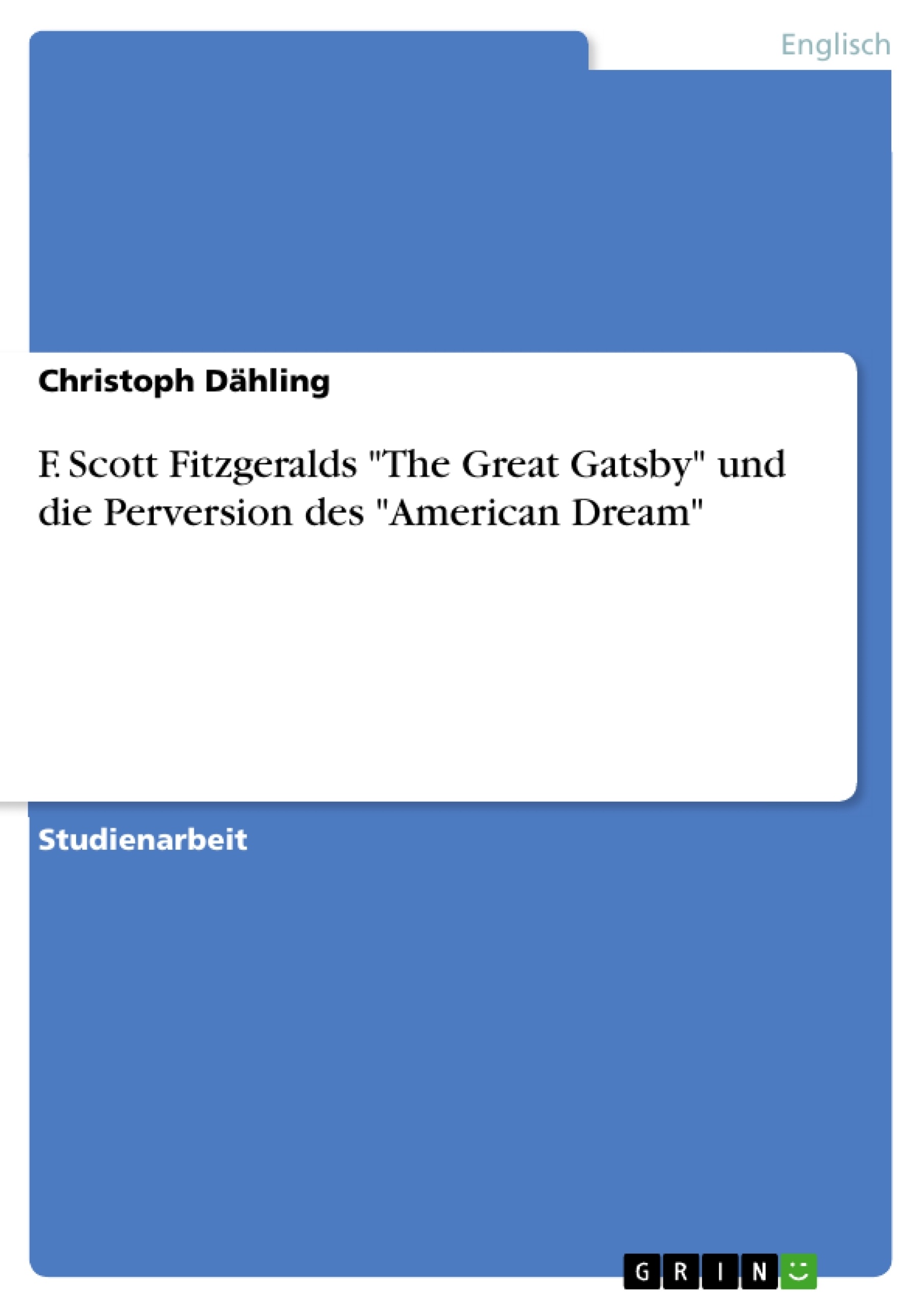Die Arbeit geht der Frage nach, inwiefern der Roman "Der große Gatsby" eine Auseinandersetzung mit dem "Amerikanischen Traum" darstellt.
Die Arbeit setzt sich mit dem Begriff und dem Spannungsfeld Protagonisten-Symbole auseinander.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Der American Dream
- III. Hauptcharaktere
- 1) Tom Buchanan
- 2) Daisy Buchanan
- 3) Jordan Baker
- 4) Myrtle Wilson
- 5) Jay Gatsby
- IV. Die Symbole des Romans
- 1) Valley of ashes
- 2) Die Augen des Dr. T. J. Eckleburg
- 3) Das grüne Licht
- V. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert F. Scott Fitzgeralds Roman "The Great Gatsby" und die Rolle, die der American Dream in der Geschichte spielt. Sie möchte herausfinden, wie der Roman den American Dream als Konzept beleuchtet und welche Bedeutung der Traum für die Figuren und das Narrativ des Romans hat.
- Der American Dream als ideologisches Konstrukt und seine Auswirkungen auf die Figuren
- Die Korrumpierung des American Dream durch Materialismus, Gier und Oberflächlichkeit
- Die Rolle der Figuren im Roman als Repräsentanten des American Dream
- Die symbolische Bedeutung des Romans für die Analyse des American Dream
- Die menschliche Existenz und die "conditio humana" im Kontext des American Dream
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Die Einleitung stellt den Roman "The Great Gatsby" im Kontext des American Dream vor und erläutert die Komplexität des Begriffs. Sie stellt die zentralen Interpretationsansätze und den Fokus der Arbeit dar.
- II. Der American Dream: Dieses Kapitel beleuchtet den American Dream als Konzept, seine verschiedenen Interpretationen und die Bedeutung des Traums für die amerikanische Kultur.
- III. Hauptcharaktere: Dieses Kapitel analysiert die wichtigsten Figuren des Romans, darunter Tom Buchanan, Daisy Buchanan, Jordan Baker, Myrtle Wilson und Jay Gatsby. Es wird untersucht, wie diese Figuren den American Dream repräsentieren und welche Beziehung sie zu dem Konzept haben.
- IV. Die Symbole des Romans: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse der symbolischen Bedeutung wichtiger Elemente des Romans, wie dem "Valley of ashes", den "Augen des Dr. T. J. Eckleburg" und dem "grünen Licht". Diese Symbole helfen, die tiefere Bedeutung des Romans und die Beziehung der Figuren zum American Dream zu verstehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf Themen wie den American Dream, die Korruption von Werten, Materialismus, Oberflächlichkeit, Freiheit, Individualität, Illusionen und die "conditio humana". Sie analysiert den Roman "The Great Gatsby" und seine Figuren, um die Beziehung zum American Dream und die Kritik an dem Konzept zu erforschen.
Häufig gestellte Fragen
Wie thematisiert „The Great Gatsby“ den American Dream?
Der Roman zeigt die Perversion des Traums auf, indem er verdeutlicht, wie Idealismus durch Materialismus, Gier und soziale Oberflächlichkeit korrumpiert wird.
Was symbolisiert das „grüne Licht“ im Roman?
Es steht für Gatsbys unerreichbare Hoffnung, seine Sehnsucht nach Daisy und den optimistischen Kern des American Dream, der in der Realität scheitert.
Wer repräsentiert die Korruption der Oberschicht?
Tom und Daisy Buchanan verkörpern die rücksichtslose, alteingesessene Elite, die sich hinter ihrem Reichtum versteckt und moralisch bankrott ist.
Was ist das „Valley of Ashes“?
Es ist eine trostlose Industrielandschaft, die den moralischen und sozialen Verfall sowie die vergessene Unterschicht im Schatten des Prunks symbolisiert.
Warum scheitert Jay Gatsby am Ende?
Gatsbys Scheitern resultiert aus seinem Versuch, die Vergangenheit zurückzuholen, und der Unfähigkeit, die starren sozialen Schranken allein durch Geld zu überwinden.
- Arbeit zitieren
- Christoph Dähling (Autor:in), 2011, F. Scott Fitzgeralds "The Great Gatsby" und die Perversion des "American Dream", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177224