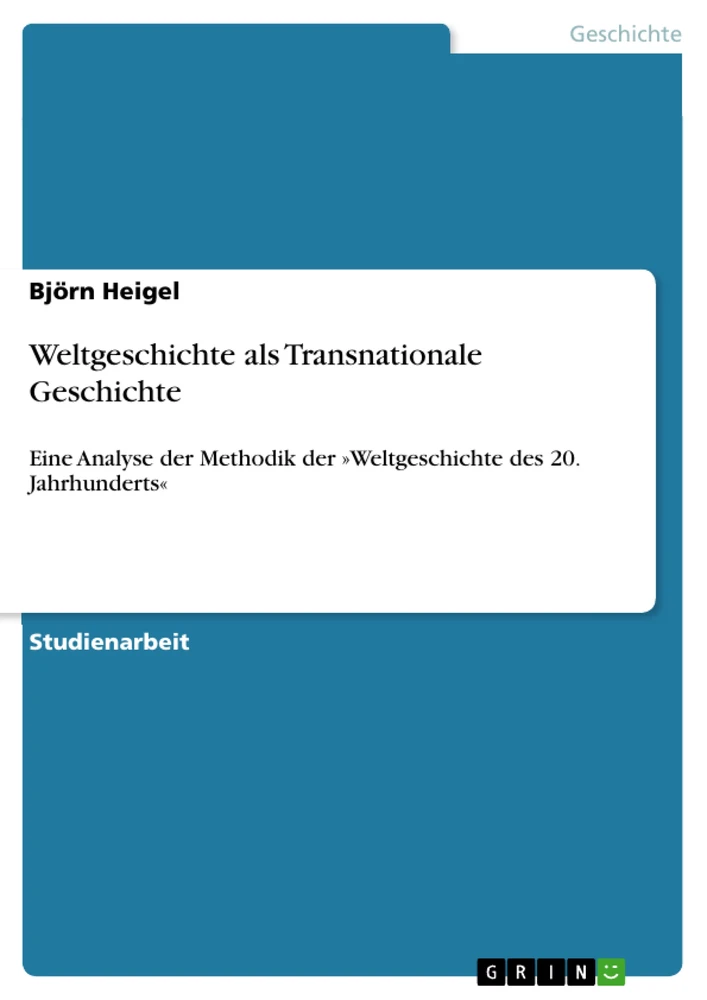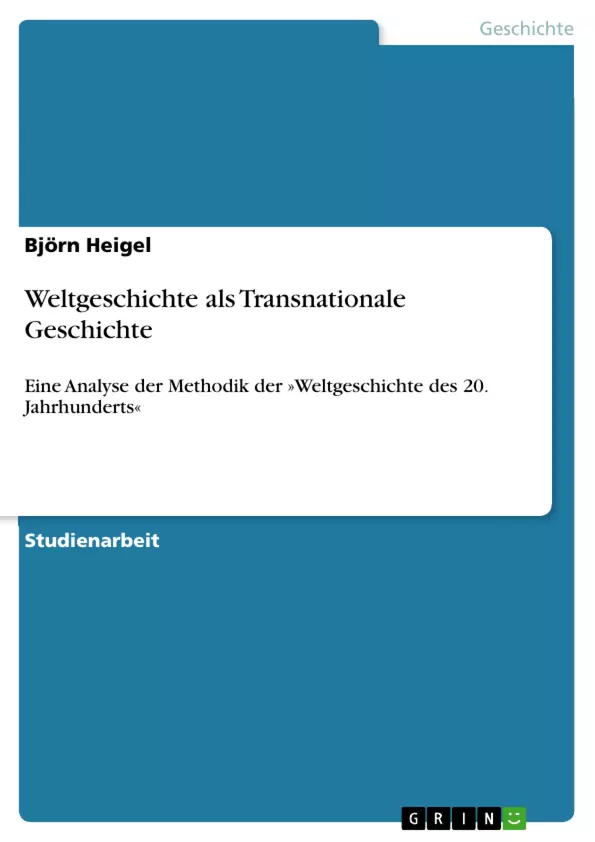Die historische Disziplin der Weltgeschichte – oder auch Globalgeschichte, wie wir sie heute verstehen, ist eine sehr junge Forschungsrichtung, die sich aus einem grundsätzlichen methodischen Richtungswechsel der modernen Geschichtswissenschaft ergab. Die zunehmende Orientierung an transnationaler Geschichte dient dem Zweck, die bisher vorherrschende euro,- germano und ethnozentristische Perspektive hinter sich zu lassen und Gesetzmäßigkeiten hervorzuheben, die nicht auf nationalstaatlichen Begrenzungen beruhen. Aus diesem Forschungsanspruch heraus und einer zunehmenden Verflechtung von ökonomischen Zusammenhängen, medientechnischen Errungenschaften und industriellen Innovationen ergibt sich die Möglichkeit einer neuen Sichtweise auf die Welt. Laut JÜRGEN OSTERHAMMEL, seines Zeichens Pionier der deutschen Weltgeschichtsschreibung, wird aus »normaler« Geschichte Weltgeschichte, wenn sich der analytisch ausgeleuchtete Raum über die kulturellen Grenzen erweitert – auch wenn sie eine Sub-Disziplin der Geschichtswissenschaft bleibt.
Durch neue Strukturen und Handlungsfelder kommt es heute vor, dass »ein Schlaganfallmediziner in Berlin […] seine Kollegin in Harvard [kennt], aber nicht den Urologen seiner Klinik oder gar den Mieter der Etage über ihm«, schreibt der Osteuropahistoriker und Herausgeber der »Zeitschrift für Weltgeschichte« HANS-HEINRICH NOLTE, dessen Buch »Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts« einen besonderen Stellenwert innerhalb dieser Hausarbeit einnimmt. Anhand NOLTES gigantischen Unternehmens sollen Vorteile und Grenzen einer globalgeschichtlichen Perspektive aufgezeigt werden. Die Arbeit stellt der Monographie NOLTES die theoretischen Konzeptionen für eine Weltgeschichte von OSTERHAMMEL und CONRAD gegenüber, um Ziele und Methoden besser nachvollziehen zu können. Hinleitend zu der Auseinandersetzung mit NOLTE und der Weltsystem-Theorie folgt ein kurzer Abriss über die Genese und den Aufstieg der Weltgeschichtsschreibung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Von den Ursprüngen der Weltgeschichte bis in die Gegenwart
- Die terminologische Differenz zwischen Welt-, Global- und Universalgeschichte
- Die Methodik des welt- und globalgeschichtlichen Ansatzes
- Die Grundmotive der Weltgeschichtsschreibung (OSTERHAMMEL).
- Die Dimensionen der Weltgeschichtsschreibung (CONRAD / ECKERT).
- Die Weltsystem-Theorie als Grundlage für Weltgeschichte (Wallerstein)
- Die Strukturprinzipien der »Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts<<
- Der Aufstieg des Westens (WILLIAM H. MCNEILL)
- Dependenz der Peripherien (ANDRÉ GUNDER FRANK).
- Europa - eine Provinz unter vielen (Dipesh ChaKRABARTY)
- Exemplarische Auseinandersetzung mit dem Weltsystem des 20. Jahrhunderts - >>Wohlstand für alle?<<
- Kritische Betrachtung.
- Kritik an der >>Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts<<
- Kritik an der Methodik des Weltsystem-Ansatzes
- NOLTE und OSTERHAMMEL - Ein vergleichendes Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Methodik der »Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts« von Hans-Heinrich Nolte und untersucht, inwiefern diese Arbeit den Anspruch einer transnationalen Geschichte erfüllt. Die Arbeit analysiert Noltes Ansatz anhand der theoretischen Konzeptionen von Jürgen Osterhammel und Sebastian Conrad, um die Ziele und Methoden der Weltgeschichtsschreibung besser zu verstehen.
- Die Genese und der Aufstieg der Weltgeschichtsschreibung
- Die Methodik der »Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts«
- Die Bedeutung der transnationalen Geschichte
- Die Kritik an der »Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts« und der Weltsystem-Theorie
- Der Vergleich von Noltes Ansatz mit den Konzeptionen von Osterhammel und Conrad
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung bietet einen Überblick über die historische Disziplin der Weltgeschichte und führt den Leser in die Thematik der transnationalen Geschichte ein.
- Kapitel 1 beleuchtet die Ursprünge der Weltgeschichtsschreibung und verfolgt die Entwicklung von frühen Ansätzen bis zur Gegenwart.
- Kapitel 2 untersucht die terminologische Differenz zwischen Welt-, Global- und Universalgeschichte.
- Kapitel 3 analysiert die Methodik des welt- und globalgeschichtlichen Ansatzes und diskutiert die Grundmotive, Dimensionen und die Weltsystem-Theorie als Grundlage für Weltgeschichte.
- Kapitel 4 behandelt die Strukturprinzipien der »Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts« und beleuchtet den Aufstieg des Westens, die Dependenz der Peripherien und die Perspektive Europas als »Provinz unter vielen«.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Themen Weltgeschichte, Globalgeschichte, Transnationale Geschichte, Methodik, Weltsystem-Theorie, eurozentristische Perspektive, Dependenztheorie, »Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts«, Hans-Heinrich Nolte, Jürgen Osterhammel, Sebastian Conrad.
Häufig gestellte Fragen
Was ist transnationale Geschichte?
Ein Forschungsansatz, der über nationalstaatliche Grenzen hinausblickt und Verflechtungen sowie globale Zusammenhänge in den Fokus rückt.
Wer sind die Pioniere der deutschen Weltgeschichtsschreibung?
Jürgen Osterhammel und Hans-Heinrich Nolte werden in der Arbeit als maßgebliche Vertreter genannt.
Was besagt die Weltsystem-Theorie?
Diese Theorie (nach Wallerstein) analysiert die Welt als ein System aus ökonomischen Zentren und Peripherien, die in gegenseitiger Abhängigkeit stehen.
Warum ist Eurozentrismus in der Geschichtswissenschaft ein Problem?
Transnationale Geschichte versucht, die rein europäische Perspektive zu überwinden und Europa als „eine Provinz unter vielen“ zu betrachten.
Was ist der Unterschied zwischen Welt- und Globalgeschichte?
Die Arbeit untersucht die terminologischen Differenzen und die methodischen Ansätze dieser sich überschneidenden Disziplinen.
- Arbeit zitieren
- Björn Heigel (Autor:in), 2011, Weltgeschichte als Transnationale Geschichte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177241