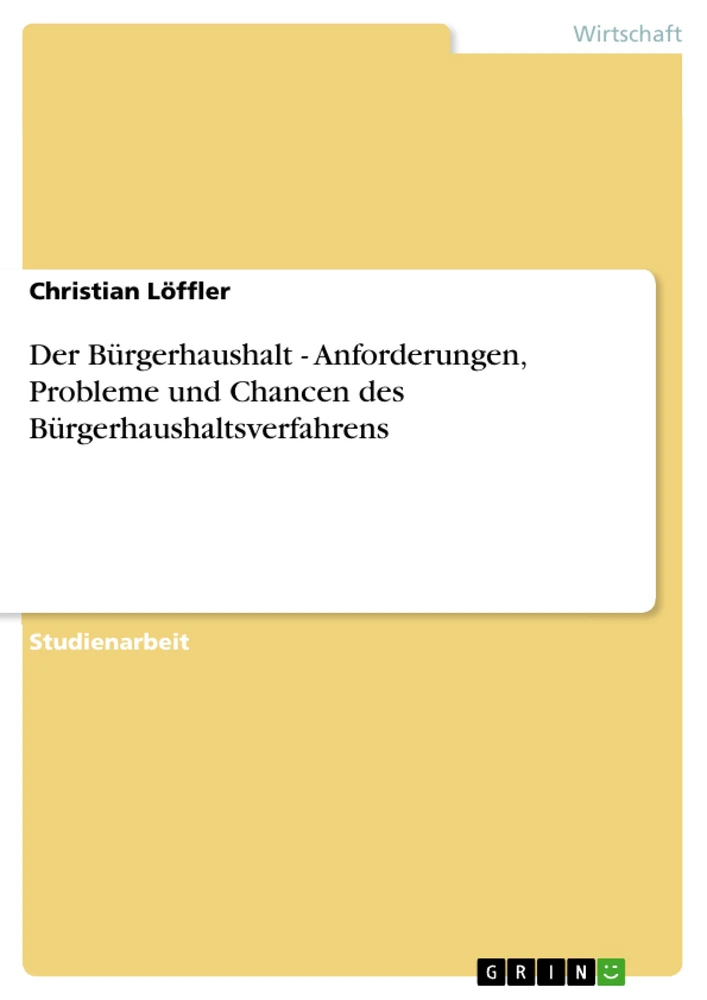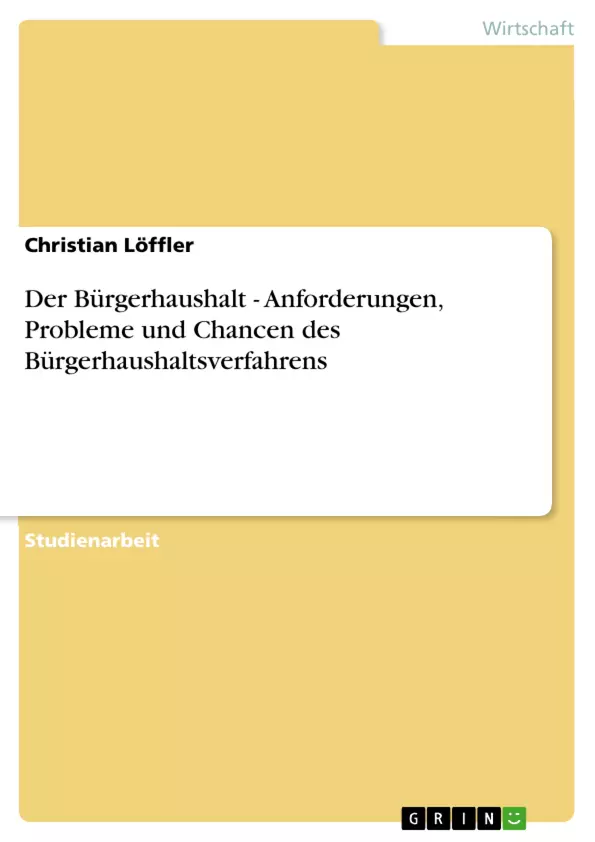Der Bürgerhaushalt ist weder eine rein europäische Erfindung, noch eine Entwicklung der jüngeren Zeit. Beim Bürgerhaushaltsverfahren handelt es sich um einen, seit 20 Jahren in der Entwicklung befindlichen Prozess, der seinen konzeptionellen Ursprung in Porto Alegre (Brasilien) hat und im going concern Verfahren in Christchurch (Neuseeland) weiterentwickelt wurde, bevor der Gedanke im Jahre 2000 nach Europa diffusionierte.
Grundsätzlich handelt es sich nicht um ein einheitliches Konzept, sondern um unterschiedliche Verfahren mit teilweise widersprüchlichen Zielen und ideologischen Grundlagen. Betrachtet man die Entwicklung, könnte man die Frage stellen, ob es sich nur um einen globalen Trend handelt, oder ob es sich um einen nachhaltigen Prozess zur Bürgerpartizipation und Anwendung direkter Demokratie handeln wird. Der Gedanke der Nachhaltigkeit bedingt eine aktive Beteiligung der Bürger, welche in Zeiten der Politikverdrossenheit nicht von vorne herein gegeben sein dürfte, sondern eine prozessuale Entwicklung darstellen sollte, die intensiv durch Informations- und Marketingkampagnen zwin-gend begleitet werden muss.
Der Transformationsprozess von Porto Alegre in die europäische Gemeinschaft, herunter gebrochen auf die Elementarebenen der Kommunalverwal-tung, mit den Zielen der Wahrung der Autonomie der Zivilgesellschaft und dem „Good Governance“ Gedanken erweist sich als nicht unisono realisierbar. Risiken und damit der Zugang, sei er auch nur von psychologischer Determinierung bestimmt, zu den Werkzeugen und Komponenten des direkten Demokratielayers „Bürgerhaushalt“ wird aller Voraussicht nach nur bestimmten Schichten der Gesellschaft offen stehen. Unter den realen Aspekten der Verteilungsgerechtigkeit, besseren Verwaltung und Anerkennung ärmerer Bevöl-kerungsschichten sind die gesetzlichen Grundlagen und Ausführungsbestimmungen für das Bürgerhaushaltsverfahren zu gestalten.....
Die vorliegende Arbeit beschreibt den Bürgerhaushalt allgemein und untersucht diesen, in Anlehnung an die SWOT - Analyse (nach Porter). Das zweite Kapitel zeigt den Ablauf des Bürgerhaushaltsverfahrens auf und untersucht diesen exemplarisch nach dem Kriterium des Zeit- Maßnahmenplanes. Ferner wird auf die inhaltliche Ausgestaltung eingegangen.
Abschließend werden die Erkenntnisse aller Untersuchungen in einem kurzen Fazit gewürdigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Bürgerhaushalt
- Formale Anforderungen
- Flankierende Maßnahmen
- Stärken
- Schwächen
- Risiken
- Chancen
- Der Ablauf des Bürgerhaushaltsverfahrens
- Darstellung der entscheidenden Argumente
- Zeit-Maßnahmenplan
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Bürgerhaushaltverfahren und untersucht die Anforderungen, Probleme und Chancen dieses Instruments der direkten Demokratie. Sie analysiert die formalen Anforderungen an die Durchführung eines Bürgerhaushalts und beleuchtet die Notwendigkeit flankierender Maßnahmen, um den Erfolg des Verfahrens zu gewährleisten. Darüber hinaus werden die Stärken, Schwächen, Risiken und Chancen des Bürgerhaushaltsverfahrens im Detail betrachtet.
- Formale Anforderungen und Rahmenbedingungen des Bürgerhaushaltsverfahrens
- Flankierende Maßnahmen zur erfolgreichen Durchführung des Bürgerhaushalts
- Stärken und Schwächen des Bürgerhaushalts als Instrument der direkten Demokratie
- Risiken und Chancen des Bürgerhaushaltsverfahrens
- Der Ablauf und die zentralen Elemente des Bürgerhaushaltsverfahrens
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Bürgerhaushalt als Instrument der direkten Demokratie vor und skizziert die zentralen Themen der Arbeit. Sie beleuchtet die formalen Anforderungen an die Durchführung eines Bürgerhaushalts sowie die Notwendigkeit flankierender Maßnahmen, um den Erfolg des Verfahrens zu gewährleisten.
Der Ablauf des Bürgerhaushaltsverfahrens
Dieses Kapitel erläutert den Ablauf des Bürgerhaushaltsverfahrens und beschreibt die wichtigsten Schritte, die von der Ideenfindung bis zur Umsetzung der Bürgerentscheidungen durchlaufen werden. Darüber hinaus werden die wichtigsten Argumente für und gegen das Bürgerhaushaltsverfahren dargestellt.
Fazit
Das Fazit fasst die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen und bewertet die Bedeutung des Bürgerhaushaltsverfahrens für die direkte Demokratie. Es werden Empfehlungen für die zukünftige Gestaltung und Anwendung des Bürgerhaushaltsverfahrens abgegeben.
Schlüsselwörter
Bürgerhaushalt, Bürgerbeteiligung, direkte Demokratie, politische Partizipation, Kommunalpolitik, Haushaltsplanung, finanzielle Ressourcen, Entscheidungsfindung, Transparenz, Kontrolle, öffentliche Verwaltung.
- Quote paper
- Christian Löffler (Author), 2011, Der Bürgerhaushalt - Anforderungen, Probleme und Chancen des Bürgerhaushaltsverfahrens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177321