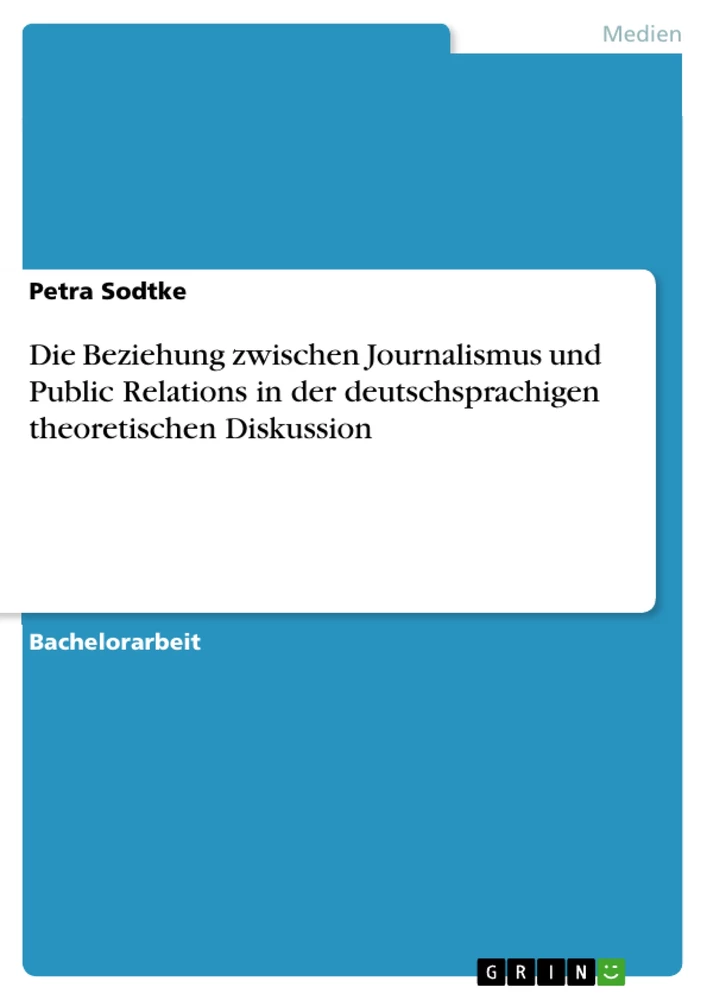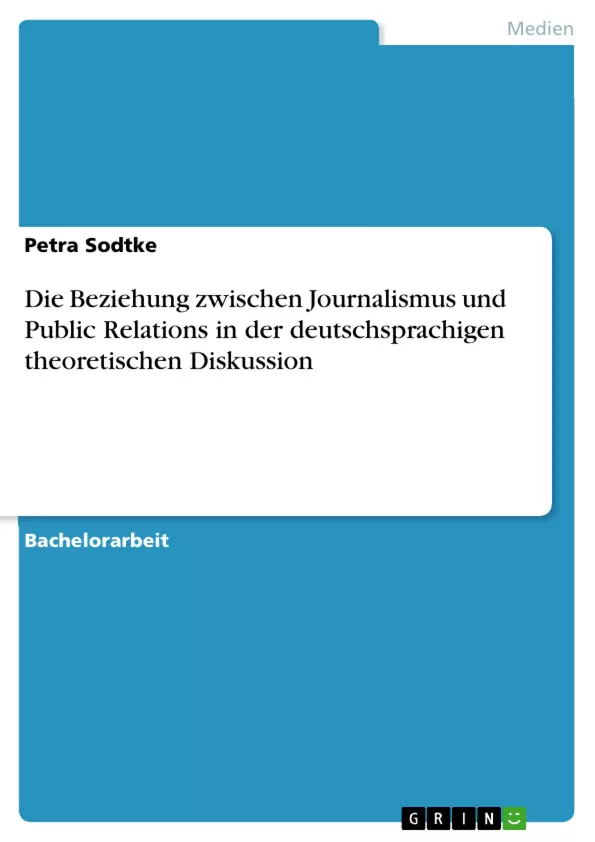PR und Journalismus – ein existierendes, aber ambivalentes Verhältnis, das schon viele Diskussionen nach sich gezogen und zu divergierenden Schlussfolgerungen geführt hat. Die Debatten über diese und der Zugang zu dieser Thematik verlieren nicht an Aktualität. Aber nicht nur in der Theorie, auch in der Berufspraxis ist die Auseinandersetzung darüber, wie, ob und in welchem Maße PR und Journalismus miteinander interagieren sollen bzw. 'dürfen', ein Dauerbrenner. Eine Headline aus der österreichischen Tageszeitung 'Die Presse' vom Juni 2006 mag dies verdeutlichen: 'Mit Reisen fängt man Journalisten? Experten warnen vor zu starkem Einfluss der PR-Branche auf die Medien'. Der Inhalt dieses Artikels spiegelt die Tatsache in fast idealtypischer Weise wieder, dass sich die Gegenüberstellung der Bereiche PR und Journalismus durch viele unterschiedliche Denkrichtungen, Zugangsmöglichkeiten und Perspektiven als ein sehr vielschichtiges Thema präsentiert. Für PR und Journalismus gilt gleichermaßen: Sie sind Forschungsgegenstände der Publizistik, aber auch der Ökonomie, der Psychologie, der Soziologie – um nur einige zu nennen. Theorien und Modelle, welche die zwei Bereiche beschreiben, sind aus den verschiedensten Disziplinen entlehnt. Es gibt nicht nur den 'einen' gangbaren Weg, um einen Zugang zur PR und zum Journalismus zu finden, sondern immer mehrere. Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit ist sich dieses Problems bewusst und hat dies berücksichtigt. Ziel dieser Arbeit ist daher, die Beziehungsstrukturen zwischen PR und Journalismus aus möglichst unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven zu beleuchten, diese in geeigneter Weise zusammenzuführen und die Brauchbarkeit der verschiedenen Ansätze für die Klärung des Verhältnisses von PR und Journalismus zu diskutieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Begriffserklärung
- Theorien zur Beziehung zwischen Journalismus und PR
- Determinationshypothese: Einseitige Einflussnahme
- Wechselseitige Beeinflussung und Abhängigkeit
- Zugang über Funktionen, Normen und Rollenbilder
- Systemtheoretische Perspektive: Fokus Interpenetration
- Ökonomische Perspektive: Medialer Tauschmarkt
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die vielschichtigen Beziehungsstrukturen zwischen Public Relations und Journalismus aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven. Ziel ist es, die Brauchbarkeit verschiedener Ansätze zur Klärung des komplexen Verhältnisses von PR und Journalismus zu diskutieren.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe „Journalismus“ und „Public Relations“
- Analyse verschiedener Theorien zur Beziehung zwischen Journalismus und PR
- Bewertung der Brauchbarkeit der verschiedenen Ansätze für die Klärung des Verhältnisses von PR und Journalismus
- Bedeutung der ökonomischen Perspektive in der Erforschung des Journalismus/PR-Verhältnisses
- Diskussion zukünftiger Forschungsschwerpunkte im Bereich der Journalismus/PR-Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel werden die Begriffe „Journalismus“ und „Public Relations“ definiert und abgegrenzt. Es werden verschiedene Definitionen aus der wissenschaftlichen Literatur vorgestellt und diskutiert, wobei die Herausforderungen einer einheitlichen Definition beider Begriffe deutlich werden.
Kapitel 3 widmet sich den Theorien, die die Beziehung zwischen Journalismus und PR beschreiben. Die Determinationshypothese, welche eine einseitige Einflussnahme der PR auf den Journalismus postuliert, wird als Ausgangspunkt der Analyse betrachtet. Anschließend werden Modelle vorgestellt, die von einer wechselseitigen Beeinflussung und Abhängigkeit von PR und Journalismus ausgehen.
Im weiteren Verlauf werden der Zugang über Funktionen, Normen und Rollenbilder sowie die systemtheoretische Perspektive beleuchtet. Hierbei wird insbesondere das Interpenetrationsmodell von Stefan Weber vorgestellt und diskutiert.
Kapitel 3.5. widmet sich der ökonomischen Perspektive auf das Verhältnis von Journalismus und PR, die aus Sicht der Verfasserin wichtige Impulse für die Erforschung dieses Themas bietet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem komplexen Verhältnis zwischen Journalismus und Public Relations. Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen sind: Public Relations, Journalismus, Determinationshypothese, Wechselseitige Beeinflussung, Funktionen, Normen, Rollenbilder, Systemtheorie, Interpenetration, Ökonomische Perspektive, Medialer Tauschmarkt.
Häufig gestellte Fragen
Wie stehen Journalismus und Public Relations zueinander?
Das Verhältnis ist ambivalent: Einerseits besteht eine gegenseitige Abhängigkeit (Informationen vs. Veröffentlichung), andererseits gibt es Spannungen bezüglich Objektivität und Einflussnahme.
Was besagt die Determinationshypothese?
Diese Hypothese postuliert, dass die PR den Journalismus maßgeblich steuert und Themen sowie Zeitpunkte der Berichterstattung diktiert.
Was ist das Interpenetrationsmodell?
Ein systemtheoretischer Ansatz, der davon ausgeht, dass sich PR und Journalismus gegenseitig durchdringen und stabilisieren, ohne ihre jeweilige Eigenlogik völlig aufzugeben.
Welche Rolle spielt die ökonomische Perspektive in diesem Verhältnis?
Sie betrachtet den Informationsaustausch als einen medialen Tauschmarkt, auf dem PR-Inhalte als kostengünstige Rohstoffe für die Medienproduktion dienen.
Warum ist die Abgrenzung beider Berufe oft schwierig?
Da beide Felder ähnliche Instrumente nutzen und die Grenzen zwischen neutraler Information und interessengeleiteter Kommunikation in der Praxis oft verschwimmen.
- Citation du texte
- Mag. Petra Sodtke (Auteur), 2007, Die Beziehung zwischen Journalismus und Public Relations in der deutschsprachigen theoretischen Diskussion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177334