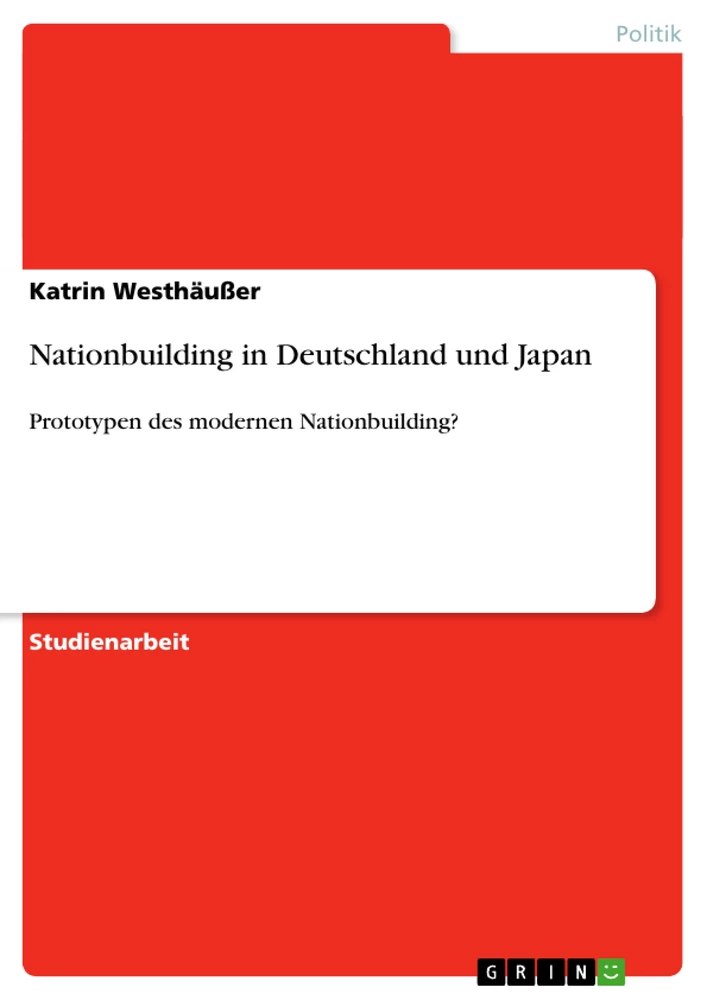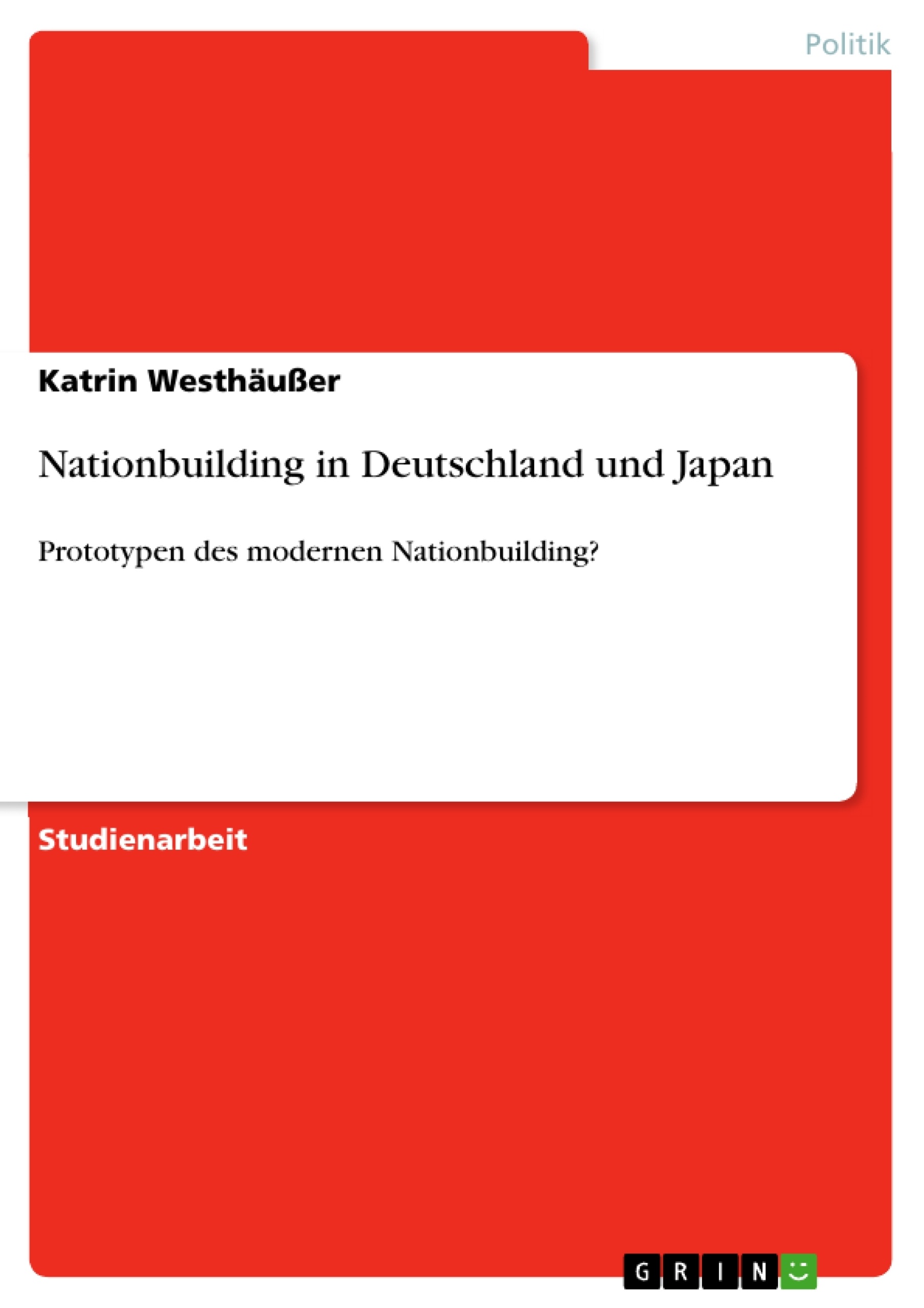Seit dem Ende des Kalten Krieges haben sich die Herausforderungen der Sicherheitspolitik gewandelt. Weniger die Bedrohung durch zwischenstaatliche Kriege, sondern innerstaatliche Konflikte und Angriffe gewaltbereiter nicht staatlicher Gruppen stehen im Vordergrund. Antwort auf diese neuen Herausforderungen soll das Nationbuilding geben. Westliche Staaten versuchen instabile und kriegszerrüttete Staaten nach demokratischen Richtlinien aufzubauen und somit langfristig Frieden und Stabilität in die Region zu bringen.
Als Pionierprojekte hierfür gelten der Wiederaufbau in Deutschland und
Japan nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch die geringen Fortschritte, die die heutigen Nationbuilding-Einsätze aufweisen machen eine genauere Betrachtung dieser Pionierprojekte nötig. Daher soll in dieser Arbeit die Frage geklärt werden: In wie weit kann der Wiederaufbau in Deutschland und Japan als Prototyp des modernen Nationbuilding gesehen werden?
Inhaltsverzeichnis
A. Einleitung
B. Hauptteil
1. Theorie des Nationbuilding
2.Nationbuilding in Deutschland und Japan
2.1. Deutschland
2.2 Japan
2.3. Gründe für den Erfolg der Projekte
3. Heutige Herausforderungen des Nationbuildings
C. Schluss
D. Literaturverzeichnis
A. Einleitung
Seit dem Ende des Kalten Krieges haben sich die Herausforderungen der Sicherheitspolitik ge- wandelt. Weniger die Bedrohung durch zwischenstaatliche Kriege, sondern innerstaatliche Kon- flikte und Angriffe gewaltbereiter nicht staatlicher Gruppen stehen im Vordergrund. Antwort auf beide neuen Herausforderungen soll das Nationbuilding geben. Westliche Staaten versuchen in- stabile und kriegszerrüttete Staaten nach demokratischen Richtlinien aufzubauen und somit lang- fristig Frieden und Stabilität in die Region zu bringen. Auf diese Weise sollen auch terroristischen Gruppen ihre Unterschlupf - und Nachschubmöglichkeiten entzogen werden. Beispiele für derar- tige Bemühungen findet man derzeit zahlreich - auf dem Balkan, in Afghanistan oder im Irak. Das Prinzip ist jedoch nicht neu. Als Pionierprojekte gelten der Wiederaufbau in Deutschland und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem erfolgreichen Demokratisierungsprozess in Deutschland zog man den Schluss, dass Demokratie übertragbar ist. Nach Japan schloss man, dass dies auch auf nicht-westliche Staaten zutrifft. Doch sind diese Erkenntnisse in der veränderten heutigen Welt noch anwendbar? Die geringen Fortschritte, die die heutigen Nationbuilding-Ein- sätze aufweisen machen eine genauere Betrachtung dieser Pionierprojekte nötig. Daher soll in die- ser Arbeit die Frage geklärt werden: In wie weit kann der Wiederaufbau in Deutschland und Japan als Prototyp des modernen Nationbuilding gesehen werden?
Hierzu wird - nach einer kurzen Darstellung der Theorie des Nationbuilding - zunächst der Wiederaufbau in beiden Ländern aufgezeigt und analysiert. Danach werden die Herausforderungen an das moderne Nationbuilding an Hand der Beispiele Bosnien - Herzegowina, Kosovo, Afganistan und Irak untersucht. Dies wird abschließend einen Vergleich der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der jeweiligen Projekte ermöglichen.
Die Literatur zu diesem Thema ist breit gefächert. Werke über die Nachkriegsjahre in Deutsch- land sind in deutscher und englischer Sprache zahlreich. Auch nach Informationen über die ameri- kanische Besatzungszeit in Japan muss man nicht lange suchen. In Zusammenhang mit Nation- building ist besonders James Dobbins „America's role in nationbuilding“ zu empfehlen. Hierin werden die Nationbuilding-Projekte Deutschland und Japan beschrieben, ebenso wie neueren Pro- jekte mit amerikanischer Beteiligung, darunter Afghanistan und Irak Die Erkenntnisse über die modernen Herausforderungen der Sicherheitspolitik, und damit auch des Nationbuildings, sind allgemein anerkannt und werden kaum überraschen. Ausführlich dargestellt sind sie zum Beispiel In dem Sammelwerk Turbulent Peace - The Challenges of Managing International Conflict. Da die Diskussion über das Nationbuilding vor allem im englischsprachigen Raum geführt wird, ist darauf zu achten, dass viele Angaben aus amerikanischer Sichtweise geschrieben sind.
B. Hauptteil
1. Theorie des Nationbuilding
Nationbuilding, wie die wörtliche deutsche Übersetzung Nationen- oder Staatsbildung vor Augen führt, bedeutet im allgemeinen die Entstehung eines Staatsgebildes. In dieser Arbeit soll jedoch lediglich auf die 'moderne' Form des Nationbuilding eingegangen werden, die Jochen Hippler wie folgt beschreibt:
Nation-Building kann (...) eine politische Zielvorstellung, auch eine Strategie zur Erreichung konkreter Politikziele sein. (...) externe Akteure streben die Schaffung oder Stärkung eines nationalstaatlich verfassten politischen und sozialen Systems ab, wenn dies ihren Interessen zu nützen scheint (...).[1]
Man kann dies auch als programmatisch-konzeptionelle Bedeutung bezeichnen. Also als politisches Konzept Außenstehender - in den hier gewählten Beispielen westliche Mächte - zur Etablierung eines Nationalstaats.
Die Notwendigkeit des Nationbuilding stieg nach dem Ende des Kalten Krieges sprunghaft an. Nicht nur das zunehmende Auftreten von innerstaatlichen und ethnischen Konflikten, die mit ex- tremer Brutalität geführt wurden - wie etwa auf dem Balkan -, zwangen den Westen zum Eingrei- fen. Vor allem sah man sich durch weit entfernte Konflikte zunehmend in seiner eigenen Sicher- heit bedroht. In diesem Zusammenhang entstanden auch Modewörter wie rouge state (Schurken- staat) und failed oder failing state (gescheiterter/schwacher Staat). Daher erstarkte die Überzeu- gung, dass nach der Beendigung eines Krieges der Aufbau eines demokratischen, vor allem aber stabilen Systems unabdingbar sei.
Der Aufbau erfolgt hierbei in 4 Dimensionen: sicherheitspolitisch, politisch, ökonomisch und sozial oder humanitär.[2]
Zur sicherheitspolitischen zählen die Demilitarisierung und Demobilisierung, die Reform der Sicherheitskräfte, die Neuordnung der zivil-militärischen Beziehungen und die Herstellung eines legitimierten Gewaltmonopols.
Politisch stehen vor allem die Schaffung einer neuen Nachkriegsordnung, die es ermöglicht Strei- tigkeiten dauerhaft friedlich auszutragen. Nach innerstaatlichen Konflikten ist hier besonders die Machtaufteilung - häufig nach ethnischen Maßstäben - von Bedeutung. Darüber hinaus müssen funktionsfähige soziale und politische Institutionen und Normen geschaffen werden. Auch müs- sen wichtige Positionen von Kriegsverbrechern gesäubert und diese vor Gericht gestellt werden. Die ökonomische Dimension bezieht sich auf den materiellen Wiederaufbau, die Umwandlung der Kriegswirtschaft in eine funktionsfähige Friedensökonomie, die in der Lage ist, die Bevölke rung zu versorgen.
Soziale und humanitäre Herausforderungen sind die Versorgung der Bevölkerung, die Rehabilita- tion und Reintegration von Kriegsopfern und Flüchtlingen, die Überwindung der Kriegstraumata und die Wiederherstellung von nachbarschaftlichem Vertrauen und sozialen Netzwerken. Ebenso wie beim Prozess der Systemtransformation - beispielsweise in Osteuropa - besteht hier das Dilemma der Gleichzeitigkeit. Alle Dimensionen müssen relativ zeitgleich behandelt werden. Dies kann zu Konflikten einzelner Ziele führen. Häufig stehen sich hierbei vor allem Demokrati- sierungsbemühungen und der Erhalt der Stabilität im Wege. Ebenso erschwert die strafrechtliche Verfolgung von Kriegsverbrechern den Aufbau einer funktionierenden Verwaltung und umge- kehrt.[3] Der Erfolg des Nationbuilding wird daran gemessen, wie gut all diese Aufgaben bewältigt werden.
Carlo Masala nennt drei Punkte, die wesentlich mitbestimmen, wie erfolgversprechend das Pro- jekt verläuft.[4] Erstens ist es von großer Bedeutung, dass die Bevölkerung des zu erbauenden Staa- tes die Anwesenheit der fremden Mächte - der Protektoren, wie Masala sie nennt - akzeptiert. Dies sollte geschehen, wenn sie sich Schutz vor internen oder externen Bedrohungen oder einen höheren Lebensstandard durch das Nationbuilding erhofft. Des weiteren hängt der Erfolg von den spill-over Effekten der Nachbarstaaten ab. Diese können sowohl positiv als auch negativ sein. Es zeigte sich, dass Demokratisierungsversuche in so genannten „guten Nachbarschaften“, also in Regionen, die ebenfalls demokratisch regiert werden, oder sich bemühen dies zu etablieren - zu- mindest aber politisch stabil sind - erfolgreicher sind. In nicht demokratischen Regionen kann da- gegen die Etablierung einer Demokratie in einem Nachbarland als Bedrohung empfunden werden. Als dritte Voraussetzung erwähnt Masala die Notwendigkeit, die Bevölkerung davon zu überzeu- gen, dass die Anwesenheit des Protektors zeitlich begrenzt ist. Anderenfalls könnte die fremde Macht als Bedrohung gesehen werden und die Bevölkerung mit Widerstand reagieren. Ebenso ist es möglich, dass eine permanente Besatzung akzeptiert wird und dies dazu führt, dass die eigenen Bemühungen am Aufbau der Regierung oder Wirtschaft eingestellt werden. Auch dies verfehlt zweifellos den Zweck des Nationbuildings.
Die hier gewonnenen Erkenntnisse können nun im Folgenden zur Analyse konkreter Beispiele verwendet werden.
2. Nationbuilding in Deutschland und Japan
2.1. Deutschland
Bereits vor dem Sieg der Alliierten über Deutschland hatten Großbritannien, Russland und die Vereinigten Staaten von Amerika Pläne über die Nachkriegszeit in Deutschland gemacht. Auf der Konferenz in Casablanca Anfang 1943 entschied man, dass nur eine bedingungslose Kapitulation Deutschlands akzeptabel sei. In Jalta wurde dies durch den Beschluss der vollständigen Demilita- risierung und dem Abbau der Wirtschaft erweitert. Deutschland sollte nie wieder in der Lage sein eine Bedrohung für die Welt darzustellen. Auch holte man hier erstmals Frankreich zu den Bera- tungen. Bereits im September 1944 war die Teilung Deutschlands im Zonenprotokoll der EAC (European Advisory Commission) beschlossen worden.[5] Nach der Kapitulation im Mai 1945 tra- fen sich die vier Siegermächte in Potsdam und legten „die politischen und wirtschaftlichen Grund- sätze zur Behandlung Deutschlands“[6] fest. Daraufhin war Deutschland in vier Zonen aufgeteilt. Die britische, amerikanische und französische im Westen und die russische im Osten. Zumindest für die westlichen Staaten war klar, dass dies keine Annexion darstellte, sondern lediglich einen zeitweiligen Protektoratszustand. Dennoch war noch nicht entschieden, ob Deutschland jemals wieder ein vollständig souveräner Staat werden sollte. Besonders Frankreich und die Sowjetunion argumentierten dagegen.[7]
Der Wiederaufbau begann mit den sicherheitspolitischen Maßnahmen.
Zunächst wurde die deutsche Armee entwaffnet, sowie alle nationalsozialistischen und militäri- schen Organisationen aufgelöst. Auch wurden alle Eroberungen Deutschlands für nichtig erklärt und die Oder-Neiße-Linie als Grenze festgesetzt. Die deutsche Regierung wurde abgesetzt. Damit übernahmen die Alliierten das Hoheitsrecht über Deutschland. An die Stelle der Regierung trat der Alliierte Kontrollrat. Der Kontrollrat bestand aus den vier Oberbefehlshabern der Besatzungs- zonen, die gemeinsam >für eine angemessene Einheitlichkeit des Vorgehens< in ihren Besat- zungszonen Sorge tragen und >im gegenseitigen Einvernehmen Entscheidungen über alle Deutschland als Ganzes betreffenden wesentlichen Fragen< fällen sollten.[8]
De facto waren also die wichtigsten Entscheidungsträger die Militärgouverneure der vier Zonen. Sie stellten während der Besatzungszeit das legitime Gewaltmonopol dar. Probleme bereitete die Reform der Sicherheitskräfte. Zunächst musste diese Aufgabe von den alliierten Kräften über- nommen werden. Man versuchte jedoch bald möglichst, einheimische Kräfte im Polizeidienst aus- zubilden beziehungsweise ihnen Routineaufgaben zu übertragen und sich selbst noch um die Grenzkontrolle und die Überwachung der Flüchtlingsströme zu kümmern. Besonders die USA versuchten ihre Militärkräfte schnell zu entlasten, da sie ihre Kontingente nach der Kapitulation Japans aufteilen mussten.[9]
Politisch war die erste Aufgabe die Denazifizierung. Die NSDAP wurde aufgelöst und alle politi schen und gesetzlichen Strukturen, die sie hervorgebracht hatte, wurden zerstört. Sogleich begann man mit dem Aufspüren und der Verhaftung von Führungskräften des Naziregimes. Im November 1945 wurden die 24 hochrangigsten Kriegsverbrecher im Nürnberger Tribunal wegen des Mordes an Millionen Menschen und der Planung und Ausführung des Zweiten Weltkriegs angeklagt. Von den 21 Verurteilten - drei Angeklagte waren tot, vermisst oder zu schwach zur Zeit des Tribunals - wurden zehn zum Tod durch Erhängen und acht zu lebenslanger Haft verurteilt. Auch auf unteren Ebenen gab es Tribunale zur Verurteilung von Anhängern des Naziregimes. Jedoch standen die Alliierten bald vor dem Problem, dass sie auf Grund der strengen Entnazifizierung kaum Personal für die Verwaltung des Landes fanden. So mussten die Bürokraten durch die Spruchkammern freigesprochen werden, bevor sie ihren Dienst aufnehmen konnten.[10] Höhere Posten in der Verwaltung wurden besonders sorgsam überprüft.
Wer sich in der Weimarer Zeit als Demokrat und Republikaner erwiesen hatte und nach 1933 gegenüber dem Nationalsozialismus resistent geblieben war, hatte in der Nachkriegszeit gute Chancen, wieder etwas zu werden.[11]
Schon früh nach Beginn der Besatzung versuchten die Alliierten, die Verwaltung und auch Regie- rungstätigkeiten zumindest auf Länderebene unter alliierter Kontrolle an die deutsche Bevölke- rung zu übergeben. Bereits im Potsdamer Abkommen war beschlossen worden, die Entstehung demokratischer Parteien zu fördern. Diese entstanden recht früh auf Kreisebene und dehnten ih- ren Einfluss später auch auf Länderebene aus. Während Frankreich und die Sowjetunion die deut- schen Beamten in erster Linie als Ausführungsorgane der Besatzungsmacht sahen, förderten vor allem die USA die Selbständigkeit und Regierungsfähigkeit des deutschen Volkes. Bereits im September 1945 statteten sie die Länder mit voller legislativer, exekutiver und richterlicher Ge- walt aus. Wenige Monate später riefen die Amerikaner den Länderrat als Koordinierungsgremium der drei Länderregierungen in ihrer Zone aus.[12] Im Januar 1946 wurden die ersten Wahlen in Ge- meinden unter 20.000 Einwohnern durchgeführt und wenige Monate später auch in größeren Ge- meinden. In der französischen und britischen Zone dauerte die Redemokratisierung etwas länger. Doch besonders die zunehmenden Auseinandersetzungen mit der Sowjetunion förderten die Be- mühungen zur schnelleren Demokratisierung Deutschlands. So wurden 1949 die ersten landeswei- ten Wahlen in den Westzonen abgehalten, aus denen Konrad Adenauer als erster Bundeskanzler Deutschlands hervorging. Um das nationalsozialistische Gedankengut in der Bevölkerung zu ver- drängen, kontrollierte man besonders das Schulwesen. Die Schulbücher wurden geändert und de- ren Inhalt streng überwacht. Ebenso die Lebensläufe der Lehrer und deren Unterrichtsinhalte.[13] Im Mai 1949 trat das Grundgesetz als neue Verfassung für die Westzonen in Kraft.
[...]
[1] Hippler, Jochen: Nationbuilding, S. 19
[2] Vgl. Ferdowsi, Mir A./Matthies, Volker: Kriege, Kriegsbeendigung und Friedenskonsolidierung, S. 33 f
[3] Vgl. ebd. S. 35
[4] Vgl. Masala, Carlo: Protektorate erfolgreich managen ; in: Internationale Politik, S. 112 ff
[5] Vgl. Benz, Wolfgang: Potsdam 1945, S.36 ff
[6] Ebd. S. 117
[7] Vgl. Dobbins, James: America´s role in nationbuilding, S. 5
[8] Ebd. Benz, S. 70
[9] Vgl. ebd. Dobbins, S. 11
[10] Vgl. ebd. S. 13 f
[11] Ebd. Benz, S. 128
[12] Vgl. ebd., S: 126
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes?
Der Text behandelt das Thema Nationbuilding, insbesondere im Kontext des Wiederaufbaus von Deutschland und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg und im Vergleich zu aktuellen Herausforderungen.
Was sind die Hauptpunkte der Einleitung?
Die Einleitung umreißt die veränderten Herausforderungen der Sicherheitspolitik seit dem Ende des Kalten Krieges, wobei innerstaatliche Konflikte und nichtstaatliche Gewaltakteure in den Vordergrund rücken. Nationbuilding wird als Antwort auf diese Herausforderungen vorgestellt, mit Deutschland und Japan als Pionierprojekte. Die Frage, inwieweit diese Projekte als Prototypen für modernes Nationbuilding dienen können, wird aufgeworfen.
Welche Dimensionen des Nationbuilding werden im Text genannt?
Der Text nennt vier Dimensionen des Nationbuilding: sicherheitspolitische, politische, ökonomische und soziale/humanitäre.
Welche sicherheitspolitischen Maßnahmen werden im Text erwähnt?
Zu den sicherheitspolitischen Maßnahmen zählen Demilitarisierung, Demobilisierung, Reform der Sicherheitskräfte, Neuordnung der zivil-militärischen Beziehungen und die Herstellung eines legitimierten Gewaltmonopols.
Welche politischen Aspekte des Nationbuilding werden diskutiert?
Die politischen Aspekte umfassen die Schaffung einer neuen Nachkriegsordnung, die Machtaufteilung (insbesondere nach ethnischen Gesichtspunkten), die Schaffung funktionsfähiger Institutionen und Normen sowie die Säuberung und strafrechtliche Verfolgung von Kriegsverbrechern.
Welche ökonomischen Herausforderungen werden beim Nationbuilding genannt?
Ökonomisch geht es um den materiellen Wiederaufbau, die Umwandlung der Kriegswirtschaft in eine Friedensökonomie und die Versorgung der Bevölkerung.
Welche sozialen und humanitären Herausforderungen werden genannt?
Soziale und humanitäre Herausforderungen sind die Versorgung der Bevölkerung, die Rehabilitation und Reintegration von Kriegsopfern und Flüchtlingen, die Überwindung von Kriegstraumata und die Wiederherstellung von Vertrauen und sozialen Netzwerken.
Welche Faktoren beeinflussen den Erfolg von Nationbuilding laut Carlo Masala?
Carlo Masala nennt drei Faktoren: die Akzeptanz der fremden Mächte durch die Bevölkerung, die Spill-over-Effekte der Nachbarstaaten und die Überzeugung der Bevölkerung, dass die Anwesenheit des Protektors zeitlich begrenzt ist.
Wie war Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg aufgeteilt?
Deutschland war in vier Zonen aufgeteilt: eine britische, eine amerikanische, eine französische im Westen und eine russische im Osten.
Welche Schritte wurden unternommen, um Deutschland nach dem Krieg zu entnazifizieren?
Die NSDAP wurde aufgelöst, alle politischen und gesetzlichen Strukturen wurden zerstört, Führungskräfte des Naziregimes wurden verhaftet und in Nürnberg vor Gericht gestellt. Es gab auch Tribunale auf unteren Ebenen.
Welche Rolle spielten die Alliierten beim Wiederaufbau der deutschen Verwaltung?
Die Alliierten übergaben die Verwaltung und Regierungstätigkeiten schrittweise an die deutsche Bevölkerung, zunächst auf Länderebene. Sie förderten die Entstehung demokratischer Parteien und die Durchführung von Wahlen.
Welche Rolle spielte das Schulwesen bei der Denazifizierung?
Das Schulwesen wurde streng kontrolliert. Schulbücher wurden geändert, und die Lebensläufe der Lehrer sowie deren Unterrichtsinhalte wurden überwacht, um das nationalsozialistische Gedankengut zu verdrängen.
- Quote paper
- Katrin Westhäußer (Author), 2006, Nationbuilding in Deutschland und Japan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177386