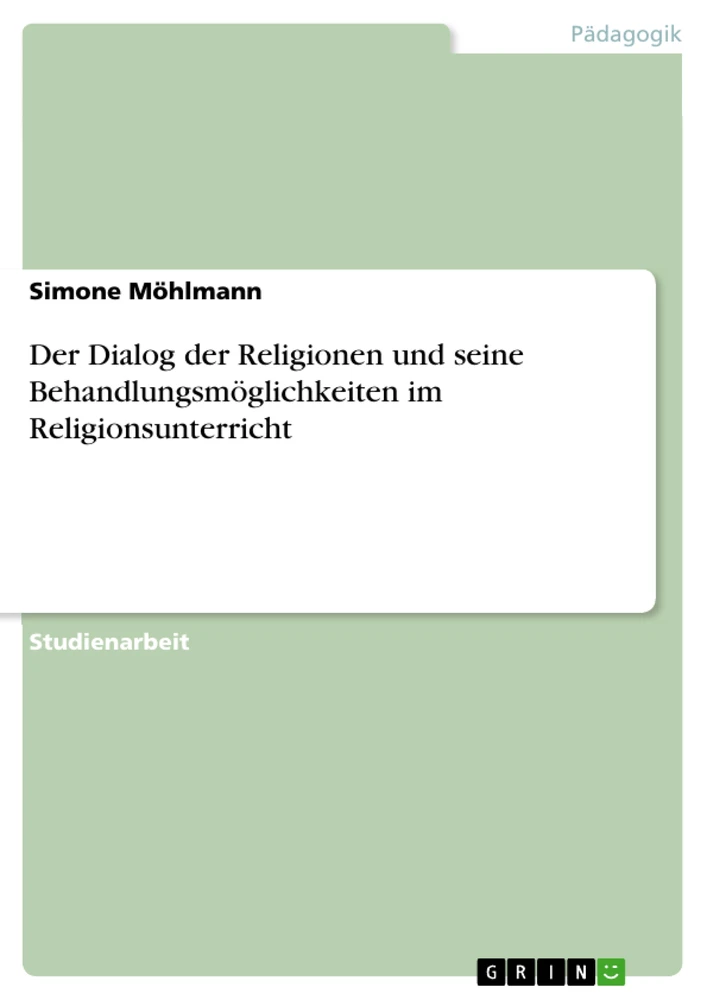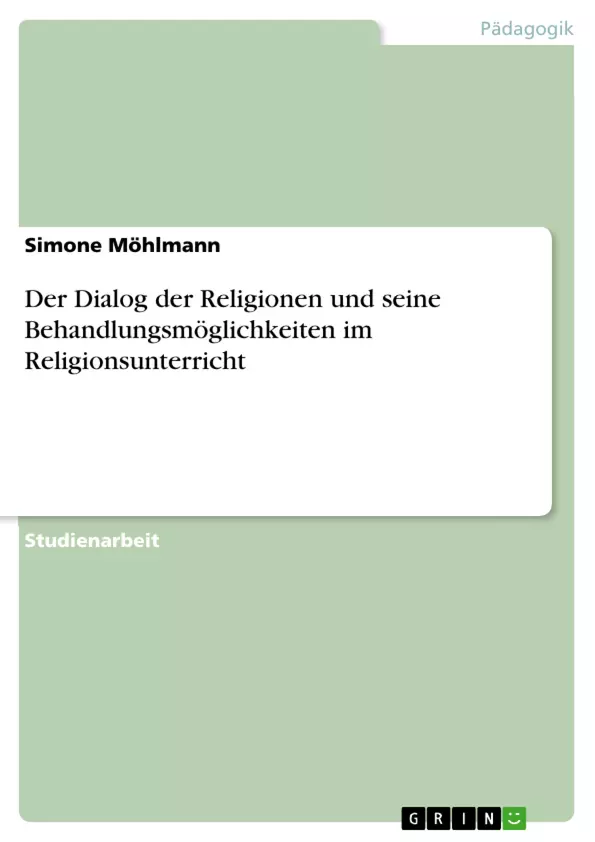Spätestens seit dem 11. September 2001 ist deutlich geworden, wie aktuell der Machtkampf der Religionen auch in der heutigen Zeit noch ist. Deswegen ist es wichtig, schon auf kleinerer Ebene Toleranz und Akzeptanz zu fördern und auszuüben. Betrachtet man den Pluralismus der Religionen in den Klassenzimmern, eröffnet sich eine Notwendigkeit, die verschiedenen Religionen vorzustellen und zu diskutieren, um Verständnis füreinander zu erreichen und Spannungen abzubauen. Dies ist kein neues Thema für den evangelischen Religionsunterricht, denn schon in der Stellungnahme der EKD von 1971 wird eine „Auseinandersetzung mit nichtchristlichen Religionen und nichtreligiösen Überzeugungen“ gefordert.
Die im Jahr 1778/79 in Wolfenbüttel erschienene Ganzschrift Nathan der Weise von Gotthold Ephraim Lessing stellt auf anschauliche Art und Weise die Spannungen zwischen Christen, Muslimen und Juden dar und ist damit „trialogisch“ strukturiert. Das Theaterstück zu Lessings Drama Nathan der Weise, welches am 14. April 1779 in Berlin uraufgeführt wurde, gewann nach dem 11. September 2001 plötzlich brennende Aktualität als Reaktion auf die Anschläge auf die USA. In dem dramatischen Gedicht wird eine Ideallösung des Miteinanders von Christen, Juden und Muslimen eröffnet, wie sie einfacher nicht sein könnte.
Dazu analysiere ich zuerst die Bedeutung der Methode der Ganzschrift im Religionsunterricht und zeige mögliche Grenzen und Probleme auf. In der thematischen Dimension gehe ich zuerst auf die Bedeutung der Thematik der Weltreligionen im Religionunterricht ein, bevor ich mich auf die Behandlung des dramatischen Gedichts Nathan der Weise im Religionsunterricht beziehe. Hierzu nehme ich zunächst auf das im Drama dargestellte Bild der drei Weltreligionen Bezug, ehe ich die Ringparabel und das Schlussbild des Dramas in ihrer Toleranzdimension entfalte. Abschließend sollen auch die Grenzen dieser Idealform aufgezeigt werden. Als Alternativlektüre stelle ich zum Schluss Mirjam Presslers Roman Nathan und seine Kinder vor. Hierzu arbeite ich die wesentlichen Unterschiede zwischen beiden Werken heraus, bevor ich die Umsetzung des Toleranzgedankens im Roman untersuche. Zum Abschluss dieses Vergleichs werde ich dann die Ergebnisse zusammentragen und zu einem Schluss kommen, inwiefern Presslers Roman eine Alternative zu seinem Original Nathan der Weise bieten kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Didaktische Dimension
- Die Ganzschrift im Religionsunterricht
- Grenzen und Probleme innerhalb der Klassenlektüre
- Thematische Dimension
- Das Thema Christentum und andere Religionen im Religionsunterricht der Sekundarstufe II
- Nathan der Weise im Religionsunterricht
- Das Bild des Juden im Drama
- Das Bild des Christen im Drama
- Das Bild des Muslimen im Drama
- Zusammenfassung
- Kritik
- Der Weg zur Toleranz
- Die Ringparabel
- Die Liebe als Schlüssel zur Toleranz
- Kritik
- Grenzen der Toleranz
- Zusammenfassung
- Mirjam Presslers Roman Nathan und seine Kinder
- Unterschiede zu Lessings Drama
- Die Umsetzung des Toleranzgedankens
- Eine Alternative zu Lessing?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die didaktische und thematische Dimension des Dramas „Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim Lessing im Kontext des Religionsunterrichts. Sie analysiert die Relevanz des Dramas für die Vermittlung von Toleranz und Akzeptanz gegenüber anderen Religionen und beleuchtet die Einsatzmöglichkeiten der Ganzschriftmethode im Unterricht.
- Die Bedeutung der Ganzschriftmethode im Religionsunterricht
- Die Darstellung von Christentum, Judentum und Islam im Drama „Nathan der Weise“
- Die Ringparabel als Symbol für Toleranz und Dialog
- Die Grenzen und Herausforderungen der Toleranz
- Der Vergleich des Toleranzgedankens in Lessings Drama mit Mirjam Presslers Roman „Nathan und seine Kinder“
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung, die die Aktualität des Themas Toleranz im Kontext von Religionsdialog und interreligiösem Verständnis beleuchtet. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der didaktischen Dimension der Ganzschriftmethode und ihren Vor- und Nachteilen im Religionsunterricht. Im dritten Kapitel wird die thematische Dimension des Dramas „Nathan der Weise“ beleuchtet und die Darstellung der verschiedenen Religionen im Stück analysiert. Das vierte Kapitel widmet sich der Ringparabel und dem Schlussbild des Dramas im Hinblick auf die Frage, wie Toleranz erreicht werden kann. Das fünfte Kapitel schließlich vergleicht Lessings Werk mit Mirjam Presslers Roman „Nathan und seine Kinder“ hinsichtlich der Umsetzung des Toleranzgedankens.
Schlüsselwörter
Religionsunterricht, Ganzschrift, Toleranz, Interreligiöser Dialog, Nathan der Weise, Ringparabel, Mirjam Pressler, Nathan und seine Kinder, Christentum, Judentum, Islam.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Ringparabel in "Nathan der Weise"?
Die Ringparabel ist ein Plädoyer für religiöse Toleranz. Sie zeigt, dass keine der drei Weltreligionen (Judentum, Christentum, Islam) einen exklusiven Anspruch auf die Wahrheit beweisen kann, sondern sich durch gelebte Menschenliebe beweisen muss.
Warum ist "Nathan der Weise" im Religionsunterricht aktuell?
Besonders nach den Ereignissen des 11. Septembers bietet das Drama eine Grundlage, um über religiösen Pluralismus, Vorurteile und friedliches Miteinander zu diskutieren.
Was ist der Unterschied zwischen Lessings Drama und Mirjam Presslers Roman?
Presslers "Nathan und seine Kinder" erzählt die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven und beleuchtet die Charaktere und Konflikte moderner und kritischer als das Original.
Was versteht man unter der "Ganzschriftmethode"?
Dabei wird ein komplettes literarisches Werk im Unterricht gelesen und analysiert, statt nur Auszüge zu behandeln.
Wo liegen die Grenzen der Toleranz im Drama?
Die Arbeit diskutiert, dass die im Drama dargestellte Ideallösung in der Realität oft an tief verwurzelten religiösen Machtkämpfen und Dogmen scheitert.
- Quote paper
- Simone Möhlmann (Author), 2011, Der Dialog der Religionen und seine Behandlungsmöglichkeiten im Religionsunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177545