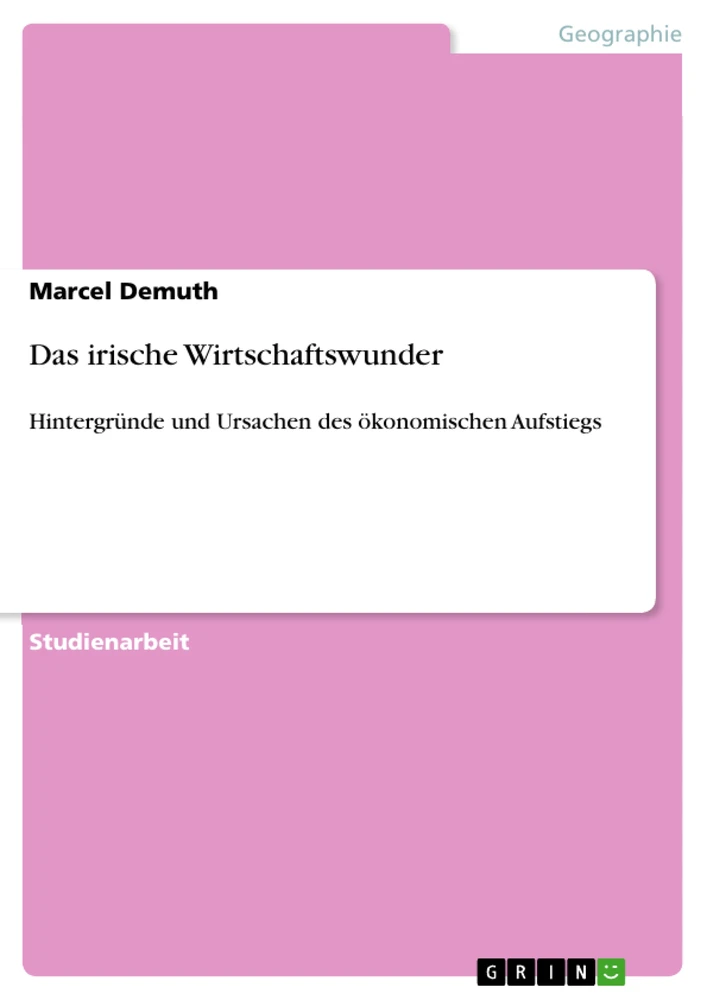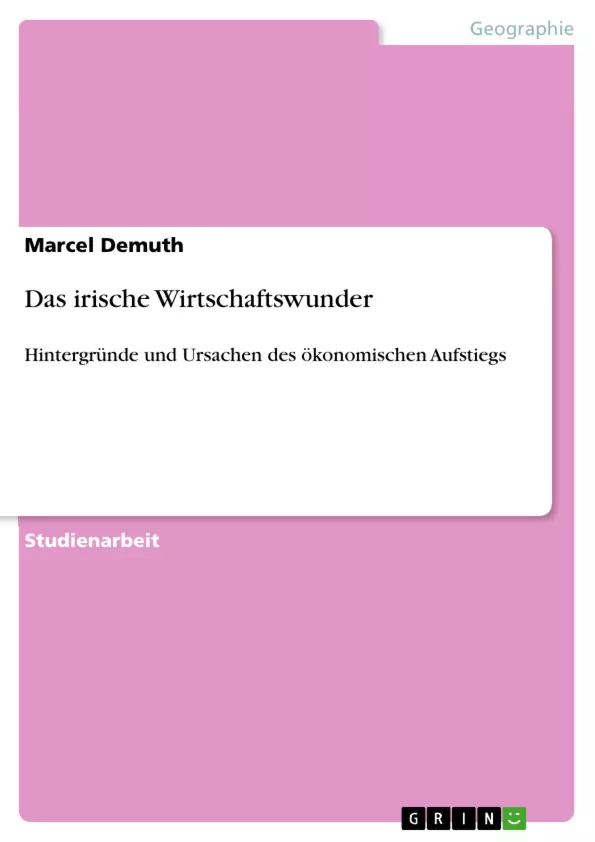Irland, einst das Armenhaus Europas, vollzog binnen drei Jahrzehnten einen unvergleichli-chen wirtschaftlichen Wandel, in Folge dessen es zu einem der prosperierendsten Länder der europäischen Familie aufstieg. Mit unvorstellbaren Wachstumsraten in den 90er Jahren erinnerte das irische Wirtschaftswachstum an die Entwicklung der asiatischen Tigerstaaten, was dazu führte, dass Irland unter dem Synonym „Keltischer Tiger“ in aller Munde war (FINK, 2008; GLEBE, 2000; KROENIG, 1996; MÜLLER, 1999). Doch was brachte dieses kleine, an der äußersten europäischen Peripherie gelegene Land auf diese Erfolgsspur? Bis vor wenigen Jahren wurde Irland, ging es um Europa, gern vergessen. Zum einen schien es irgendwie zu Großbritannien zu gehören, zum anderen galt es auf Grund seiner Traditionalität, seiner strukturellen und räumlichen Benachteiligungen und mangelnder Dynamik in der Entwicklung als „Outpost of Europe“ (KOSSDORF, 2000, S. 167). Grundsätzlich wird angenommen, dass der Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft (EG) 1973 einen großen Teil zum wirtschaftlichen Aufschwung des Landes beigetrug. Inwieweit dies zutrifft und welche weiteren Faktoren diesbezüglich zur Diskussion gebracht werden, ist Inhalt dieser Arbeit. Um dies zu thematisieren, wird zunächst die wirtschaftliche Entwicklungsgeschichte Irlands dargestellt. Hierbei wird Bezug auf die historische ökonomische Ausgangssituation und die wirtschaftliche Entwicklung in den Nachkriegsjahren bis zum EG-Beitritt genommen, um anschließend den Wandel der Wirtschaft seit der Integration in die europäische Gemeinschaft im Detail zu beleuchten. Schlussendlich wird ein kritisches Fazit über die zurückliegende Entwicklung gezogen, u.a. unter Berücksichtigung der aktuellen Situation.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Perspektive – die irische Wirtschaft bis 1973.
- Die irische Wirtschaft nach der europäischen Integration
- Der Beitritt 1973 und die krisengeprägten 80er Jahre......
- Die irische Erfolgsgeschichte ab den 90er Jahren...
- Ursprung des rasanten Aufstiegs - mögliche Wachstumsdeterminanten und deren Bedeutung.
- Wirtschafts- und Industriepolitik – the Industrial Development Authority.
- Ausländische Direktinvestitionen – transnationale Unternehmen als Motor der Entwicklung.............
- Beschäftigungsbezogene Ursachen - der Sozialpakt und die Arbeitsmarktstruktur ....
- Die Bedeutung der EU – Subventionen
- Ein kritisches Fazit der Entwicklungen - Nachhaltigkeit versus Abhängigkeit ........
- Zusammenfassung....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den wirtschaftlichen Aufstieg Irlands von den Nachkriegsjahren bis zur Finanzkrise 2008, wobei insbesondere die Bedeutung der europäischen Integration untersucht wird. Ziel ist es, die Ursachen des „Irischen Wirtschaftswunders“ zu beleuchten und die Nachhaltigkeit des Wirtschaftswachstums zu bewerten.
- Die ökonomische Entwicklung Irlands im Kontext der historischen Situation und der Rolle des EG-Beitritts.
- Analyse der wichtigsten Wachstumsfaktoren, darunter Wirtschaftspolitik, ausländische Direktinvestitionen und die Rolle der Europäischen Union.
- Bewertung der Nachhaltigkeit des Wirtschaftswachstums und der Abhängigkeit Irlands von externen Faktoren.
- Beurteilung der Auswirkungen der Finanzkrise auf die irische Wirtschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung liefert einen Überblick über die Arbeit und stellt die zentrale Fragestellung dar: Was waren die Ursachen für das „Irische Wirtschaftswunder“?
- Das zweite Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der irischen Wirtschaft bis 1973, wobei die ökonomische Ausgangssituation und die Nachkriegsjahre im Fokus stehen.
- Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die wirtschaftliche Entwicklung Irlands nach dem Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft 1973. Dabei werden sowohl die Herausforderungen der 80er Jahre als auch die Erfolgsgeschichte ab den 90er Jahren beleuchtet.
- Im vierten Kapitel werden die wichtigsten Wachstumsdeterminanten analysiert, darunter Wirtschaftspolitik, ausländische Direktinvestitionen und die Rolle der EU-Subventionen.
Schlüsselwörter
Irisches Wirtschaftswunder, Wirtschaftswachstum, Europäische Integration, EG-Beitritt, ausländische Direktinvestitionen, Industrial Development Authority, EU-Subventionen, Nachhaltigkeit, Abhängigkeit, Finanzkrise.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff „Keltischer Tiger“?
Dieser Begriff beschreibt die Phase des rasanten Wirtschaftswachstums in Irland während der 1990er Jahre, vergleichbar mit den asiatischen Tigerstaaten.
Welche Rolle spielte der EU-Beitritt für Irlands Aufstieg?
Der Beitritt zur EG 1973 ermöglichte den Zugang zum Binnenmarkt und brachte erhebliche EU-Subventionen, die die Infrastruktur und Entwicklung förderten.
Warum investierten so viele transnationale Unternehmen in Irland?
Ausschlaggebend waren eine gezielte Industriepolitik der Industrial Development Authority, niedrige Unternehmenssteuern und eine gut ausgebildete, englischsprachige Arbeitnehmerschaft.
Wie wirkte sich die Finanzkrise 2008 auf das Wirtschaftswunder aus?
Die Krise beendete den Boom abrupt und legte die Abhängigkeit Irlands von externen Investitionen und einem überhitzten Immobilienmarkt offen.
War das irische Wachstum nachhaltig?
Die Arbeit zieht ein kritisches Fazit und diskutiert das Spannungsfeld zwischen echtem wirtschaftlichem Fortschritt und der Abhängigkeit von globalen Konzernen.
- Arbeit zitieren
- B.Sc. Marcel Demuth (Autor:in), 2011, Das irische Wirtschaftswunder, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177575