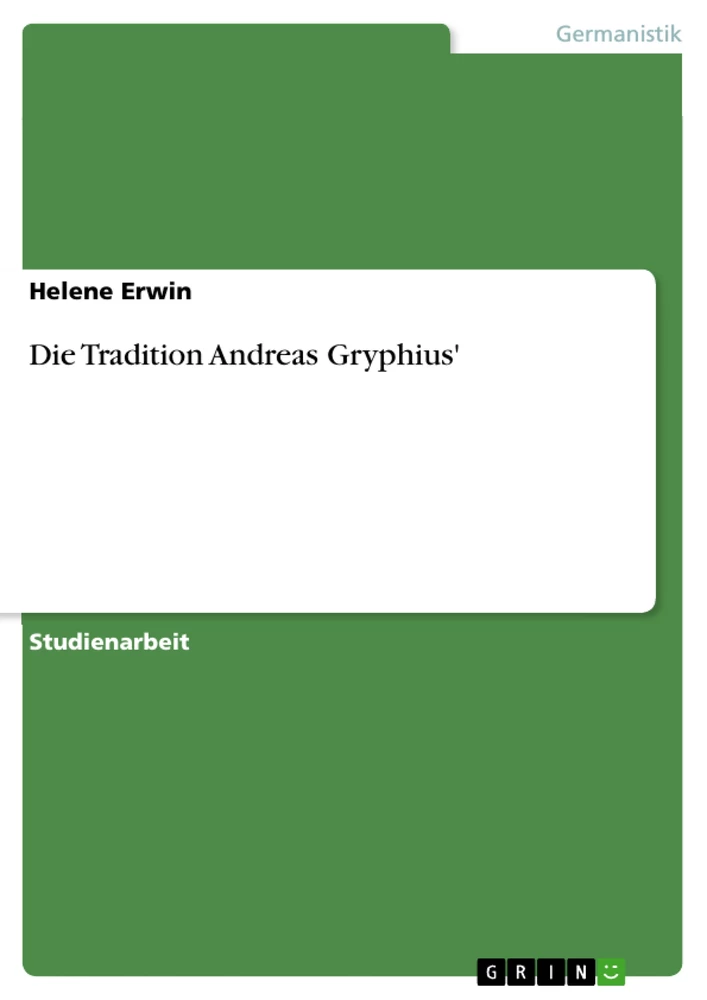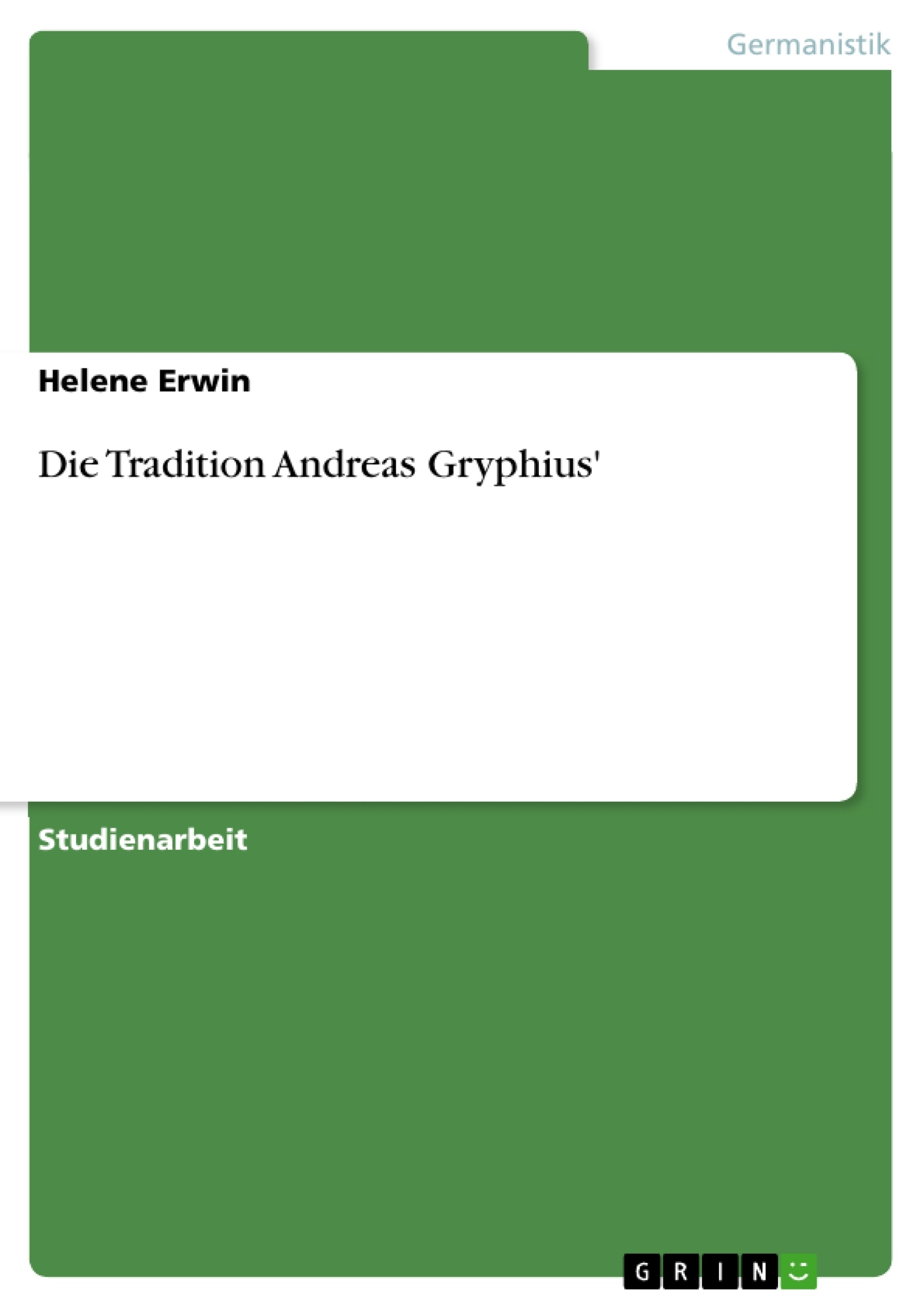Die Gryphius-Werke, vor allem die Trauerspiele, waren geprägt von Not, Elend, Zerstörung und Verwüstung, die sich aus dem Drei?igjährigen Krieg, der damit verbundenen Pest, Plünderung, Hungersnot und Vernichtung entwickelt haben. 6
Mit 12 Jahren war Andreas Gryphius Vollwaise und auf die Hilfe von seinem Stiefvater, Michael Eder und anderen nahestehenden Menschen angewiesen, die unter dem „Zwang der Rekatholisierung“ 7 litten.
Gryphius ist ein typisch Barockzeit Lyriker gewesen - ein Mitproduzent der damaligen Stimmungslage. Die Vergänglichkeitstrauer und die irdische Existenz als Qual ist kein unübliches Thema in der Zeit gewesen. Hierbei wird das Klagen als „einzige poetische Möglichkeit fixiert“ 8 .
Die Kirchhofs-Gedanken wurden 1657 erstmalig veröffentlicht, doch vermutlich wurden sie zwischen 1650 und 1656 geschrieben. 9
Die ausführliche, metaphorischen, aber auch direkten Schilderung von Gerippen und verwesten Leichen bestimmt die Kirchhofs-Gedanken, aber auch die Rhythmik und die Strophengstaltung sind gebräuchliche Stilmittel in diesem Jahrhundert gewesen.
Inhaltsverzeichnis
- Die Tradition des Andreas Gryphius-Werks
- Die Kurzbiographie
- Die Einflüsse
- Das Vanitas-Motiv
- Der Aufbau
- Die Symbole
- Der Nachruf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert das Werk des deutschen Barockdichters Andreas Gryphius, insbesondere dessen Gedichtband "Kirchhofs-Gedanken". Ziel ist es, Gryphius' Leben, Werk und Einfluss auf die Literatur seiner Zeit zu beleuchten. Der Fokus liegt dabei auf der Vergänglichkeit des Lebens und dem Einfluss des Dreißigjährigen Krieges auf Gryphius' Schaffen.
- Gryphius' Lebensgeschichte und dessen Werk im Kontext der Barockzeit
- Die Rolle des Dreißigjährigen Krieges in Gryphius' Werken
- Das Vanitas-Motiv in der Literatur des 17. Jahrhunderts
- Die Verwendung von Symbolen und Metaphern in Gryphius' "Kirchhofs-Gedanken"
- Die Bedeutung des Nachrufs für Gryphius' literarisches Erbe
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Kurzbiographie: Der Text beschreibt Gryphius' Leben, seine schwierige Kindheit und sein Studium an den Universitäten Leiden und Straßburg. Hierbei wird besonders sein Interesse an der Medizin und seine Tätigkeit als Jurist hervorgehoben.
- Die Einflüsse: Dieses Kapitel beleuchtet die Einflüsse auf Gryphius' Werk, insbesondere den Dreißigjährigen Krieg, dessen Zerstörungen und Not die Grundlage für seine tragischen Werke bildeten. Auch die Vergänglichkeitstrauer und die irdische Existenz als Qual werden als zentrale Themen der Barockzeit behandelt.
- Das Vanitas-Motiv: Hier werden die Hintergründe des Vanitas-Motivs ("Alles ist eitel/nichtig") im 17. Jahrhundert erläutert, das die Vergänglichkeit des Lebens und die Schönheit des Todes als Gegenpol zum irdischen Sein betont. Der Kirchhof wird als Symbol für die Vergänglichkeit und als "Schule des Sterbens" interpretiert. Gryphius' Werke erinnern den Leser an die eigene Sterblichkeit und fordern zur Reflexion über das Leben und den Tod auf.
- Der Aufbau: Der Text beschreibt den Aufbau und die Besonderheiten von Gryphius' Werken, die durch Paradoxien, Antithesen und die Variation des Versmaßes geprägt sind. Hier wird auch die Struktur der "Kirchhofs-Gedanken" mit 50 Alexandrinerstrophen und dem Reimschema abbacddc erläutert.
- Die Symbole: Dieses Kapitel behandelt die in Gryphius' Werken verwendeten Vanitas-Symbole, wie den Totenschädel, Musikinstrumente, das leere Schneckenhaus, Laster wie Trunkenheit und Eitelkeit, sowie die schnell vergehende Schönheit der Natur. Hier werden auch Beispiele aus Gryphius' Werk "Menschliches Elend" angeführt, die die zentralen Vanitas-Themen veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Andreas Gryphius, Barock, "Kirchhofs-Gedanken", Vanitas, Memento mori, Vergänglichkeit, Tod, Dreißigjähriger Krieg, Symbolismus, Metapher, Alexandriner, Nachruf, Daniel Casper von Lohenstein.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Andreas Gryphius?
Andreas Gryphius (1616–1664) war einer der bedeutendsten deutschen Lyriker und Dramatiker der Barockzeit, bekannt für seine Trauerspiele und Sonette.
Was ist das zentrale Thema der „Kirchhofs-Gedanken“?
Das Werk thematisiert die Vanitas (Vergänglichkeit), das Memento Mori (Gedenke des Todes) und das menschliche Elend angesichts der Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges.
Welche Rolle spielte der Dreißigjährige Krieg für Gryphius' Werk?
Die Erfahrungen von Hunger, Pest, Plünderung und Tod prägten seine düstere Weltsicht und machten das Klagen über die irdische Existenz zu einem zentralen Motiv seiner Dichtung.
Was kennzeichnet den barocken Schreibstil von Gryphius?
Typisch sind die Verwendung des Alexandriners, starke Antithetik (Gegensätze wie Leben/Tod, Schein/Sein) sowie eine drastische, metaphorische Bildsprache (z.B. verweste Leichen).
Was bedeutet das Vanitas-Motiv?
Vanitas bedeutet „Eitelkeit“ oder „Nichtigkeit“. Es erinnert daran, dass alles Irdische vergänglich ist und nur das jenseitige Leben ewigen Bestand hat.
- Citation du texte
- Master of Education Helene Erwin (Auteur), 2003, Die Tradition Andreas Gryphius', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177652