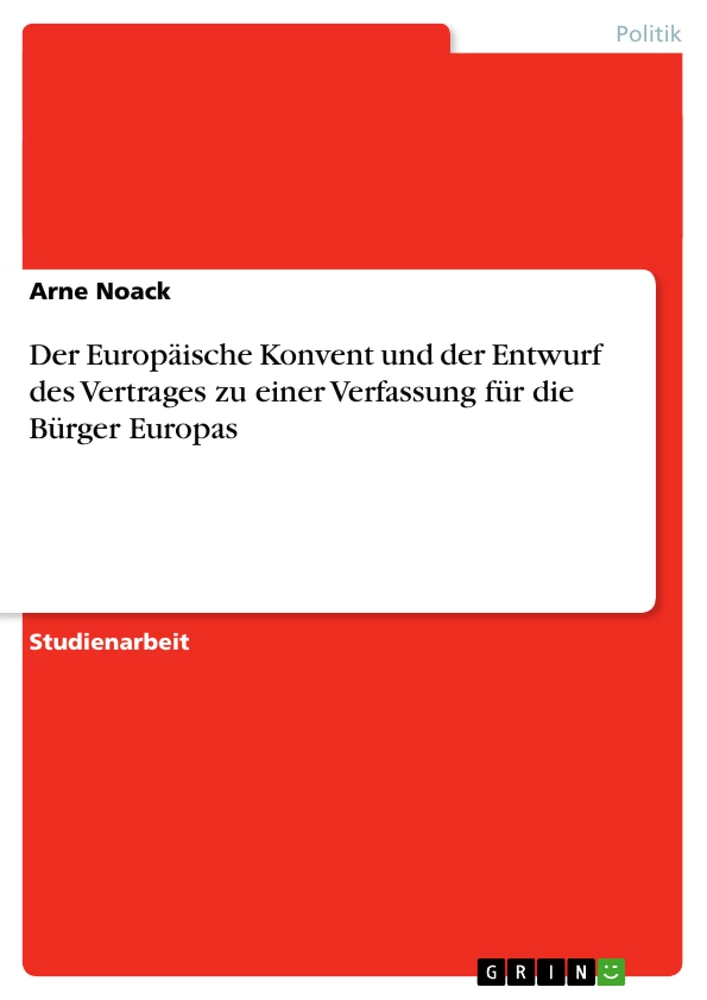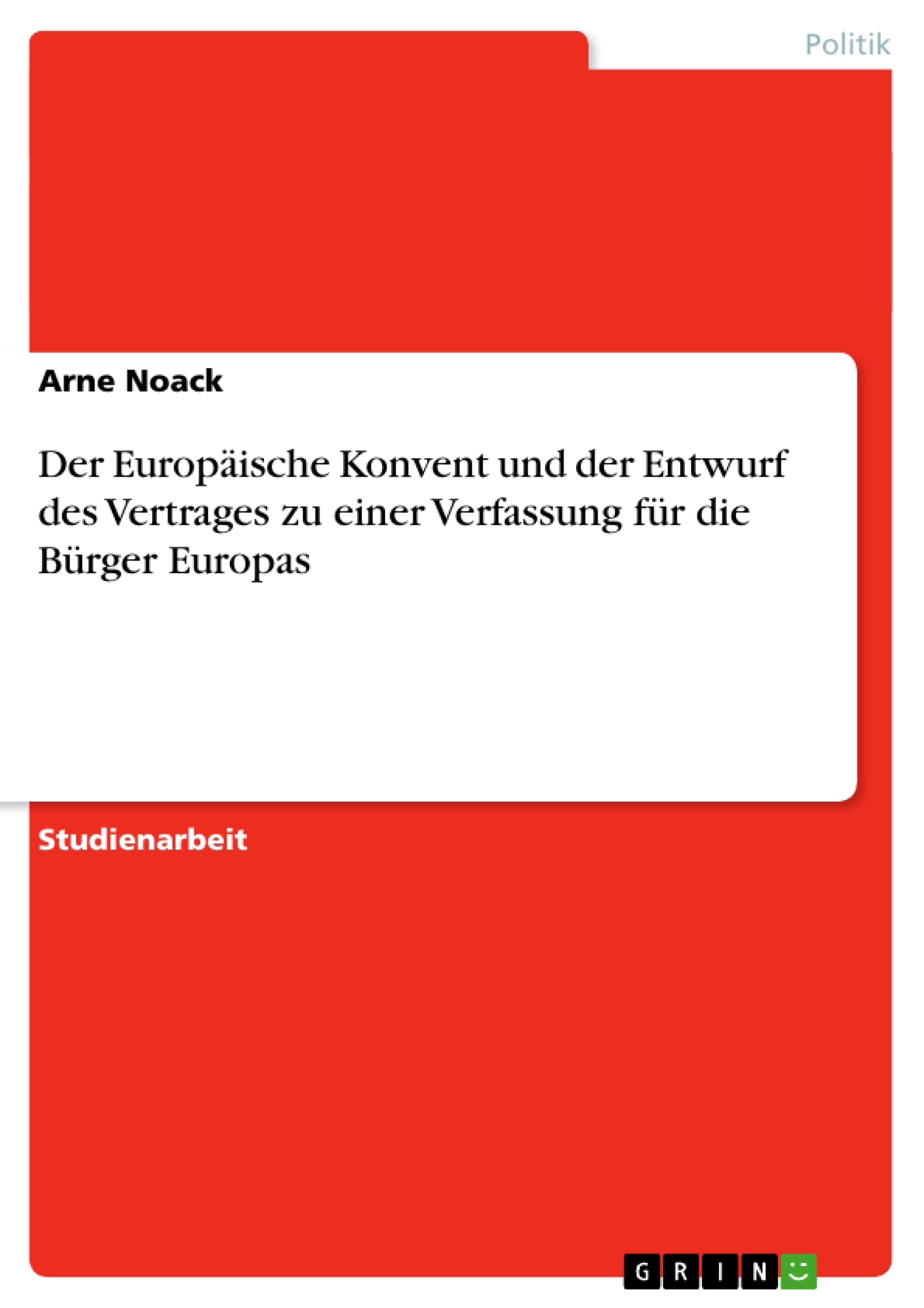Kurze Einführung in die Geschichte der Europäischen Integration Seit Ende des zweiten Weltkrieges haben die politischen Führer der europäischen Staaten daran gearbeitet die Kluft zwischen den Nationen abzubauen und die Verständigung zwischen den Völkern zu stärken. Der erste große Schritt wurde bereits 1949 mit der Gründung des Europarates getan.
Robert Schuman beschleunigte 1950 zusammen mit seinem Landsmann Jean Monnet die Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland und legte mit seinem Plan zur Montanunion den Grundstein zur Europäischen Integration. 1951 trat der Vertrag über die Europäische Gemeinschaft betreffend die Kohle und Stahlproduktion (EGKS) in Kraft. Auf der Grundlage wirtschaftlicher Interessen und Zusammenarbeit entstanden in den folgenden Jahren verschiedene europäische Gemeinschaften.
Die Römischen Verträge schufen 1958 zwei weitere Gemeinschaften, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM). Diese drei Gemeinschaften existierten zu Beginn parallel ohne gegenseitige Koordinierung, bis sie 1967 zur EG zusammengefasst und vier gemeinsame Organe geschaffen wurden. Sie bestehen aus dem Europäischen Rat, der Kommission, dem Europäischen Parlament, für das es 1979 erste Direktwahlen gab, und dem Europäischen Gerichtshof. Aus der Erkenntnis heraus, dass eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit einen möglichst einheitlichen Binnenmarkt erfordert, wurde 1986 die Einheitliche Europäische Akte ins Leben gerufen, die erste Ansätze zur gemeinsamen Wirtschafts- und Währungspolitik enthielt. Mit den Verträgen von Maastricht (1991) und Amsterdam (1998) wurde die EG endgültig in die Europäische Union umgewandelt und die gemeinsame Politik auf verschiedene Bereiche ausgeweitet. Mit ihr wurde auch die Vorstellung einer einheitlich europäischen Wirtschafts-und Währungspolitik Wirklichkeit, aus welcher der am 1. Januar 1999 eingeführte EURO hervorging.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurze Einführung in die Geschichte der Europäischen Integration
- Die Idee der europäischen Verfassung
- Struktur und Arbeitsweise des Konvents zur Zukunft Europas
- Grundlegende Gedanken zur Arbeit des Konvents
- Zusammensetzung des Konvents
- Organisation der Arbeit des Konvents
- Plenartagungen
- Der Jugendkonvent
- Außenstehende Institutionen zur Arbeit des Konvents
- Der Deutsche Bundesrat
- CONCORD
- Der Vertrag und die Neuerungen in der Organisation der Union
- Grundsätze
- Aufbau des Vertrags
- Änderungen an der Struktur der EU
- Graphische Übersicht
- Der Verfassungsvertrag und EURATOM
- Nicht aufgenommene Änderungsvorschläge
- Anmerkungen
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text zielt darauf ab, die Arbeitsweise des Europäischen Konvents zu analysieren, die Reaktionen auf seine Arbeit zu beleuchten und das erzielte Resultat, sowie die vorgenommenen Änderungen darzustellen. Die Arbeit des Konvents konzentriert sich auf die Ausarbeitung einer europäischen Verfassung, die die Europäische Union stärken und die Effizienz ihrer Institutionen gewährleisten soll.
- Die Notwendigkeit einer europäischen Verfassung als Grundlage für die supranationale Institution der EU.
- Die Herausforderungen einer erweiterten Europäischen Union im Kontext der globalisierten Welt.
- Die Reform des organisatorischen Schemas der EU, um die Effizienz und Handlungsfähigkeit zu gewährleisten.
- Die Stärkung der Demokratie, Transparenz und Effizienz in der EU durch verbesserte Entscheidungsstrukturen.
- Die Einbindung der nationalen Parlamente in die Legitimation des europäischen Projekts.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen kurzen Überblick über die Geschichte der Europäischen Integration und die Entstehung der Idee einer europäischen Verfassung. Sie beleuchtet die Notwendigkeit einer solchen Verfassung im Hinblick auf die Herausforderungen einer erweiterten EU. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Struktur und Arbeitsweise des Konvents. Es behandelt die Grundlegenden Gedanken, die Zusammensetzung und die Organisation der Arbeit des Konvents. Der Text beleuchtet auch die Rolle von Außenstehenden Institutionen wie dem Deutschen Bundesrat und CONCORD. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf den Vertrag und die Neuerungen in der Organisation der EU, die durch den Konvent erarbeitet wurden. Es analysiert die Grundsätze, den Aufbau des Vertrags, die Änderungen an der Struktur der EU, die graphische Übersicht sowie die nicht aufgenommenen Änderungsvorschläge.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Europäische Verfassung, Europäische Integration, Europäischer Konvent, Struktur der EU, Reform, Institutionen, Erweiterung, Demokratie, Transparenz, Effizienz.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel des Europäischen Konvents?
Das Ziel war die Ausarbeitung eines Entwurfs für einen Vertrag über eine Verfassung für Europa, um die EU effizienter, transparenter und demokratischer zu gestalten.
Wer war an der Zusammensetzung des Konvents beteiligt?
Der Konvent setzte sich aus Vertretern der nationalen Regierungen, der nationalen Parlamente, des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission zusammen.
Welche historischen Meilensteine der EU werden erwähnt?
Erwähnt werden unter anderem der Schuman-Plan (1950), die Römischen Verträge (1958), der Vertrag von Maastricht (1991) und die Einführung des Euro (1999).
Was ist der Jugendkonvent?
Der Jugendkonvent war eine Initiative, um junge Bürger in den Diskurs über die Zukunft der europäischen Verfassung einzubinden.
Welche Rolle spielte der Deutsche Bundesrat im Konvent?
Als außenstehende Institution begleitete der Deutsche Bundesrat die Arbeit des Konvents kritisch und brachte regionale sowie föderale Interessen in den Prozess ein.
- Quote paper
- Arne Noack (Author), 2003, Der Europäische Konvent und der Entwurf des Vertrages zu einer Verfassung für die Bürger Europas, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17768