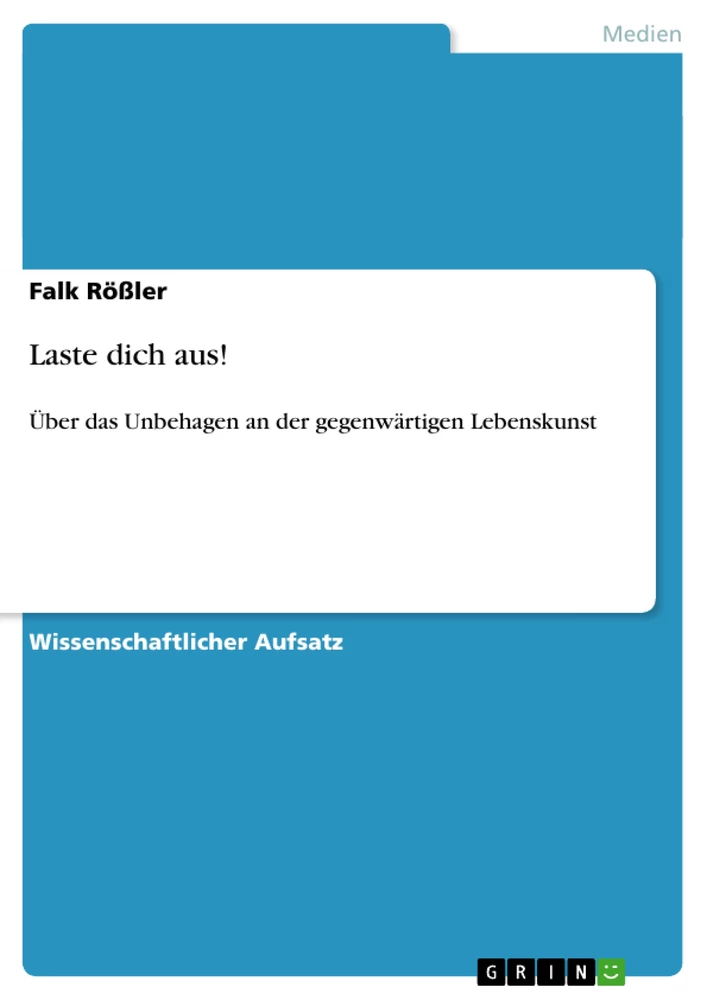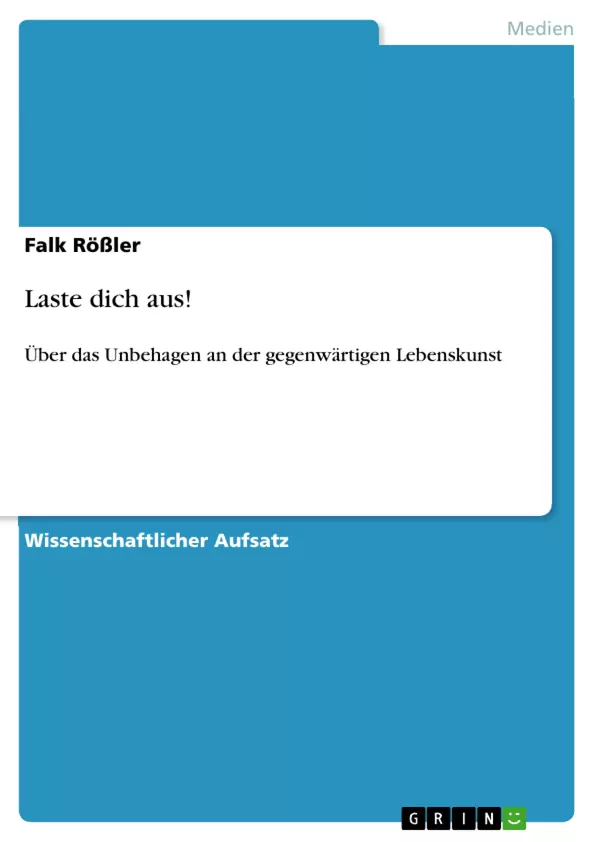Seit ein paar Jahrzehnten ist insbesondere in Ländern der „westlichen Welt“ ein beständiges Anwachsen des Segments der Lebenshilfeliteratur zu beobachten. Überhaupt scheint sich die Lebenskunst mit ihren Entwürfen vom gelingenden Leben des Einzelnen seit einiger Zeit wieder großer Beliebtheit zu erfreuen. Es mangelt nicht an Konzepten, Strategien und Rezepten für ein vermeintlich zuverlässiges Erreichen des individuellen Glücks.
Die Lebenskunst der Gegenwart ist jedoch nur noch selten Kern philosophischer Bemühungen. Vielmehr ist sie mittlerweile zum Spezialgebiet für Disziplinen wie Psychologie, Biologie, Neurowissenschaften und Betriebwirtschaftslehre geworden. In ihren populären und finanziell oft äußerst einträglichen Ausformungen hat die zeitgenössische Lebenskunst eine ganz eigene Gattung hervorgebracht, in der das Individuum als starke, autarke Einheit gedacht wird, die unablässig an ihrer eigenen Optimierung arbeitet. Es gilt, Ressourcen des Selbst freizulegen und effektiv zu nutzen, sich möglichst perfekt auszubalancieren, den Zufall zu überwinden und schließlich das totale Glück durch eigene, bewusste Bemühungen herbeizuführen.
Neben den deutlichen Übertreibungen und Vereinseitigungen, mit denen diese Konzepte gespickt sind, scheinen die hier vertriebenen Ratschläge an den Einzelnen noch in anderer Hinsicht problematisch zu sein. Denn das Selbst, das sich durch Optimismustraining, Gefühlskontrolle und das Ausschöpfen des eigenen Humankapitals maximal selbst optimiert, passt auch ganz vorzüglich in das Menschenbild politischer und wirtschaftlicher Kalküle, die neuerlich verschärfte gesellschaftsweite Probleme auf den Einzelmenschen und dessen „Eigenverantwortung“ umzulegen gedenken. Zu fragen wäre dann, inwieweit die gegenwärtigen Selbstsorge-Konzepte von solchen gesellschaftlichen Entwicklungen durchdrungen sind und worauf diese vermeintlichen Glücksstrategien die Individuen eigentlich vorbereiten und ausrichten wollen.
Gerade Michel Foucaults Konzept der Gouvernementalität eröffnet die Möglichkeit, die aktuelle Konstellation zwischen dem Individuum, der Gesellschaft und den in ihr zirkulierenden Lebenskunstentwürfen in der angemessenen Komplexität denken zu können.
In dem vorliegenden Text versuche ich, einige Linien dieses Gefüges zu skizzieren und widme mich dazu vor allem dem populären Genre der Glücksratgeber, um an ihm einige diesbezüglich markante Tendenzen herauszuarbeiten.
INTRO
Gibt es hier Wasser? Könnte ich bitte etwas Wasser bekommen?
Wir fangen auch sofort an. Tschuldigung, ich bin nur ein bisschen … durch den Wind. Bin gerade erst rein. Das sind gerade so verrückte Wochen. Also so verrückte Wochen. Das geht schon an die Substanz.
Ich muss gleich nachher auch noch was machen. Ich muss noch nen Vortrag schreiben für eine Tagung im Jemen. Da geht’s um den Klimawandel. Ist ein ernstes Thema. Dann hab ich diesen Empfang in Südfrankreich; Kunst. Da werd ich mich auch noch gleich schnell auf ein Mittagessen treffen mit nem guten Kollegen. In Zürich. Sport muss ich machen. Das mach ich immer morgens. Ja, und die Familie will einen ja auch noch irgendwann mal zu Gesicht bekommen. Und die Geliebte… Muss ja alles irgendwann gemacht werden.
Zwischendurch schreib ich noch zwei Konzepte; eins für diese Tombola-Tour durch die prekären Gebiete in der ostdeutschen Provinz. Das ist mir ne Herzensangelegenheit seit ich mir das damals mal auf der Durchreise angesehen habe. Und für so was gibt die EU ja auch richtig Schotter raus, wenn man’s clever anstellt - vor allem wenn das dann noch in der Nähe zu Polen ist…
Und dann noch ein Konzept für den Bundestag; „Kultur braucht Kapital“, heißt das. Ist voll finanziert. Muss man aber halt die richtige Idee zur richtigen Zeit haben, um an die Töpfe ranzukommen…
Ich komm aus dem Konzepte-Schreiben gar nicht mehr raus. Anträge und Konzepte. Ich mach eigentlich fast nichts anderes mehr. Jede bekloppte Idee - mach ich ’n Konzept draus. Muss man ja. Ohne Konzept geht heute gar nichts mehr. Deswegen gibt’s ja so viele.
Und dann hat man auch noch Freunde. So eine Freundschaft, die will ja gepflegt sein, sonst geht die ein, nicht? Das ist wie ein Pflänzchen, so muss man sich das vorstellen. Wie ein kleines, zartes Pflänzchen. Also, am Anfang. Und dann später eigentlich auch. Ich lerne deshalb auch ganz bewusst gar keine neuen Leute mehr kennen. Ich hätt eh keine Zeit, mich um die zu kümmern.
Ich habe auch - das wird Sie wahrscheinlich gar nicht interessieren - ich hab auch seit längerem schon den Wunsch, den Watzmann zu besteigen. Ich weiß auch nicht. Ist so ein Spleen von mir. Ich bin ja - das wussten Sie wahrscheinlich noch gar nicht - Mitglied im Deutschen Brombeerclub und wenn die Genossen, also die Mitglieder, also die Freunde, das sind ja alles Freunde, wenn die also dann davon erzählen, wie das ist auf dem Watzmann, auch auf anderen Bergen, aber eben doch vor allem auf dem Watzmann, dann werde ich da schon manchmal so sehnsüchtig, so sentimental, nicht? Doch, also der Watzmann, das wär schon was. Da hoch und dann mal so richtig durchatmen. Mal wieder zu sich selbst kommen. Auch so eine innere Ruhe finden. Gelassenheit. - Und dann halt wieder zurück.
Hm.
I. GLÜCK UND SO
Es lässt sich beobachten, dass die Frage nach dem Glück derzeit eine häufig gestellte ist. Ferner mangelt es nicht an Versuchen, diese Frage auch zu beantworten. Unsere Gegenwart ist geprägt von mannigfachen Äußerungen dazu, wie sich ein glückliches und erfülltes Leben führen lässt.
Die Orte und Arten der entsprechenden Entwürfe sind dabei sehr heterogen. Zeitgenössische Lebenskunst reicht von stark psychologisch geprägten Modellen nahezu totaler Machbarkeit über spirituelle Konzepte zur Erlangung innerer Kraft und Seelenruhe bis hin zur ausschweifenden Behandlung lebenspraktischer Probleme in der Populärkultur. Seit neuestem interessiert sich sogar die akademische Philosophie wieder verstärkt für dieses Feld, das sie einst im Zuge der Ausdifferenzierung einzelner Wissenschaftsbereiche aus den Augen verloren hatte.
Man könnte nun meinen, dass Menschen immer schon intensiv nach dem Glück gesucht hätten. Das führt dann zu so beliebten Einleitungssätzen wie: „Die Frage nach dem Glück ist so alt wie die Geschichte der Menschheit.“ Solche Äußerungen sind trügerisch. Sie suggerieren eine Kontinuität und Stabilität von menschlichen Problematisierungsstrategien, wobei unterzugehen droht, welch eklatante Unterschiede bei der Suche nach einem glückenden bzw. glücklichen Leben zwischen verschiedenen Kulturen und natürlich auch bereits innerhalb einer Kultur bestehen. Dementsprechend geht es mir an dieser Stelle auch darum, charakteristische Züge für gegenwärtige Glückskonzepte ausfindig zu machen, also solche Aspekte zu isolieren, die sich in vielen dieser Entwürfe wiederfinden. Denn so alt das Bestreben, eine Lebenskunst, also eine Strategie für den gelingenden Umgang mit der eigenen Existenz zu finden, auch sein mag, so speziell scheint mir doch das aktuelle Gefüge zu sein, das sich in den letzten, sagen wir, 50 Jahren um diesen traditionellen Topos herum gebildet hat.
Dieter Mersch zufolge orientiert sich die Kultur unserer Gegenwart an einer Kultivierung des Technischen im buchstäblichen Sinne: Techniken der Mobilität, der Lebensbequemlichkeit, der Mediatisierung und Speicherung aller möglichen Daten und Erfahrungen, der Erforschung immer tieferer Bereiche der Natur, um deren Verbesserung willen und um der Erzeugung und Reproduktion weiterer Techniken und aller möglichen Illusionen1.
Geführt wird hier - stark vereinfacht und mit den Worten Friedrich Nietzsches gesprochen - ein Kampf „um ‚Mehr’ und ‚Besser’ und ‚Schneller’ und ‚Öfter’“2.
In ihrer Fokussierung auf die Möglichkeiten zur Optimierung aller erdenklichen Lebensbereiche verdammt sich die heutige westliche Kultur dazu, sich ständig selbst übertreffen zu müssen. Daher muss man in ihr auch grundsätzlich davon ausgehen, dass die Dinge so, wie sie sind, nie gut genug sein können. In diesem Sinne besteht ein permanenter Handlungsbedarf, eine unablässige Aufforderung zur Tat - einer Tat, durch die Bestehendes zum Besseren verändert werden soll. In einer an Techniken und Technologien reichen Gegenwart fehlt es dann auch nicht an Mitteln und Wegen, solche Verbesserungsvorhaben in Angriff zu nehmen.
Zeitgenössische Lebenskunst ist von diesem Diktat des optimierenden Eingriffs nachhaltig geprägt. Entweder huldigt sie ihm rückhaltlos und weitet es bruchlos auf die Haltung des Einzelnen zu sich selbst aus („Holen Sie das Beste aus sich heraus und werden Sie der Mensch, der Sie immer sein wollten.“) oder aber sie versucht, die Schaffung von Räumen für den unüblich gewordenen Zustand der Inaktivität als temporäre „Auszeit“ zu unterstützen („Lernen Sie, sich zu entspannen.“ „Schalten Sie einfach mal ab.“).
Das Besondere hierbei ist ein spezielles Verständnis dessen, was die Transformierung seiner selbst mithilfe einer Lebenskunst bedeutet. Denn sicherlich kann man sagen, dass auch frühere Konzeptionen vom Erreichen des individuellen Glücks auf eine Steigerung des Selbst abzielten. Doch scheinen die spezifische Art und das Ziel des Steigerns in den gegenwärtigen Lebenskunstentwürfen doch eine neue Erscheinung zu sein. Nicht umsonst kommt dem Begriff der „Optimierung“ derzeit eine Schlüsselrolle zu. Man kann Prozesse optimieren, Umsatzzahlen und Wandlungsraten - und eben auch die eigene Person. Die „Selbstoptimierung“ zielt vor allem auf ein maximales, effizientes Ausreizen und Auslasten des eigenen Potentials sowie dessen, was das Leben zu bieten hat. Die Fähigkeiten und Techniken zu erlernen, sich und seinem Dasein das Meistmögliche zu entlocken, kann als ein zentrales Motiv zahlreicher gegenwärtiger Lebenskunstkonzepte angesehen werden.
Auffällig ist zudem, dass viele der heutigen Glücksstrategien auf eine quasi- naturwissenschaftliche Weise argumentieren. Sie sind durchzogen von einem strengen Ursache-Wirkung-Verständnis und verwenden Erkenntnisse aus der Psychologie, der Biologie und der Neurowissenschaft, salopp und einprägsam auch oft „Hirnforschung“ genannt. Auf diese Weise scheint es möglich zu sein, glückliche Zustände ganz gezielt und verlässlich herbeizuführen. Da man nun zu wissen glaubt, wo im menschlichen Körper die „guten Gefühle“ produziert werden - im Gehirn - und wie diese Produktion durch selbst gesetzte Impulse angeregt werden kann, eröffnen sich für die Selbstoptimierung bisher ungeahnte Möglichkeiten.
Es wird zu fragen sein, was sich in dieser Lebenskunst noch ausdrückt, außer der womöglich gut gemeinte Vorsatz, den Menschen dabei zu helfen, ein zufriedeneres Leben zu haben.
II. DIR RATGEBERLEBENSKUNST DER GEGENWART
Es gibt nicht die gegenwärtige Lebenskunst. Wann immer ich dennoch davon spreche, polemisiere ich. Wie bereits angedeutet, ist das Feld der Entwürfe zur Gestaltung eines glücklichen Daseins heutzutage sehr breit und vielschichtig.
Ich will mich im Folgenden besonders der zeitgenössischen Lebenskunst widmen, die mir in besonderem Maße mit einer auffälligen Doppelzüngigkeit aufzutreten scheint.
[...]
1 Dieter Mersch, Europäische Kulturgeschichte I, Druckversion (auf CD-Rom), Potsdam 2006, S. 154.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text?
Der Text ist eine Art Einleitung oder Preview zu einer Arbeit, die sich mit Glück und zeitgenössischer Lebenskunst auseinandersetzt. Es werden Themen wie Selbstoptimierung, der Einfluss von Technologie und Wissenschaft auf Glücksvorstellungen und die Kritik an aktuellen Ratgeberliteratur-Trends behandelt.
Was sind die Hauptthemen des Textes?
Die Hauptthemen umfassen das Streben nach Glück in der heutigen Gesellschaft, die Rolle der Selbstoptimierung, der Einfluss von Technologie und Wissenschaft auf Glückskonzepte sowie die Kritik an der Ratgeberliteratur und deren zweideutigen Botschaften.
Was wird über die Frage nach dem Glück gesagt?
Es wird festgestellt, dass die Frage nach dem Glück in der heutigen Zeit häufig gestellt und beantwortet wird. Es wird betont, dass die Suche nach Glück zwar ein altes Bestreben ist, die gegenwärtigen Konzepte und Strategien sich jedoch deutlich von früheren unterscheiden. Es wird kritisiert, dass die heutigen Glückskonzepte oft eine Kontinuität suggerieren, obwohl es eklatante Unterschiede gibt.
Welche Rolle spielt die Selbstoptimierung?
Die Selbstoptimierung wird als ein zentrales Motiv vieler gegenwärtiger Lebenskunstkonzepte dargestellt. Es geht darum, das eigene Potenzial maximal auszuschöpfen und die Fähigkeiten zu erlernen, sich und seinem Dasein das Meistmögliche zu entlocken. Es wird jedoch auch kritisch hinterfragt, was sich hinter diesem Streben nach Optimierung verbirgt.
Wie beeinflussen Technologie und Wissenschaft die Glückskonzepte?
Viele heutige Glücksstrategien argumentieren auf eine quasi-naturwissenschaftliche Weise und nutzen Erkenntnisse aus Psychologie, Biologie und Neurowissenschaft, um glückliche Zustände gezielt herbeizuführen. Das Verständnis, wo im Körper "gute Gefühle" produziert werden (im Gehirn), und wie diese Produktion angeregt werden kann, eröffnet neue Möglichkeiten für die Selbstoptimierung.
Was wird über Ratgeberliteratur gesagt?
Es wird eine kritische Haltung gegenüber der Ratgeberliteratur der Gegenwart eingenommen. Insbesondere wird die Doppelzüngigkeit dieser Literatur hervorgehoben, ohne jedoch genauer zu erläutern, worin diese besteht (Hinweis auf den dritten Abschnitt, der in der Preview ausgelassen wurde).
Was sind die zentralen Kritikpunkte an den aktuellen Glückskonzepten?
Die Kritik richtet sich gegen das Diktat des optimierenden Eingriffs, die ständige Notwendigkeit zur Selbstübertreffung und die Fokussierung auf Effizienz und Auslastung des eigenen Potenzials. Es wird auch die naturwissenschaftliche Argumentation vieler Glücksstrategien hinterfragt.
Was ist die Aussage über die technisierte Kultur?
Es wird argumentiert, dass die Kultur unserer Gegenwart sich an einer Kultivierung des Technischen orientiert, was zu einem ständigen Kampf um "Mehr", "Besser", "Schneller" und "Öfter" führt.
- Citation du texte
- Falk Rößler (Auteur), 2009, Laste dich aus!, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177740