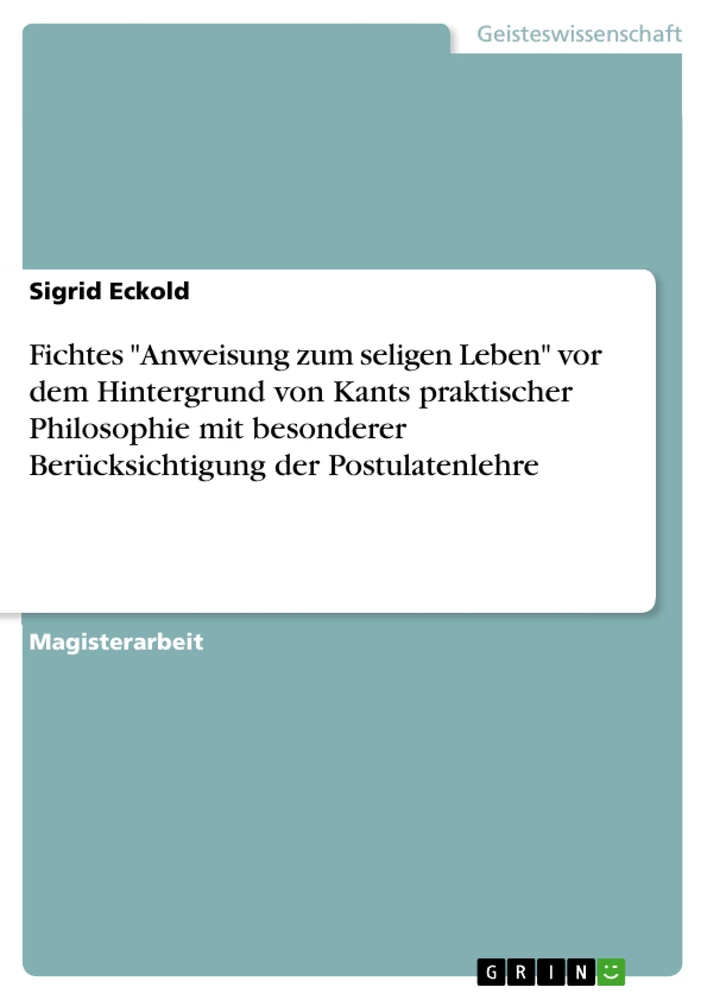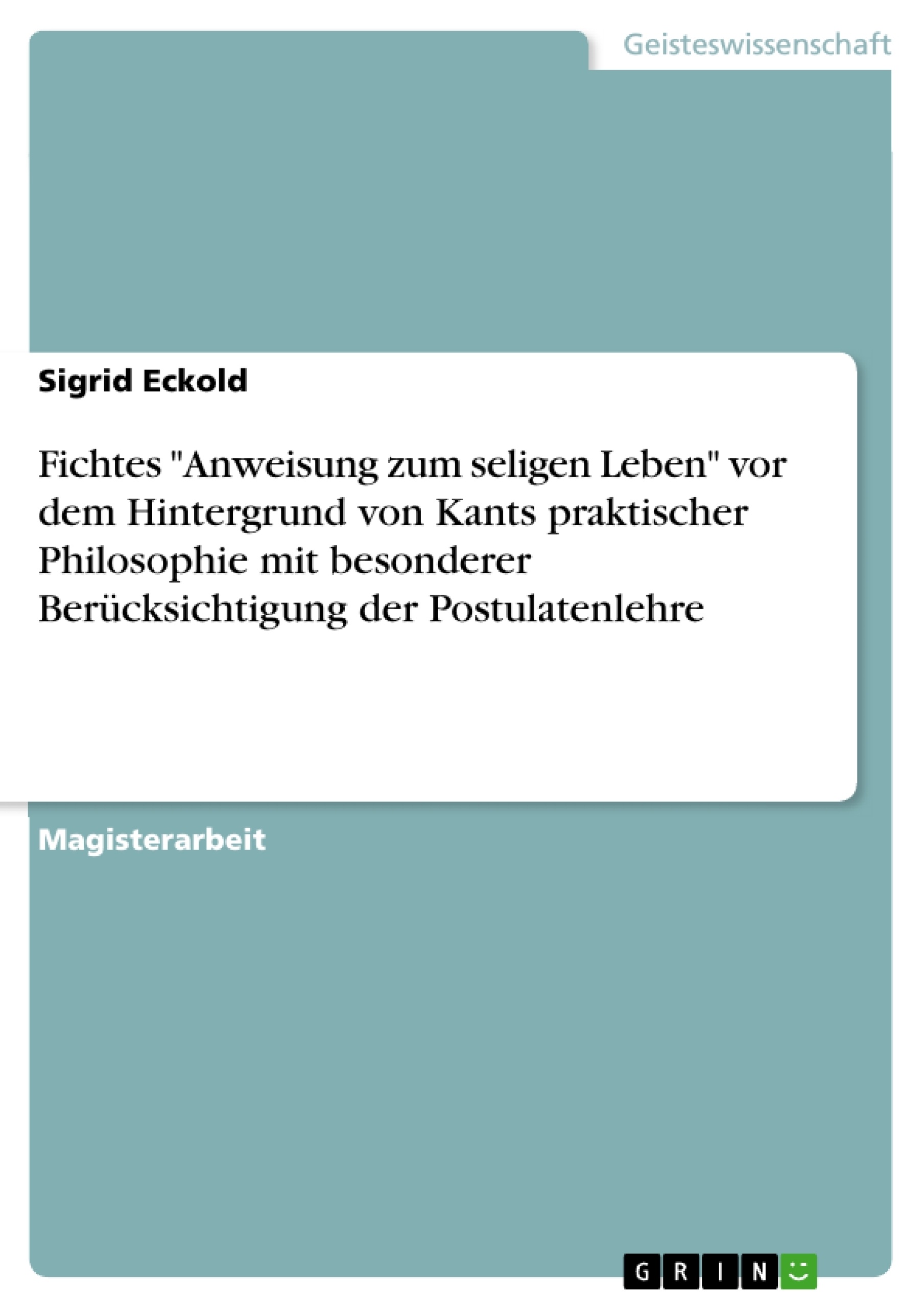Die Arbeitsgrundlage des Textes ist der Anspruch, zwei großen Philosophen gerecht zu werden. Deshalb bemüht sich die Darstellung von Kants ethischer Theorie und Fichtes Religionslehre um die Nähe zum Text und versucht doch, in kritischer Distanz zu einem eigenen Standpunkt zu kommen.
Die praktische Philosophie Kants und seine Postulatenlehre ist Thema des ersten Kapitels. Sie bilden den Ausgangspunkt für Fichtes Moralbegründung in der Religionslehre. Weil Fichte darin einen anderen Weg als Kant einschlägt, wird der Lehre von den Postulaten besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Zielsetzung ihrer Darstellung ist der Versuch, eine Antwort auf die Frage zu finden, ob das Kernstück in der "Dialektik" der "Kritik der reinen Vernunft", nämlich der Begriff "des höchsten Gutes" und die Postulate "Gott", "Freiheit" und "Unsterblichkeit der Seele" nachweislich eine Inkonsequenz Kants im System der praktischen wie theoretischen Vernunft widerspiegelt.
Weil Fichtes Reflexionsniveau in der "Anweisung" den methodischen Ort seiner philosophischen Theorie impliziert und für diese die transzendentale Fragestellung Kants Bedingung ist, wird im zweiten Kapitel die Antwort Kants und Fichtes auf die Frage "Was kann ich wissen?" kurz beleuchtet. Eine Skizze ihrer Methodik in der theoretischen Philosophie soll gemeinsame Ansätze und unterschiedliche Weiterführungen andeuten, so dass die Struktur ihres transzendentalen Fragens in ihren konstitutiven Schwerpunkten ausgelotet wird.
Im Anschluss daran wird im Rekurs auf den zweiten Vortrag der Wissenschaftslehre von 1804 der methodische Weg Fichtes zum Absoluten skizziert, da Fichtes Religionslehre von 1806, "Die Anweisung zum seligen Leben" die in der Wissenschaftslehre von 1804 systematisch erarbeitete höchste Einheit von Sein und Denken zum Ausgangspunkt hat. Dieses Vorgehen soll den Boden bereiten für die dann folgende systematische Darstellung von Fichtes Relionslehre. Der Exkurs zur Wissenschaftslehre erscheint angebracht, um aus ihrer Perspektive von 1804 die "Anweisung" in den Zusammenhang von Fichtes philosophischer Konzeption zu integrieren.
Die Aufgabe, die "Anweisung" in ihrer leitmotivischen Aussage "Es ist, außer Gott, gar nichts wahrhaftig" aus dem Kontext der praktischen Philosophie Kants zu beleuchten, wird sich besonders Fichtes Antworten auf die Fragen "Was soll ich tun?" und "Was darf ich hoffen?" zuwenden, um seine Moralbegründung darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel 1
- Die praktische Philosophie Kants als Hintergrund für Fichtes Religionslehre
- Kants Anspruch an eine Moralphilosophie
- Kants Pflichtbegriff
- Der kategorische Imperativ
- Die Korrelation von Freiheit und Sittlichkeit
- Das Faktum der Vernunft
- Der Mensch als Bürger zweier Welten: Die Begriffe "intelligibler" und "empirischer" Charakter
- Die Postulatenlehre
- Die Konzeption des höchsten Gutes: Ist die Einheit von Tugend und Glückseligkeit möglich?
- Die Antinomie der praktischen Vernunft
- Die Postulate der Unsterblichkeit der Seele und der Existenz Gottes: Garanten des höchsten Gutes?
- Das Postulat der Freiheit
- Schlußbetrachtung zur Postulatenlehre
- Kapitel 2
- Der transzendentale Fragehorizont bei Kant und Fichte
- Kant und Fichte: Die Frage nach der Einheit der Erkenntnis
- Synthesis und Transzendentalphilosophie
- Die "Ding an sich"-Problematik
- Fichtes Entwicklung der Transzendentalphilosophie
- Fichte und Spinoza
- Kapitel 3
- Der transzendentale Aufbau der Religionslehre
- Der Aufstieg zum Absoluten: Die "Anweisung zum seligen Leben" aus der Perspektive der Wissenschaftslehre von 1804
- Das "in sich geschlossene Singulum"
- Die Differenz des Absoluten zum absoluten Wissen: Das Gesetz der Projektion
- Der Begriff der absoluten Liebe als höchstes Einheits- und Spaltungsprinzip
- Das Gesetz der Reflexion
- Das Schema der Fünffachheit
- Der Standpunkt der Sinnlichkeit
- Die Stufe der Legalität
- Der Standpunkt der Moralität
- Der Standpunkt der Religion
- Der Standpunkt der Wissenschaft
- Kapitel 4
- Die Kantischen Postulate aus der Perspektive von Fichtes Religionslehre
- Die Glückseligkeit "jenseits des Grabes": Die Unsterblichkeit der Seele in der Religionslehre
- Freiheit als unerläßliche Bedingung der Sittlichkeit - Kants Freiheitspostulat im Lichte der Anweisung
- "Es ist, außer Gott, gar nichts wahrhaftig"
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit befasst sich mit Fichtes "Anweisung zum seligen Leben" (1806) vor dem Hintergrund der praktischen Philosophie Kants, insbesondere im Kontext der Postulatenlehre. Die Arbeit untersucht, wie Fichte Kants Moralbegründung kritisiert und eine eigene ethische Konzeption entwickelt. Dabei soll ein Verständnis für die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Philosophen, sowie für die Struktur ihres transzendentalen Fragens, gewonnen werden.
- Die praktische Philosophie Kants als Grundlage für Fichtes Religionslehre
- Fichtes Kritik an den Grundlagen der Kantischen Ethik
- Die Rolle des "höchsten Gutes" und der Postulate in der Kritik der praktischen Vernunft
- Der transzendentale Fragehorizont bei Kant und Fichte
- Fichtes methodischer Weg zum Absoluten in der "Anweisung zum seligen Leben"
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die praktische Philosophie Kants, insbesondere seine Postulatenlehre, dar. Es geht dabei um die Konzeption des höchsten Gutes und die Bedeutung der Postulate "Gott", "Freiheit" und "Unsterblichkeit der Seele". Das zweite Kapitel beleuchtet die Frage "Was kann ich wissen?" bei Kant und Fichte, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in ihren methodischen Ansätzen in der theoretischen Philosophie aufzuzeigen. Das dritte Kapitel behandelt Fichtes Religionslehre, insbesondere seine "Anweisung zum seligen Leben" und die methodische Entwicklung des Absoluten in der Wissenschaftslehre von 1804. Das vierte Kapitel betrachtet die Kantischen Postulate aus der Perspektive von Fichtes Religionslehre und untersucht, wie Fichte Kants Moralbegründung in seiner eigenen ethischen Konzeption weiterentwickelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themenbereiche praktische Philosophie, Moralphilosophie, Postulatenlehre, transzendentale Philosophie, Religionslehre, "Anweisung zum seligen Leben", "höchstes Gut", Freiheit, Unsterblichkeit, Gott, Kant, Fichte.
- Quote paper
- Sigrid Eckold (Author), 1995, Fichtes "Anweisung zum seligen Leben" vor dem Hintergrund von Kants praktischer Philosophie mit besonderer Berücksichtigung der Postulatenlehre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177743