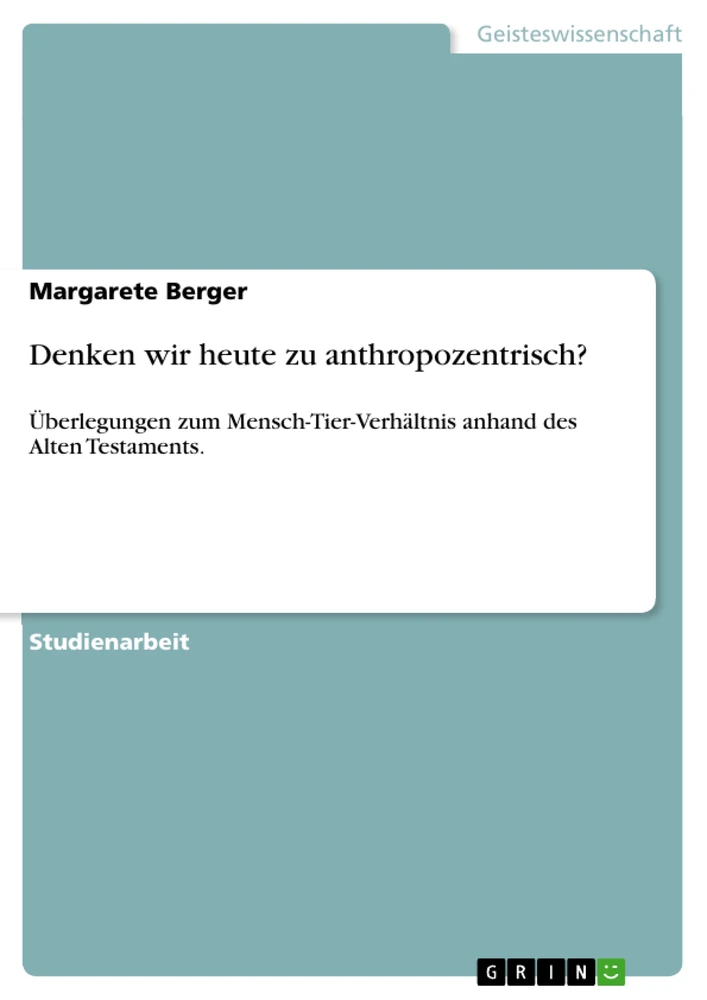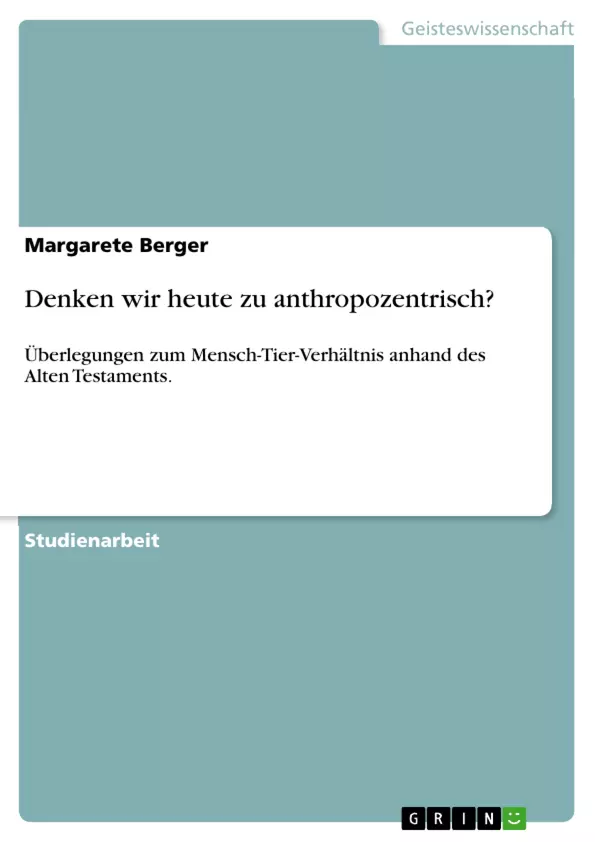1 Einleitung
Warum denkt der Mensch über seine Beziehung zum Tier nach? Dieser Frage könnte man auch im Kontext dieser Hausarbeit nachgehen. Wie denkt der Mensch über das Tier? Denkt er genug darüber nach? Oder kreist er zu sehr um sich und die Menschen um sich herum? Karl Barth kritisiert die neuzeitliche Sicht des Menschen auf die Tierwelt und wirft die Frage in den Raum, ob der angebliche äußere Kreis der Tierwelt um das Zentrum Mensch herum nicht eher ein eigenständiger Kreis ist.
Anscheinend irrt der Mensch sich in seinem Weltbild, wenn man die Konsequenzen mensch-licher Ausbeutung in der gesamten Schöpfung betrachtet. Marie Louise Henry versucht darauf eine Antwort zu geben, indem sie in einer korrekten Mensch-Tier-Beziehung die Beziehung des Menschen zu Gott identifiziert. Angesichts des heutzutage pervertierten Verhältnisses zum Tier scheint es schwierig, diese Art von Gotteserfahrung zu machen. Allerdings schließt man aus der Feststellung Henrys, dass diese Art von Beziehung zum Tier einmal bestanden haben muss. Geht man dafür in der Heilsgeschichte zurück, kommt man an der Kultur des alttestamentlichen Menschen nicht vorbei. Es gilt demnach, unter verschiedenen Gesichts-punkten eine Untersuchung der alttestamentlichen Mensch-Tier-Beziehung durchzuführen, um auf ein mögliches Idealbild zu stoßen. Interessant ist auch, erste Anzeichen unkorrekten Verhaltens bereits an dieser Stelle heraus zu stellen. Dafür werden die weisheitlichen Schriften sowie die Schöpfungserzählungen und die Geschichte von Bileams Eselin genauer untersucht.
Im nächsten Schritt stellt sich die Frage, wann sich dann eine Wende vollzogen haben muss, die zu einer derartigen Pervertierung führen konnte, die heute in all ihren Auswüchsen zu spü-ren ist. Anhand einer pragmatischen Untersuchung der historischen Etappen in der Philosophie und Theologie soll diese Frage beantwortet werden.
Zum Schluss ist zu klären, inwiefern sich durch das Alte Testament eine ethische Herausfor-derung ergibt, der sich der Mensch heute stellen muss, wenn er die Extreme der Ausbeutung und der Verhätschelung überwinden möchte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schöpfungsgeschichte
- Die Namensbenennung in der ersten Schöpfungserzählung
- Der Herrschaftsauftrag in der zweiten Schöpfungserzählung
- Das Nebeneinander von Mensch und Tier im AT
- Miteinander von Mensch und Tier im Alltag
- Tierrechte
- Die Beziehung zwischen Gott und Tier
- Das Tier als Träger göttlicher Willensäußerungen: Bileams Eselin
- Bruch zwischen Mensch und Tier
- Antike Vorstellungen
- Mittelalter
- Neuzeit
- Zukunftsperspektive?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Mensch-Tier-Beziehung im Alten Testament und untersucht, ob die traditionelle anthropozentrische Sichtweise des Menschen zu einer Verzerrung der Beziehung zwischen Mensch und Tier führt. Sie beleuchtet die Rolle des Tieres in der Schöpfungserzählung und in der Lebenswelt des alttestamentlichen Menschen, analysiert den Herrschaftsauftrag und untersucht die Geschichte von Bileams Eselin. Die Arbeit zielt darauf ab, ein Idealbild der Mensch-Tier-Beziehung im Alten Testament zu erarbeiten und gleichzeitig erste Anzeichen für eine Verfehlung dieser Beziehung aufzuzeigen.
- Die Rolle des Tieres in der Schöpfungserzählung
- Der Herrschaftsauftrag und seine Interpretation
- Das Tier als Träger göttlicher Willensäußerungen
- Die Beziehung zwischen Mensch und Tier im Alltag
- Das Alte Testament als ethische Herausforderung für den Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach der Mensch-Tier-Beziehung im Alten Testament. Sie beleuchtet die Kritik an der neuzeitlichen anthropozentrischen Sichtweise und greift die Frage auf, ob die traditionelle Sichtweise die Beziehung zwischen Mensch und Tier verzerrt.
Das Kapitel über die Schöpfungsgeschichte befasst sich mit den zwei Schöpfungsberichten des Alten Testaments. Es untersucht die Namensgebung der Tiere durch den Menschen in der ersten Schöpfungserzählung und beleuchtet den Herrschaftsauftrag in der zweiten Schöpfungserzählung, der im Laufe der Geschichte unterschiedlich interpretiert wurde.
Das Kapitel „Das Nebeneinander von Mensch und Tier im AT“ analysiert das Miteinander von Mensch und Tier im Alltag, beleuchtet die Frage nach Tierrechten und untersucht die Beziehung zwischen Gott und Tier. Des Weiteren wird das Tier als Träger göttlicher Willensäußerungen am Beispiel von Bileams Eselin betrachtet.
Das Kapitel „Bruch zwischen Mensch und Tier“ beschäftigt sich mit der Frage, wann und wie sich die Beziehung zwischen Mensch und Tier verändert hat. Es untersucht verschiedene Epochen in der Geschichte und zeigt die Entwicklung der Mensch-Tier-Beziehung von der Antike bis zur Neuzeit auf.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Mensch-Tier-Beziehung, Schöpfungsgeschichte, Herrschaftsauftrag, Tierrechte, Gotteserfahrung, alttestamentliche Theologie, anthropozentrische Sichtweise, und die Geschichte von Bileams Eselin. Sie untersucht die Entwicklung der Mensch-Tier-Beziehung im Kontext der alttestamentlichen Theologie und betrachtet das Verhältnis zwischen Mensch und Tier unter verschiedenen Gesichtspunkten.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird die Mensch-Tier-Beziehung im Alten Testament dargestellt?
Das Alte Testament zeigt ein enges Miteinander im Alltag, in dem Tiere als Mitgeschöpfe Gottes und teilweise sogar als Träger göttlicher Botschaften gesehen werden.
Was bedeutet der „Herrschaftsauftrag“ des Menschen wirklich?
Die Arbeit untersucht, ob der Auftrag zur „Herrschaft“ (Dominium terrae) ursprünglich als verantwortungsvolle Fürsorge statt als rücksichtslose Ausbeutung gedacht war.
Was lehrt uns die Geschichte von Bileams Eselin?
Die Geschichte zeigt das Tier als Träger göttlicher Willensäußerungen, das oft hellsichtiger ist als der Mensch und eine eigenständige Beziehung zu Gott hat.
Wann vollzog sich der Bruch in der Mensch-Tier-Beziehung?
Die Untersuchung analysiert historische Etappen in Philosophie und Theologie (Antike, Mittelalter, Neuzeit), die zu einer zunehmenden Anthropozentrik und Ausbeutung führten.
Welche ethische Herausforderung ergibt sich heute?
Der Mensch muss das Extrem zwischen Ausbeutung und Verhätschelung überwinden und zu einem biblisch inspirierten Idealbild der Mitgeschöpflichkeit zurückfinden.
- Quote paper
- Margarete Berger (Author), 2010, Denken wir heute zu anthropozentrisch?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177763