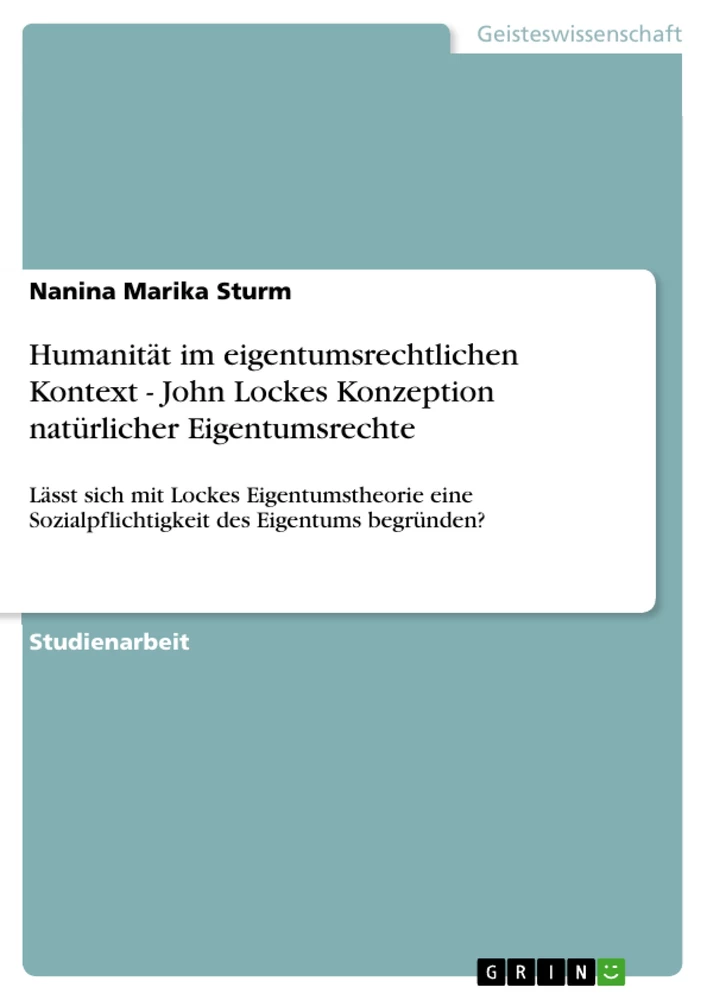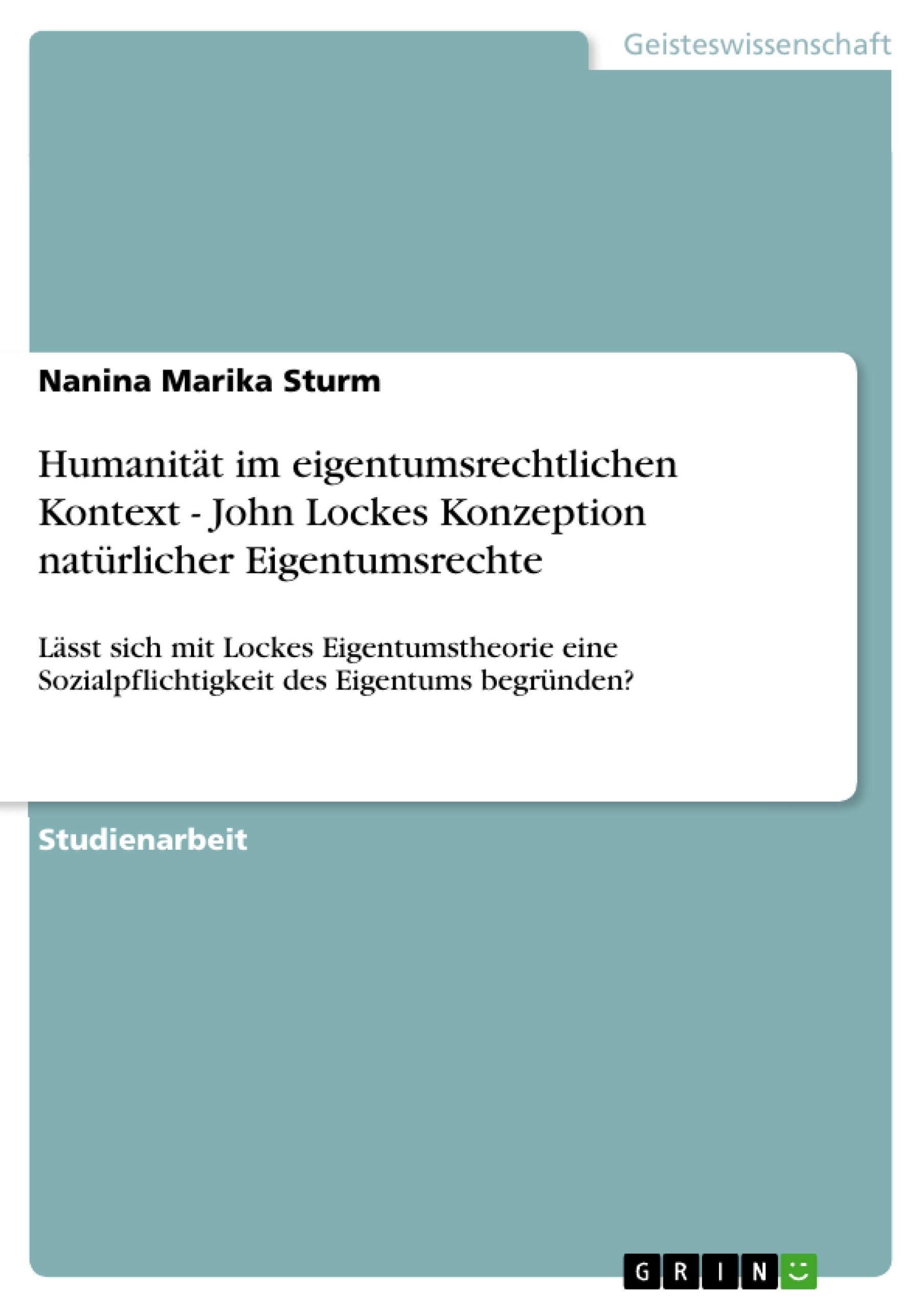Die Sozialpflichtigkeit des Eigentums ist im Grundgesetz rechtlich geregelt. „Eigentum verpflichtet. Es soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen“, so heißt es in Artikel 14, Absatz 2. Sozialpflichtige Besteuerungen, die vom Staat verlangt werden, sind demnach legitim, wenn sie dem Wohl seiner Bürger dienen. Wie lässt sich jedoch eine solche Legitimationsbasis begründen, sodass andere Mitmenschen einen Anspruch auf fremdes Eigentum haben? Sind derartige Besteuerungen wirklich legitim oder stellen sie eine Verletzung der Freiheitsrechte der Eigentümer dar? Wenn man allerdings in einem Staat lebt, dessen Bewohner sich nicht nur soziale Sicherheit wünschen, sondern sogar ein Recht darauf haben, stellt sich die Frage, wie diese garantiert werden kann. Ist der Staat berechtigt, seine Bürger dazu zu zwingen, einen Teil ihres Eigentums anderen zur Verfügung zu stellen, obwohl sie dafür gearbeitet haben? Derartige Fragen skizzieren den Angelpunkt des Spannungsverhältnisses, welches zwischen den wechselseitigen Ansprüchen der Bürger gegeneinander und gegen den Staat besteht. Eine plausible Antwortmöglichkeit auf diese Fragen geben zu können, bedeutet, danach zu fragen, wie ein Konzept zur Legitimation von Eigentumsansprüchen und staatlicher Zwangsbefugnis begründet werden kann. Im 17. Jahrhundert war es John Locke, der in seinen „Zwei Abhandlungen über die Regierung"(1690) eine mögliche Legitimationsbasis von Eigentumsrechten konzipierte. Mit seiner Arbeitstheorie begründet er erstmals subjektive Exklusivrechte, welche bereits vor der Konstitution eines Staates –im sog. rechtlosen Naturzustand- bestehen. Die Frage und Umstrittenheit einer Rechtfertigung von Eigentumsansprüchen scheint nicht an Aktualität verloren zu haben: So greift bspw. in modifizierter Weise der Neo-Liberalismus teils auf Ideale des klassischen Liberalismus zurück – jedoch mit einer anderen Intention, sodass andere Rechtfertigungskonzeptionen daraus resultieren, wie bspw. die von Robert Nozick. Angesichts vieler unterschiedlicher Rechtfertigungsansätze stellt diese Arbeit die Konzeptionen von John Locke, Hugo Grotius und Robert Nozick dar. Im Zentrum steht die Frage nach der „Humanität“ im eigentumsrechtlichen Kontext: Was kann unter diesem Begriff hier verstanden werden? Das Recht auf Eigentum ist nach modernem Verständnis ein Menschenrecht. Wie lässt es sich aber unter den Bedingungen von kontingenten Ressourcen angemessen für jeden Menschen verwirklichen?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung: „mutual Preseravation of their Lives, Liberties and Estates“
- II. Lockes Eigentumstheorie
- 1. Politischer Zugang
- 2. Staatliche Handlungsgrenzen im eigentumsrechtlichen Kontext
- 3. Gewährleistung von Eigentumsrechten ohne staatliche Handlungsgrenzen?
- 4. Kontraktuelle Etablierungsmodelle von Eigentumsrechten
- 5. Natürliche Rechte (,,natural rights“)
- 6. Naturzustand (,,state of nature“)
- 6.1 Naturzustand: „Original Community of all things amongst the Sons of Men“
- 6.1.1 Das Selbsterhaltungsargument
- 6.1.2 Das oikos-Argument
- 6.1.3 ,,original communism“
- 6.1 Naturzustand: „Original Community of all things amongst the Sons of Men“
- 7. Lockes Arbeitstheorie: Natürliche Exklusivrechte durch Arbeit
- 7.1 ,,self-ownership\" & „world-ownership“
- 7.2 Natürliche Aneignungsschranken: Die Verderblichkeitsschranke
- 7.3 Natürliche Aneignungsschranken: Das „Lockean proviso“
- III. Das „Lockean proviso“ als Humanitätskriterium
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Lockes Eigentumstheorie auf ihre Kohärenz und ihre Bedeutung im Kontext von Sozialpflichtigkeit und Humanität. Ziel ist es, zu analysieren, ob sich aus Lockes Theorie eine soziale Verantwortung des Eigentums ableiten lässt und welche Implikationen dies für die heutige Gesellschaft hat.
- Lockes Konzeption natürlicher Eigentumsrechte und der Naturzustand
- Die Bedeutung des „Lockean proviso“ als Kriterium für die Ausübung von Eigentumsrechten
- Die Spannung zwischen individuellen Eigentumsrechten und der Notwendigkeit sozialer Gerechtigkeit
- Die Rolle des Staates bei der Regulierung von Eigentum und der Gewährleistung von grundlegenden Rechten
- Die Frage der Kompatibilität von Lockes Eigentumstheorie mit sozialistischen und kapitalistischen Wirtschaftsmodellen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt Lockes Eigentumstheorie als unvollständig und mangelnd an Humanität dar, was die Frage nach der Kohärenz und den ethischen Implikationen von Lockes Gedanken aufwirft.
- Lockes Eigentumstheorie: Dieses Kapitel analysiert die grundlegenden Elemente von Lockes Eigentumstheorie, einschließlich des politischen Zugangs, staatlicher Handlungsgrenzen und der Rolle natürlicher Rechte.
- Der Naturzustand: Lockes Konzeption des Naturzustands wird hier untersucht, einschließlich des „Original Community of all things amongst the Sons of Men“ und der damit verbundenen sozialistischen Aspekte.
- Lockes Arbeitstheorie: Dieses Kapitel behandelt Lockes Arbeitstheorie und die damit verbundenen natürlichen Aneignungsschranken, wie die Verderblichkeitsschranke und das „Lockean proviso“.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Konzeption natürlicher Eigentumsrechte, die Rolle des Naturzustands, die Bedeutung des „Lockean proviso“, die Spannungen zwischen Individualrechten und sozialen Pflichten sowie die Implikationen für heutige Wirtschafts- und Sozialmodelle. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Eigentumstheorie, Naturzustand, „Lockean proviso“, soziale Gerechtigkeit, Humanität, Sozialismus, Kapitalismus.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt John Lockes Arbeitstheorie des Eigentums?
Locke argumentiert, dass ein Mensch durch die Vermischung seiner eigenen Arbeit mit herrenlosen Naturressourcen rechtmäßiges Eigentum an diesen erwirbt.
Was ist das "Lockean Proviso" (Lockesche Klausel)?
Es ist eine Einschränkung der Aneignung: Man darf sich nur so viel aneignen, wie "genug und ebenso Gutes" für andere übrig bleibt. Dies dient als Kriterium für Humanität und soziale Gerechtigkeit.
Was versteht Locke unter dem Naturzustand?
Der Naturzustand ist ein vorstaatlicher Zustand, in dem Menschen frei und gleich sind und bereits natürliche Rechte auf Leben, Freiheit und Eigentum besitzen.
Ist staatliche Besteuerung nach Lockes Theorie legitim?
Besteuerung ist legitim, wenn sie auf der Zustimmung der Bürger beruht und dem Schutz der natürlichen Rechte sowie dem Wohl der Allgemeinheit dient.
Wie wird "Humanität" im eigentumsrechtlichen Kontext definiert?
Humanität bedeutet hier die Gewährleistung, dass Eigentumsrechte nicht zur Notlage anderer führen und dass jeder Mensch die Chance hat, seine Existenz durch eigene Arbeit zu sichern.
- Quote paper
- Nanina Marika Sturm (Author), 2011, Humanität im eigentumsrechtlichen Kontext - John Lockes Konzeption natürlicher Eigentumsrechte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177786