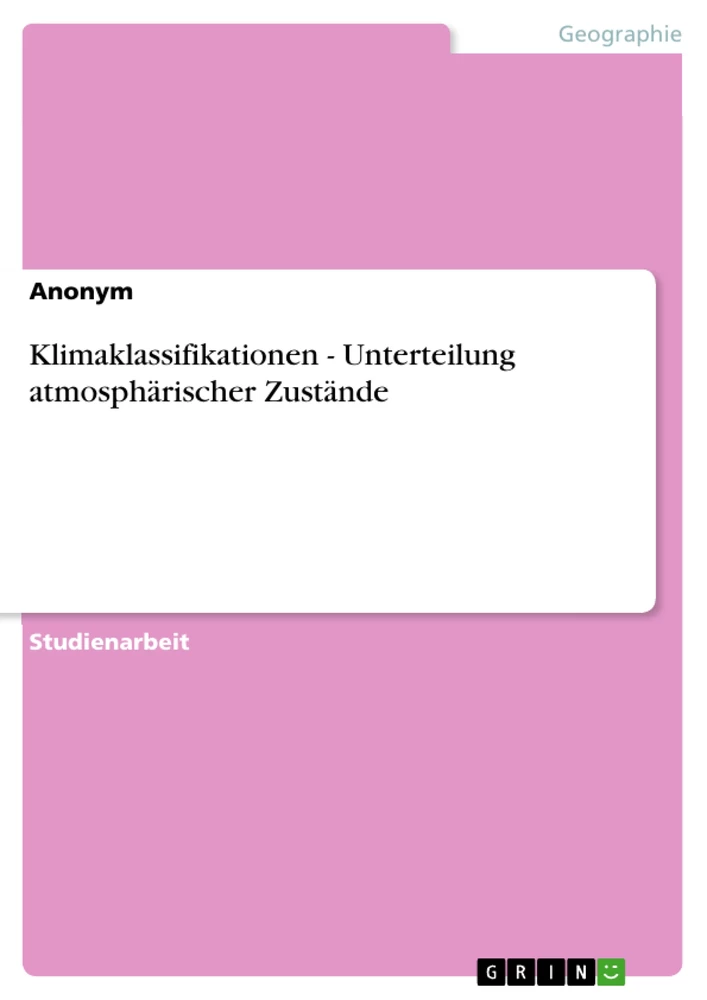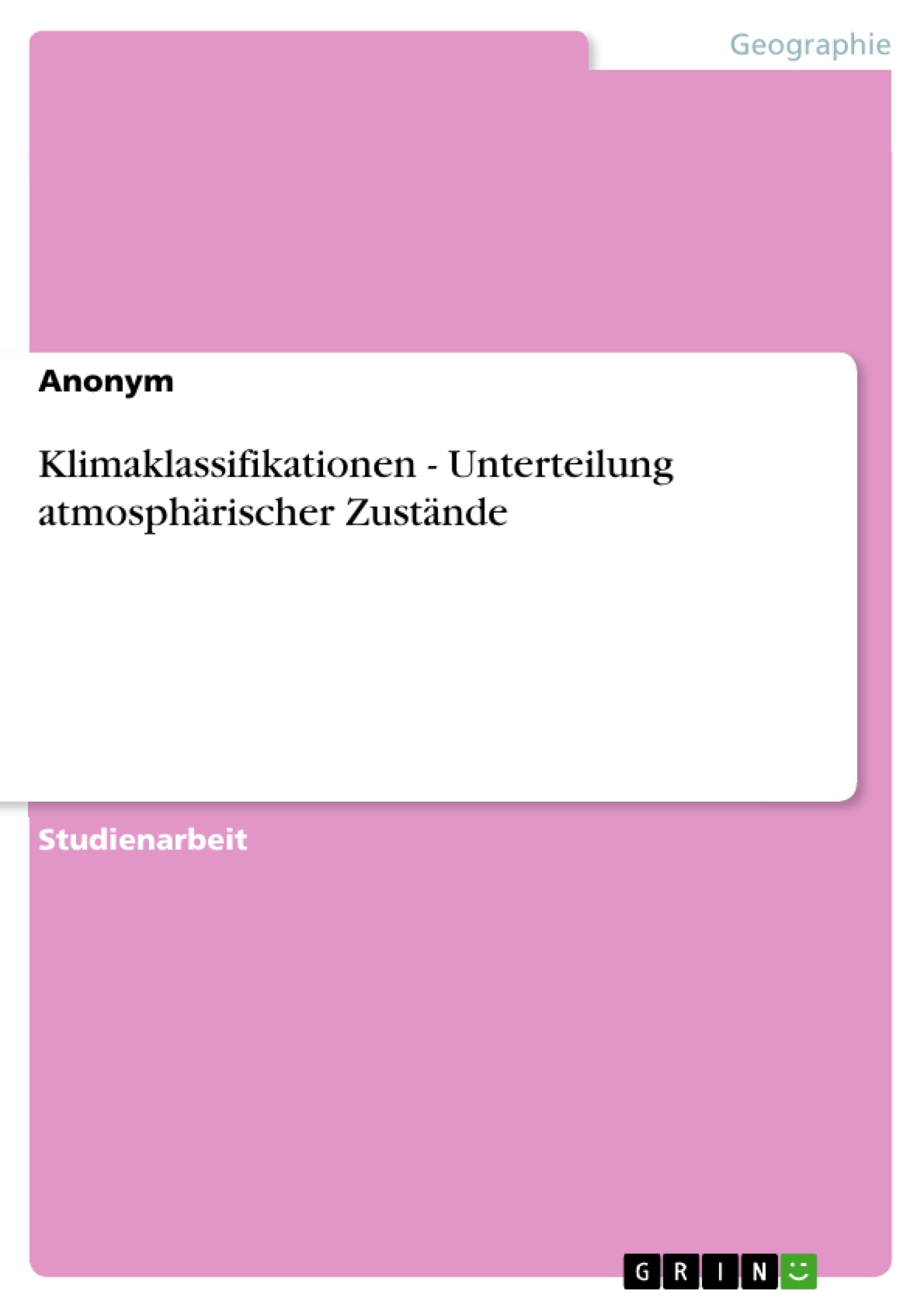„Klassifizieren bedeutet Einordnen von Tatsachenmaterial in ein bestimmtes Ordnungssystem“ (Liebscher 1978 zit. in Hupfer 1991:218).
Klimaklassifikationen dienen der Gliederung atmosphärischer Zustände. Sie stützen sich auf typisierte Klimaerscheinungen, den Klimaelementen und Klimafaktoren sowie deren Wirkung auf die Erdoberfläche und geben dies in Klimatypen wieder (Ben-dix/Lauer 2006:262).
Bereits in der Antike beschäftigten sich die Griechen damit die Erde in unterschiedliche Klimazonen zu unterteilen. Sie legten die Grenzen anhand bestimmter Breitenkreise beziehungsweise bestimmter Licht- und Schattenzonen fest. Darauf aufbauend wurden die Klimate der Erde immer weiter erforscht und die Klimaklassifikationen weiter bearbeitet und erweitert (Knoch/Schulze 1952:3).
Heute wird unterschieden zwischen effektiven und genetischen Klimaklassifikationen. Effektive Klimaklassifikationen teilen Klimazonen mit Hilfe bestimmter Schwellen- oder Mittelwerte einzelner Klimaerscheinungen ein. Die genetischen Klassifikationen hingegen stützen sich bei der Einteilung auf die allgemeine Zirkulation der Atmosphäre (Leser 2005:431).
In folgender Hausarbeit werden die wichtigsten und bekanntesten Ansätze behandelt und später kritisch gegenübergestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeines
- Effektive Klimaklassifikationen
- Ansatz nach Penck
- Ansatz nach Köppen/Geiger
- Ansatz nach Troll/Paffen
- Ansatz nach Lauer/Frankenberg
- Genetische Klimaklassifikationen
- Ansatz nach Flohn
- Ansatz nach Neef
- Kritische Gegenüberstellung
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Klassifikation von Klimazonen, einem wichtigen Aspekt der physischen Geographie. Sie untersucht verschiedene Ansätze, die auf empirischen Daten und dem Verständnis der atmosphärischen Zirkulation beruhen, und analysiert ihre Stärken und Schwächen.
- Untersuchung verschiedener effektiver und genetischer Klimaklassifikationen
- Analyse der verwendeten Kriterien und Parameter für die Einteilung der Klimazonen
- Herausarbeitung der Vor- und Nachteile der einzelnen Ansätze
- Bewertung der Auswirkungen von Generalisierungen und Vereinfachungen auf die Darstellung des Klimas
- Kritische Gegenüberstellung der verschiedenen Klimaklassifikationen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema Klimaklassifikationen ein, erklärt deren Bedeutung und gibt einen kurzen Überblick über die verschiedenen Ansätze, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt werden.
- Das Kapitel "Allgemeines" thematisiert die Komplexität des Klimas und die Herausforderung, es in Kategorien einzuteilen. Es werden grundlegende Konzepte und Herausforderungen der Klimaklassifikation erläutert.
- Im Kapitel "Effektive Klimaklassifikationen" werden verschiedene Ansätze wie Penck, Köppen/Geiger, Troll/Paffen und Lauer/Frankenberg vorgestellt und ihre Herangehensweise an die Einteilung von Klimazonen anhand empirischer Daten erläutert.
- Das Kapitel "Genetische Klimaklassifikationen" konzentriert sich auf die Ansätze von Flohn und Neef, die die allgemeine Zirkulation der Atmosphäre als Grundlage für die Klimazoneinteilung verwenden.
- Das Kapitel "Kritische Gegenüberstellung" analysiert die verschiedenen Ansätze aus verschiedenen Perspektiven und diskutiert ihre Stärken und Schwächen. Es werden die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Methoden verglichen und die Auswirkungen von Generalisierungen und Vereinfachungen auf die Darstellung des Klimas beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit den Schwerpunktthemen Klimaklassifikation, effektive Klimaklassifikation, genetische Klimaklassifikation, Klimaelemente, Klimafaktoren, atmosphärische Zirkulation, Klimatypen, Trockengrenze, hydrologische Aspekte, Vegetationstypen, empirische Daten, generalisierte Darstellung, kritische Gegenüberstellung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen effektiven und genetischen Klimaklassifikationen?
Effektive Klassifikationen nutzen Schwellenwerte (z. B. Temperatur), während genetische Klassifikationen auf der atmosphärischen Zirkulation basieren.
Wer entwickelte die bekannteste effektive Klimaklassifikation?
Der Ansatz nach Köppen und Geiger ist einer der wichtigsten und am weitesten verbreiteten effektiven Ansätze in der Geographie.
Was kennzeichnet die genetische Klassifikation nach Flohn?
Flohn teilt die Klimate nach den globalen Wind- und Druckgürteln ein, also nach der Entstehung (Genese) des Klimas.
Welche Rolle spielen Vegetationstypen bei der Klimaeinteilung?
Viele effektive Klassifikationen (wie Troll/Paffen) nutzen die sichtbare Vegetation als Indikator für die klimatischen Bedingungen vor Ort.
Warum gibt es so viele verschiedene Klassifikationsmodelle?
Da das Klima komplex ist, dienen Modelle der Vereinfachung. Je nach Fragestellung (Landwirtschaft, Meteorologie) sind unterschiedliche Parameter relevant.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2009, Klimaklassifikationen - Unterteilung atmosphärischer Zustände, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177792