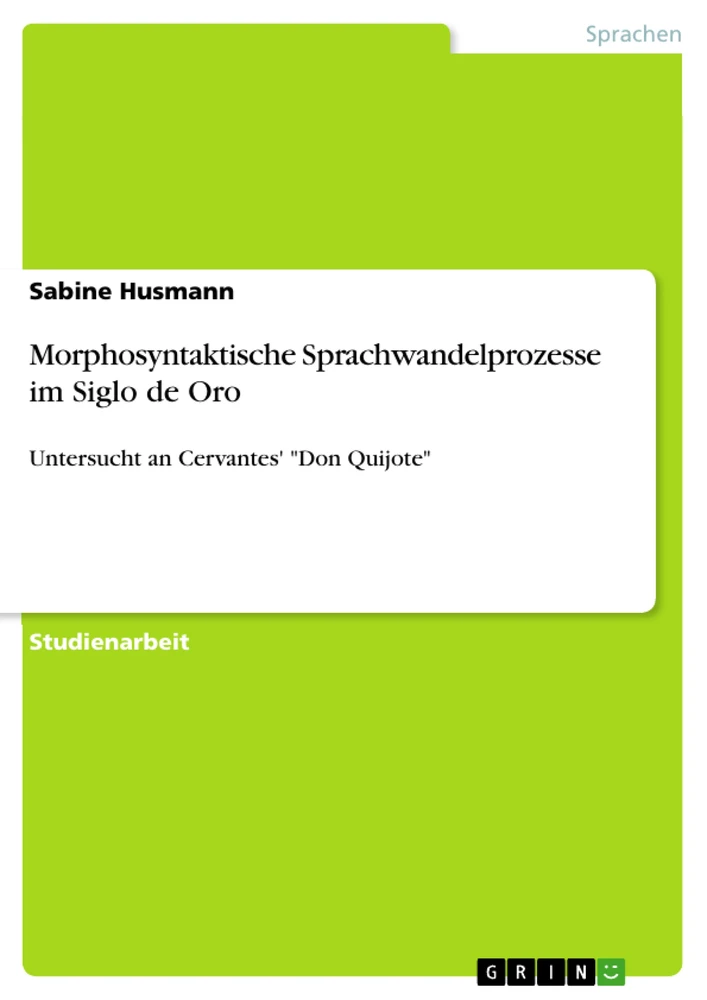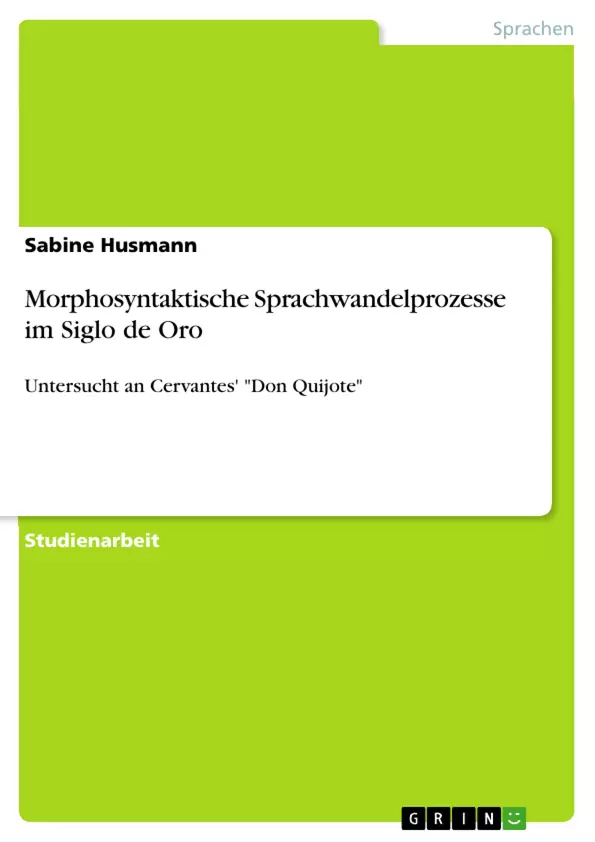Einleitung: Während des Siglo de Oro (16./ 17. Jh.) fanden im Bereich der Morphosyntax des Spanischen einige Veränderungen statt, die sich oftmals bereits im Altspanischen angekündigt hatten. Bei Varianten wie beispielsweise diphthongierten und kontrahierten Verbformen oder dem Artikel el/ ell setzte sich nur noch eine der Formen durch. Die Stellung verschiedener Satzteile wurde festgelegt. Der zunehmende italienische Einfluss machte sich bei der synthetischen Superlativbildung mit -ísimo/ –ísima bemerkbar. Es entwickelten sich die modernen Abgrenzungen zwischen ser und estar sowie zwischen tener und haber. Die Verbformen mit Endung –ra wechselten das Tempus und änderten somit auch ihre Funktion.
Mit dieser Arbeit möchte ich auf die morphosyntaktischen Sprachwandelprozesse genauer eingehen und anhand von Cervantes’ Don Quijote die theoretischen Über-legungen mit praktischen Beispielen untermauern. Als Textgrundlage diente mir die Ausgabe von Adolfo Bonilla und Rodolfo Schevill aus dem Jahre 1928. Um den Textumfang zu beschränken, habe ich mich ausschließlich mit dem zweiten Kapitel, Don Quijotes erster Ausfahrt, beschäftigt. In den Zitaten habe ich die Schreibweise dieser Ausgabe beibehalten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Morphosyntaktische Sprachwandelprozesse
- Pronomen
- Anredeformen
- Artikel
- Verb
- Andere Wortarten
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit morphosyntaktischen Sprachwandelprozessen im Spanischen des Siglo de Oro (16./17. Jh.). Ziel ist es, diese Prozesse zu analysieren und anhand von Beispielen aus Cervantes' Don Quijote zu verdeutlichen.
- Entwicklung der Pronomen im Spanischen
- Veränderungen in der Satzstellung
- Einfluss des Italienischen auf die Superlativbildung
- Unterscheidung zwischen den Verben "ser" und "estar" sowie "tener" und "haber"
- Veränderungen im Tempusgebrauch von Verbformen mit der Endung "-ra"
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung gibt einen Überblick über die morphosyntaktischen Veränderungen, die im Spanischen des Siglo de Oro stattfanden. Es werden einige Beispiele für diese Veränderungen genannt, darunter die Entwicklung der Verbformen und die Einführung neuer Superlative.
Morphosyntaktische Sprachwandelprozesse
Dieser Abschnitt untersucht die Entwicklung verschiedener Wortarten, insbesondere von Pronomen. Es werden Veränderungen in der Schreibweise und im Gebrauch verschiedener Pronomenformen beschrieben, sowie die Entwicklung von Relativpronomen und die Satzstellung von Pronomen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit folgenden Schwerpunkten: Morphosyntax, Sprachwandel, Siglo de Oro, Cervantes, Don Quijote, Pronomen, Artikel, Verb, Satzstellung, Kasus, Genus, Leísmo, Loísmo, Laísmo.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Siglo de Oro für die spanische Sprache?
Das Goldene Zeitalter (16./17. Jh.) war eine Epoche bedeutender morphosyntaktischer Veränderungen, in der sich viele Strukturen vom Altspanischen zum modernen Spanisch festigten.
Welche Rolle spielt "Don Quijote" in dieser Sprachanalyse?
Cervantes' Werk dient als primäre Textgrundlage, um theoretische Sprachwandelprozesse (z.B. Pronomengebrauch oder Verbformen) an praktischen Beispielen der damaligen Zeit zu belegen.
Wie entwickelten sich die Verben "ser" und "estar"?
Im Siglo de Oro bildeten sich die modernen Abgrenzungen zwischen "ser" (essenzielle Eigenschaften) und "estar" (vorübergehende Zustände) deutlicher heraus als im Altspanischen.
Was änderte sich bei den Pronomen?
Die Arbeit untersucht Phänomene wie den Leísmo, Loísmo und Laísmo sowie die Festlegung der Stellung von Pronomen im Satz, die in dieser Zeit eine stärkere Normierung erfuhren.
Welchen Einfluss hatte das Italienische auf das Spanische?
Der zunehmende italienische Einfluss im Siglo de Oro machte sich besonders bei der Bildung des synthetischen Superlativs auf "-ísimo" bemerkbar.
- Quote paper
- Sabine Husmann (Author), 2006, Morphosyntaktische Sprachwandelprozesse im Siglo de Oro, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177939