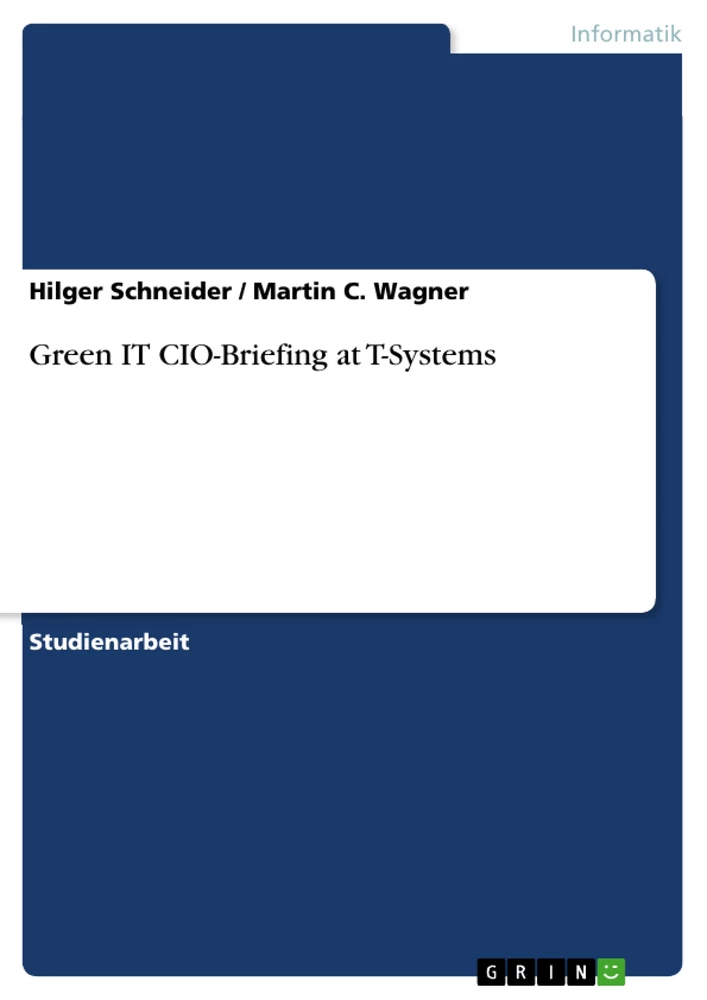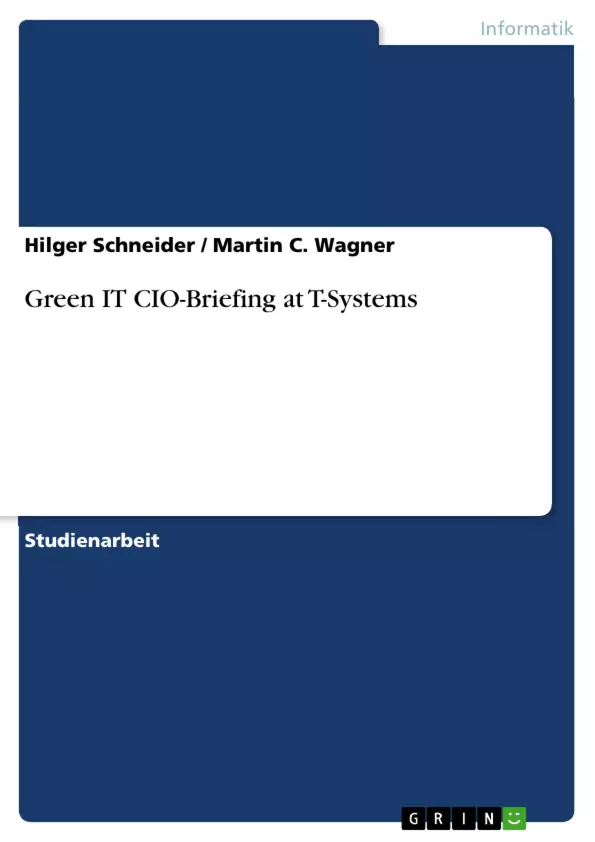In 2007 betrug der, durch den Einsatz Informationstechnik (IT), verursachte Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO2), gemessen in CO2-äquivalentem (CO2e), mehr als 820 Millionen Tonnen. Dieser Ausstoß stellt ca. zwei Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes dar. Darüber hinaus war ein jährlicher Zuwachs bei benötigter Rechenleistung um ca. 60 Prozent und eine Zunahme der Internetnutzer um fünfzehn Prozent zu verzeichnen (Buhl & Laartz, 2008, S. 261).
Für den Betrieb von Servern und Infrastruktur wurden in der Europäischen Union (EU), nach Schätzungen der Österreichischen Energieagentur, 40 Terrawattstunden im Wert von sechs Milliarden Euro verbraucht (Buhl & Laartz, 2008, S. 261). Die durchschnittlichen Betriebskosten eines klassischen Rechenzentrums werden zu ca. 80 Prozent von Kosten für elektrische Energie dominiert. Pauschalisiert kann man sagen, dass für ein Kilowatt (kW) Serverleistung ein weiteres kW für unterstützende Einrichtungen und Anlagegüter, wie z.B. Klimaanlagen, Beleuchtung oder die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), aufgewendet werden müssen (PC Welt, 2008).
Betrachtet man diese Werte, so kann man zu dem Schluss kommen, dass beträchtliche Einsparungspotentiale vorhanden sind, die zumindest zum Teil gehoben werden können.
„Green IT“ bietet einen Ansatz diese Potentiale heben zu können. Buhl und Laartz definieren Green IT als Maßnahmen zur „[…]Senkung des Energieverbrauchs und somit der Energiekosten der IT selbst“ (Buhl & Laartz, 2008, S. 261) und betonen, dass die CO2-Emissionsredukton für die ökologische und ökonomische Bilanz nützlich ist und für Marketingzwecke verwendet werden kann (Buhl & Laartz, 2008, S. 261).
PC Welt geht davon aus, dass ein energieeffizientes Rechenzentrum einen zusätzlichen Energieverbrauch von 0,5 kW je kW Serverleistung haben kann. Die Zeitschrift beziffert weitergehend die potentiellen Einsparungspotentiale je Server und Jahr mit 100 Euro. Diese Summe setzt sich aus der Prämisse von Kosten in Höhe von Zehn Cent, inklusive aller Steuern, einem Gebührentakt von 0,25kW und den oben genannten Verbrauchswerten zusammen (PC Welt, 2008).
Greifbare Ergebnisse lieferten bisher IBM und die Berliner STRATO AG. So gelang es beispielsweise IBM in einem Rechenzentrum ca. 90 Prozent der benötigten Fläche und ca. 85 Prozent des Energieverbrauches einzusparen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Green IT
- 2.1 Technische Maßnahmen
- 2.1.1 Energieeffiziente Technologien
- 2.1.2 Optimierung der Kühlung
- 2.1.3 Virtualisierung
- 2.2 Verbindung zu den Geschäftsprozessen durch Substitution am Beispiel von Dienstreisen
- 2.3 Recycling und Wiederverwendung
- 2.4 Zwischenergebnis
- 3 Potentiale und Risiken der Nutzung von Green IT für T-Systems
- 3.1 Potentiale und Risiken durch Einsatz energieeffizienten Technologie
- 3.2 Potentiale und Risiken durch eine optimierte Kühlung
- 3.3 Potentiale und Risiken durch Virtualisierung, Grid-Applikationen und Cloud-Computing
- 3.4 Potentiale und Risiken durch Substitution; Beispiel von Dienstreisen
- 3.5 Recycling und Wiederverwendung
- 4 Empfehlung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Ansatz der Green IT und analysiert die Potentiale und Risiken, die sich aus deren Nutzung für den T-Systems Konzern ergeben. Die Arbeit beleuchtet die technischen Maßnahmen, die Substitution von Geschäftsprozessen und das Recycling und die Wiederverwendung von IT-Systemen im Kontext von Green IT.
- Energieeffiziente Technologien
- Optimierung der Kühlung von Rechenzentren
- Virtualisierung, Grid-Applikationen und Cloud-Computing
- Substitution von Dienstreisen durch Videokonferenzen
- Recycling und Wiederverwendung von IT-Systemen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Green IT ein und beleuchtet die Bedeutung von energieeffizienten IT-Systemen im Kontext des globalen C02-Ausstoßes. Es werden die Kosten für den Betrieb von Rechenzentren und die Einsparpotentiale durch Green IT aufgezeigt.
Kapitel 2 beschreibt die verschiedenen Ebenen der Green IT, darunter technische Maßnahmen, die Verbindung zu den Geschäftsprozessen durch Substitution und Recycling und Wiederverwendung.
Kapitel 3 analysiert die Potentiale und Risiken der Nutzung von Green IT für T-Systems. Es werden die Einsparpotentiale durch den Einsatz energieeffizienter Technologien, die Optimierung der Kühlung, die Virtualisierung, den Einsatz von Grid-Applikationen und Cloud-Computing sowie die Substitution von Dienstreisen durch Videokonferenzen und das Recycling und die Wiederverwendung von IT-Systemen betrachtet.
Kapitel 4 fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und gibt eine Empfehlung für den Einsatz von Green IT bei T-Systems ab.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Green IT, Energieeffizienz, C02-Emissionen, Rechenzentren, Kühlung, Virtualisierung, Grid-Applikationen, Cloud-Computing, Substitution, Dienstreisen, Videokonferenzen, Recycling, Wiederverwendung, T-Systems, Potentiale, Risiken, Kostenreduktion, Umweltschutz.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Green IT?
Green IT umfasst Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen in der Informationstechnik, um sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile zu erzielen.
Welche technischen Maßnahmen fördern die Energieeffizienz?
Dazu gehören die Virtualisierung von Servern, die Optimierung der Kühlung in Rechenzentren sowie der Einsatz von Cloud-Computing und energieeffizienter Hardware.
Können Videokonferenzen zur Green IT beitragen?
Ja, durch die Substitution von Dienstreisen durch Videokonferenzen lassen sich erhebliche Mengen an CO2-Emissionen und Kosten einsparen.
Wie hoch ist das Einsparpotenzial in Rechenzentren?
In effizienten Rechenzentren können bis zu 85 % des Energieverbrauchs und 90 % der benötigten Fläche durch moderne Green IT-Ansätze wie Virtualisierung eingespart werden.
Warum ist Recycling bei IT-Systemen wichtig?
Recycling und Wiederverwendung reduzieren den Ressourcenverbrauch und verringern die Umweltbelastung durch Elektroschrott am Ende des Lebenszyklus der Geräte.
- Citation du texte
- Hilger Schneider (Auteur), Martin C. Wagner (Auteur), 2009, Green IT CIO-Briefing at T-Systems , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177984