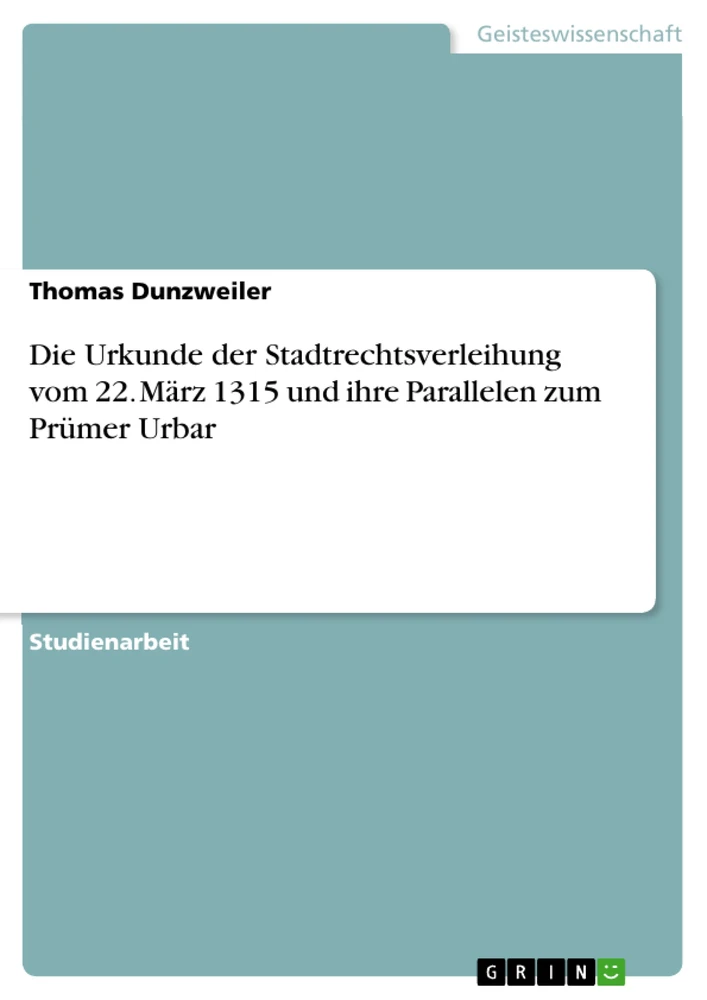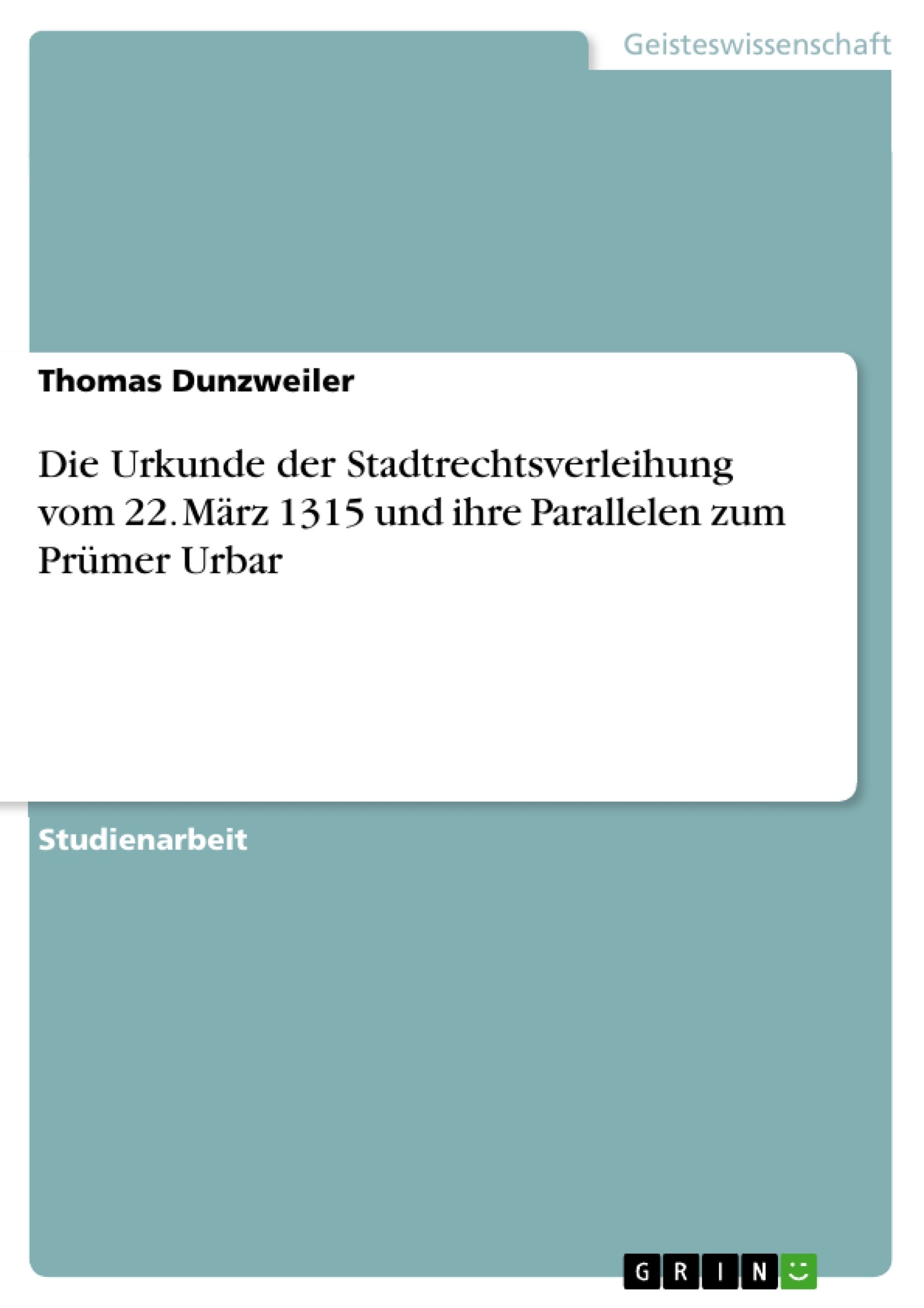Im Kurs "Alteuropäische Schriftkultur" zeichnet Prof. Dr. Ludolf Kuchenbuch die Überlieferungsgeschichte und die Wirkmächtigkeit des Prümer Urbars von 893 bis 2004 in einzelnen Stationen nach. Hier ist das Original verschollen, jedoch wurde 1222 eine Abschrift des Buches durch den Exabt Caesarius von Mylendonk angefertigt.
Die Stadt Meisenheim feiert im Jahr 2015 den 700. Jahrestag der Verleihung der Stadtrechte. Sie bezieht sich dabei auf eine Urkunde aus der Kanzlei Kaiser Ludwigs IV., genannt der Bayer, die am 22. März 1315 ausgestellt sein soll. In dieser Urkunde verleiht König Ludwig dem Grafen Georg von Veldenz für die ihm geleisteten treuen Dienste das Privileg zur Errichtung der Stadtmauer. Allerdings ist das Original der Urkunde verschollen und existiert nur als Abschrift im Kopialbuch der Stadt Meisenheim, welches der Rat der Stadt in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts hat anlegen lassen, um sich gegenüber dem Landesherr darauf berufen zu können.
Die Parallelen hinsichtlich des Verbleibes der Originalurkunden und der Anfertigung der Kopien als Einforderungsmöglichkeit von Rechten haben den Autor veranlasst, sich näher mit der Urkunde der Stadtrechtsverleihung und ihrer Abschrift zu beschäftigen. Dabei wird der Verfasser allerdings auch auf Unterschiede, die sich beispielsweise aus den unterschiedlichen Anlässen der Verfertigung der Urkunden ergeben, eingehen.
In seiner Arbeit wird der Verfasser zunächst die Auseinandersetzung und der Vergleich mit dem Prümer Urbar aufgrund des begrenzten Platzes der Arbeit in knapp zusammengefasster Weise durchführen. Gleichzeitig werden die Urkunde die Verleihung der Stadtrechte sowie ihre Abschrift in den Zusammenhang mit dem Kurs gestellt und erste Parallelen sowie Unterschiede aufgezeigt. In den folgenden Kapiteln werden Urkunde und Abschrift der Stadtrechtsverleihung in verkürzter Form in ihren historischen Kontext verbracht und auch hinsichtlich Gestalt und Inhalt untersucht. In einem kurzen Abriss wird der Autor anschließend auf Gründe, die für das Verschwinden der Urkunde verantwortlich sein könnten, eingehen, da auffälligerweise andere Urkunden des gleichen Zeitraumes noch heute existieren. Weiterhin zeigt der Verfasser in einem weiteren Punkt die Rezeption der Dokumente bis in die Neuzeit. Zum Abschluss seiner Arbeit fasst der Autor die gewonnenen Erkenntnisse kurz zusammen und gibt einen Ausblick über weitere mögliche Forschungsansätze hinsichtlich der Urkunden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Original und Abschrift - Das Prümer Urbar und die Parallelen zur Stadtrechtsurkunde von Meisenheim
- 2.1 Summarischer Abriss des Kurses Alteuropäische Schriftkultur und Einführung in die Parallelen und Unterschiede zwischen Urbar und Urkunde
- 2.2 Die Parallelen zwischen Urbar und Urkunde
- 2.3 Die Unterschiede zwischen Urbar und Urkunde
- 3. Historischer Kontext der Originalurkunde und der Abschrift
- 3.1 Gestalt, Inhalt und Verortung der Originalurkunde
- 3.2 Zeithorizont der Abschrift
- 4. Gründe für den Verlust der Urkunde
- 5. Rezeption der Dokumente bis in die jüngere Vergangenheit
- 6. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Parallelen zwischen der verschollenen Urkunde zur Stadtrechtsverleihung von Meisenheim (1315) und dem Prümer Urbar. Ziel ist es, den Verlust des Originals der Meisenheimer Urkunde im Kontext der Überlieferungsgeschichte des Prümer Urbars zu beleuchten und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede aufzuzeigen. Die Arbeit vergleicht die Entstehung, den Umgang mit den Abschriften und die Rezeption der Dokumente im Laufe der Jahrhunderte.
- Vergleich der Überlieferungsgeschichte der Meisenheimer Stadtrechtsurkunde und des Prümer Urbars
- Analyse der Gründe für den Verlust des Originals der Meisenheimer Urkunde
- Untersuchung der Parallelen zwischen der Anfertigung von Abschriften als Rechtsbeleg
- Rezeption der Dokumente über die Jahrhunderte
- Entwicklung der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit beiden Dokumenten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den historischen Kontext der Arbeit dar und führt in die Thematik ein. Sie beschreibt das Verschwinden des Originals der Meisenheimer Stadtrechtsurkunde von 1315 und die Existenz nur einer Abschrift im Kopialbuch der Stadt. Die Arbeit untersucht die Parallelen zum Prümer Urbar, dessen Original ebenfalls verschollen ist, aber durch eine Abschrift aus dem Jahr 1222 überliefert ist. Die Autorin kündigt den Vergleich der beiden Dokumente hinsichtlich Entstehung, Verlust des Originals und Rezeption an.
2. Original und Abschrift - Das Prümer Urbar und die Parallelen zur Stadtrechtsurkunde von Meisenheim: Dieses Kapitel beginnt mit einem kurzen Abriss des Kurses "Alteuropäische Schriftkultur" und der darin behandelten Überlieferungsgeschichte des Prümer Urbars. Es werden die Parallelen zwischen dem Urbar und der Meisenheimer Urkunde hinsichtlich des Verlusts des Originals und der Verwendung von Abschriften als Rechtsbeleg herausgearbeitet. Der Vergleich umfasst die unterschiedlichen Anlässe der Urkundenerstellung und die daraus resultierenden Unterschiede in der Gestaltung und dem Inhalt.
3. Historischer Kontext der Originalurkunde und der Abschrift: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Kontext der Meisenheimer Stadtrechtsurkunde und ihrer Abschrift. Es analysiert die Gestalt, den Inhalt und die Verortung der Originalurkunde, soweit dies anhand der Abschrift möglich ist. Weiterhin wird der Zeithorizont der Abschrift im Kopialbuch der Stadt Meisenheim eingegrenzt.
4. Gründe für den Verlust der Urkunde: Dieses Kapitel untersucht mögliche Gründe für den Verlust des Originals der Meisenheimer Stadtrechtsurkunde, insbesondere vor dem Hintergrund, dass andere gleichzeitige Urkunden erhalten geblieben sind. Hier werden verschiedene Hypothese diskutiert, die den Verlust erklären sollen.
5. Rezeption der Dokumente bis in die jüngere Vergangenheit: Dieses Kapitel beschreibt die Rezeption der Meisenheimer Stadtrechtsurkunde und ihrer Abschrift bis in die Neuzeit. Es analysiert, wie die Dokumente im Laufe der Geschichte verwendet und interpretiert wurden und welche Rolle sie in der lokalen und regionalen Geschichtsschreibung gespielt haben.
Schlüsselwörter
Prümer Urbar, Stadtrechtsurkunde Meisenheim, Abschrift, Originalverlust, Überlieferungsgeschichte, Rechtsbeleg, Kopialbuch, Alteuropäische Schriftkultur, mittelalterliche Urkunden, historische Quellenkritik.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: "Original und Abschrift - Das Prümer Urbar und die Parallelen zur Stadtrechtsurkunde von Meisenheim"
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Parallelen zwischen der verschollenen Stadtrechtsurkunde von Meisenheim (1315) und dem Prümer Urbar. Im Fokus steht der Verlust des Originals der Meisenheimer Urkunde im Kontext der Überlieferungsgeschichte des Prümer Urbars, sowie der Vergleich von Gemeinsamkeiten und Unterschieden beider Dokumente hinsichtlich Entstehung, Umgang mit Abschriften und Rezeption über die Jahrhunderte.
Welche Dokumente werden verglichen?
Verglichen werden die (verschollene) Originalurkunde zur Stadtrechtsverleihung von Meisenheim aus dem Jahr 1315 und das Prümer Urbar. Da die Originale beider Dokumente verloren sind, konzentriert sich der Vergleich auf die erhaltenen Abschriften.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Verlust des Originals der Meisenheimer Urkunde im Kontext der Überlieferungsgeschichte des Prümer Urbars zu beleuchten. Es sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Überlieferung, der Verwendung von Abschriften als Rechtsbeleg und der Rezeption der Dokumente im Laufe der Geschichte aufgezeigt werden.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Vergleich von Prümer Urbar und Meisenheimer Urkunde (inkl. Unterschiede und Parallelen), historischer Kontext der Originalurkunde und der Abschrift, Gründe für den Verlust der Urkunde, Rezeption der Dokumente und Zusammenfassung mit Ausblick.
Was wird im Kapitel "Original und Abschrift" behandelt?
Dieses Kapitel bietet zunächst einen Abriss des Kurses "Alteuropäische Schriftkultur" und der Überlieferungsgeschichte des Prümer Urbars. Im Anschluss werden Parallelen und Unterschiede zwischen dem Urbar und der Meisenheimer Urkunde hinsichtlich des Verlusts des Originals und der Nutzung von Abschriften als Rechtsbeleg herausgearbeitet. Der Vergleich umfasst auch die unterschiedlichen Anlässe der Urkundenerstellung und die daraus resultierenden Unterschiede in Gestaltung und Inhalt.
Wie wird der Verlust des Originals der Meisenheimer Urkunde untersucht?
Das Kapitel zu den Gründen des Verlusts diskutiert verschiedene Hypothesen, die den Verlust des Originals erklären sollen, insbesondere im Vergleich zum Erhalt anderer gleichzeitiger Urkunden.
Welche Rolle spielt die Rezeption der Dokumente?
Die Rezeption beider Dokumente wird über die Jahrhunderte hinweg untersucht. Es wird analysiert, wie die Dokumente verwendet und interpretiert wurden und welche Rolle sie in der lokalen und regionalen Geschichtsschreibung gespielt haben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Prümer Urbar, Stadtrechtsurkunde Meisenheim, Abschrift, Originalverlust, Überlieferungsgeschichte, Rechtsbeleg, Kopialbuch, Alteuropäische Schriftkultur, mittelalterliche Urkunden, historische Quellenkritik.
- Quote paper
- Thomas Dunzweiler (Author), 2011, Die Urkunde der Stadtrechtsverleihung vom 22. März 1315 und ihre Parallelen zum Prümer Urbar, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178014