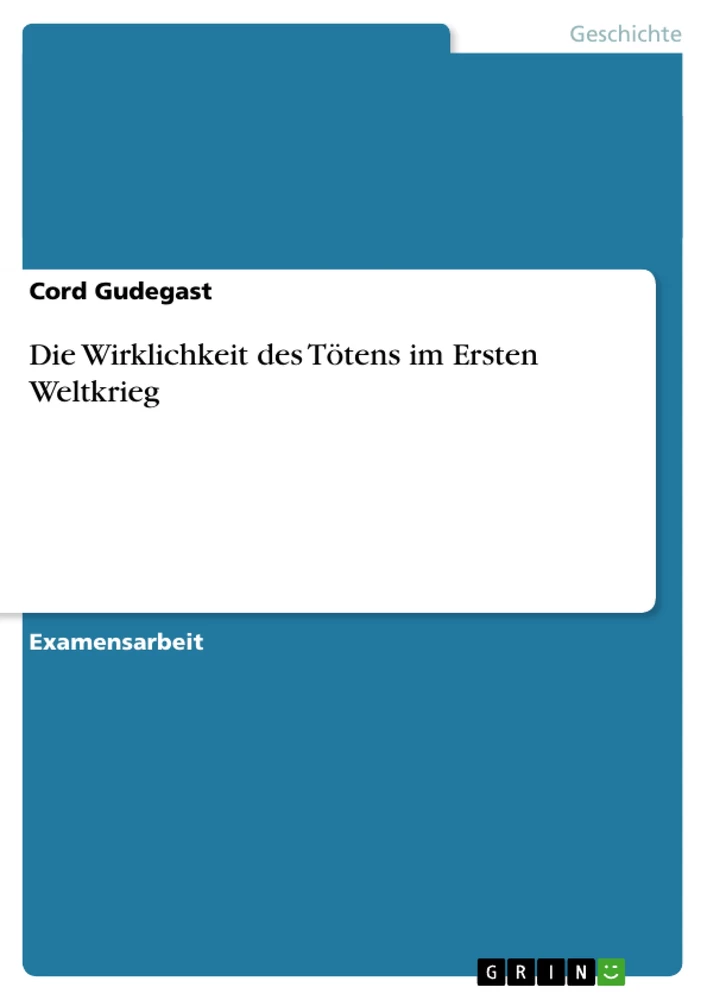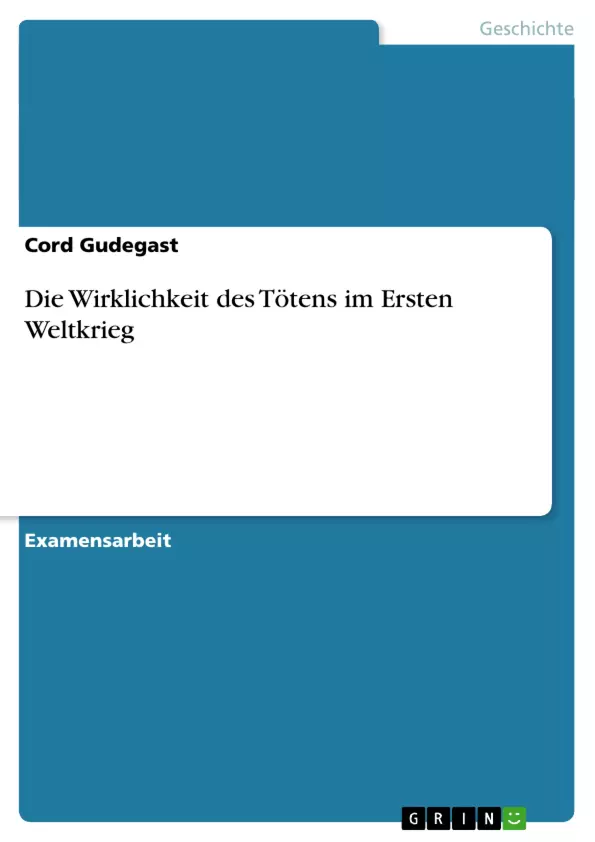[...]
Die deutsche Armee bestand in den Jahren 1914-1918 aus durchschnittlich 6,4
Millionen Soldaten. Insgesamt wurden 13,1 Millionen Menschen einberufen, von
denen ungefähr 2 Millionen ums Leben kamen und zirka 4,8 Millionen verwundet
wurden. Diese Soldaten schrieben über 28 Milliarden Briefe, von denen in der
Bibliothek für Zeitgeschichte in Stuttgart ca. 15.000 erhalten sind. Einige sind in
Quelleneditionen, wie z.B. in der hier u.a. verwendeten Sammlung Philipp Witkops1
zu finden. Eine Auswertung dieser Briefe muß demnach zwangsläufig lückenhaft bleiben, da
theoretisch eine Berücksichtigung der hier nicht verwendeten Zeugnisse ein völlig
anderes Bild zeichnen könnte. Wahrscheinlich ist dies jedoch nicht, denn die hier
benutzten Briefe und ihre zum Teil erschreckend deutlichen Schilderungen des
erlebten Grauens an der Front stammen aus unterschiedlichen
Gesellschaftsschichten, sie sind zu verschiedenen Zeiten während des Krieges
geschrieben worden. Die Soldaten haben sie sowohl von der Ost- wie auch von der
Westfront aus in die Heimat geschickt, und die Verfasser entstammen verschiedenen
Waffengattungen. Damit bilden sie zwar keinen repräsentativen Querschnitt durch
die verschiedenen Aspekte und Zeitabschnitte des Krieges zu Lande, denn dazu ist
die Quellenlage als solche zu unüberschaubar und viele der Briefe sind entweder
nicht zugänglich oder gar nicht mehr erhalten, doch sie zeigen aber eine Tendenz
auf: eine Tendenz, die Aufschluß über den Krieg und die Situation des Menschen in
seinem Angesicht bietet. Feldpostbriefe sind die Fingerabdrücke des Individuums in
der Geschichte, die zwar verschieden und einzigartig sind, sich aber dennoch sehr
ähneln, wie in dieser Arbeit gezeigt werden wird. Diese Arbeit konzentriert sich auf die Erlebnisse der Heeressoldaten, da der
Stellungskrieg, der Kampf mit Gas, Granaten, dem Bajonett und das zähe aber
sinnlose Ringen um wenige Meter Boden bezeichnend ist für den Ersten Weltkrieg. Die Auswertung der Quellen erfolgt weniger chronologisch als thematisch und die
verschiedenen Frontabschnitte werden gegenübergestellt und im Falle signifikanter
Unterschiede entsprechend ausgewertet.
1Genaueres über diese Edition in Hettling, Manfred u. Jeismann Michael , Der Weltkrieg als Epos – Philipp
Witkops „Kriegsbriefe gefallener Studenten , in: Hirschfeld, Gerhard , Krumreich , Gerd , Renz , Irina (Hg) ,
Keiner fühlt sich hier mehr als Mensch – Erlebnis und Wirkung des Ersten Weltkriegs , Essen 1993 , S. 205ff.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Leitfrage
- Forschungsbericht und Quellenlage
- Präludium: Der Weg in den Krieg
- Die Rolle der Jugendbünde
- Der,,Geist von 1914”
- Desillusionierung – die Begegnung mit dem Tode
- Der Stellungskrieg beginnt
- 1915 - Der Wunsch nach Frieden wird stärker
- Fallbeispiel: Kompensationsmöglichkeiten
- Andere Arten der Kompensation
- Exkurs: Die Rolle der Kirchen
- Klare Worte
- 1916 Sinnfragen werden deutlicher
- Der Opfertod
- Der Tod von Kameraden
- Die Natur als Kompensationsmittel
- Unterschiedliche Berichte
- Die Luftwaffe - ein anderer Blickwinkel
- Der Tod des Feindes
- Verbrüderung
- Der Tod von Franktireurs
- Der Tod durch Granaten und Minen
- Der Tod durch das Gewehr
- Der Tod durch Gas
- Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Wahrnehmung des Tötens im Ersten Weltkrieg durch die Soldaten. Sie untersucht, wie die Soldaten ihre Erlebnisse an der Front in Briefen an die Heimat beschrieben und wie sich ihre Akzeptanz des Krieges mit den anhaltenden Kämpfen entwickelte. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich die "Wirklichkeit des Tötens" im Ersten Weltkrieg auf die Soldaten auswirkte. Die Arbeit betrachtet dabei die unterschiedlichen Erlebnisse, Wünsche und Bedürfnisse der Soldaten, die durch Faktoren wie ihre soziale Herkunft beeinflusst wurden.
- Die Rolle von Briefen als Quelle für die Rekonstruktion der Kriegserfahrungen
- Die Veränderung der Wahrnehmung des Tötens im Verlauf des Krieges
- Die Auswirkungen des Stellungskrieges auf die Psyche der Soldaten
- Die verschiedenen Formen der Kompensation von Kriegstraumata
- Die Bedeutung der sozialen Herkunft für die Kriegserfahrung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Leitfrage und die Quellenlage der Arbeit vor. Sie erläutert, warum die Briefe der Soldaten eine wichtige Quelle für die Rekonstruktion des Krieges sind.
- Kapitel 1 betrachtet den Weg in den Krieg und die Rolle der Jugendbünde und des "Geistes von 1914" bei der Mobilisierung der Bevölkerung.
- Kapitel 2 beleuchtet die Desillusionierung der Soldaten im Stellungskrieg und die zunehmende Sehnsucht nach Frieden. Es untersucht die Möglichkeiten, mit den Kriegserfahrungen umzugehen.
- Kapitel 3 befasst sich mit dem Tod von Kameraden und den verschiedenen Formen der Bewältigung dieser Verluste.
- Kapitel 4 untersucht die Wahrnehmung des Feindes und die Möglichkeiten der Verbrüderung im Krieg.
- Kapitel 5 und 6 analysieren die Todesarten durch Granaten, Minen und Gewehrfeuer.
- Kapitel 7 behandelt die Todesart durch Giftgas.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie den Ersten Weltkrieg, die Kriegserfahrungen der Soldaten, die Wahrnehmung des Tötens, die Psychologie des Krieges, die Rolle der Briefe als Quelle und die Bedeutung sozialer Faktoren für die Kriegsrealität.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen Feldpostbriefe für die Erforschung des Ersten Weltkriegs?
Feldpostbriefe gelten als „Fingerabdrücke des Individuums“ und ermöglichen es, die subjektive Wirklichkeit des Krieges und die Psyche der Soldaten zu rekonstruieren.
Was versteht man unter dem „Geist von 1914“?
Damit ist die anfängliche Kriegsbegeisterung und die Mobilisierung der Bevölkerung zu Beginn des Krieges gemeint, die oft durch Jugendbünde gefördert wurde.
Wie veränderte der Stellungskrieg die Wahrnehmung der Soldaten?
Die Soldaten erlebten eine massive Desillusionierung; die anfängliche Begeisterung wich einer tiefen Sehnsucht nach Frieden und Sinnfragen angesichts des massenhaften Sterbens.
Welche Formen der Kompensation nutzten die Soldaten gegen das Trauma?
Die Arbeit nennt unter anderem die Naturbeobachtung, den Glauben (Rolle der Kirchen) und Kameradschaft als Mittel, um das Grauen an der Front zu verarbeiten.
Wie wird der Tod des Feindes in den Briefen thematisiert?
Die Berichte schwanken zwischen hasserfüllter Ablehnung und Momenten der Verbrüderung, wobei auch der Tod von Zivilisten (Franktireurs) eine Rolle spielt.
Welche Todesarten waren bezeichnend für den Ersten Weltkrieg?
Die Arbeit analysiert das Sterben durch Granaten, Minen, Gewehrfeuer, Bajonette und insbesondere den grausamen Tod durch Giftgas.
- Quote paper
- Cord Gudegast (Author), 2002, Die Wirklichkeit des Tötens im Ersten Weltkrieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17816