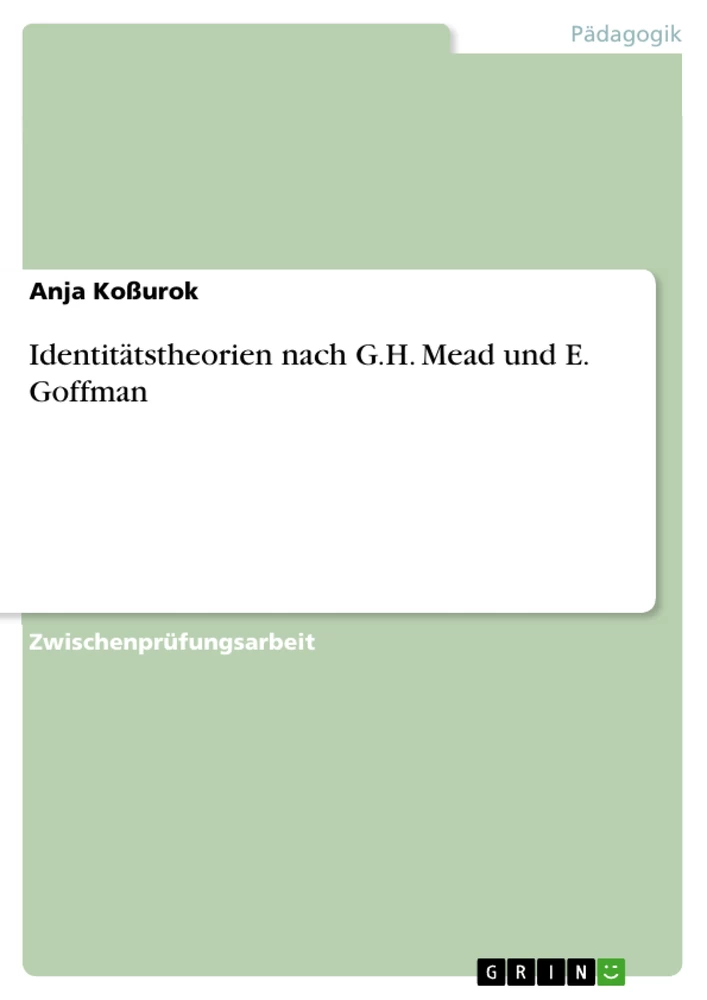Diese Arbeit behandelt die Identitätstheorien nach Mead und Goffman und arbeitet ihre Bedeutung für heute pädagogische Aufgabenfelder heraus.
Inhaltsverzeichnis
- Der symbolische Interaktionismus
- Die Identitätstheorie nach Georg Herbert Mead
- Vom Kind zum gesellschaftlich moralischen Wesen
- Von der Geste zur Sprache
- Die Identität bei Mead
- Die Identitätstheorie nach Erving Goffman
- Die Rolle und die Darstellungen
- Die Ensemble-Darstellung
- Funktionen der Vorder- und Hinterbühnen und ihrer Geheimnisse
- Kommunikation
- Kritik und Stellenwert
- Fazit der Mead'schen Identitätstheorie
- Fazit der Goffman -schen Identitätstheorie
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Zwischenprüfungsarbeit analysiert die Identitätstheorien von Georg Herbert Mead und Erving Goffman, zwei zentralen Vertretern des symbolischen Interaktionismus. Die Arbeit soll die Entstehung und Entwicklung von Identität im Kontext gesellschaftlicher Interaktionsprozesse beleuchten und die jeweiligen theoretischen Ansätze kritisch bewerten.
- Die Entstehung von Identität im gesellschaftlichen Interaktionsprozess
- Die Bedeutung von Sprache und Symbolen für die Identitätsentwicklung
- Die Rolle der sozialen Interaktion und Kommunikation für die Konstruktion von Identität
- Die Bedeutung von Rollen und Darstellungen für die Gestaltung von Identität
- Die Kritik an den Identitätstheorien von Mead und Goffman und deren Stellenwert für die heutige soziologische, pädagogische und psychologische Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in den symbolischen Interaktionismus ein und erläutert dessen Grundannahmen. Es wird gezeigt, dass der Ansatz von Georg Herbert Mead (1863-1931) geprägt ist vom Pragmatismus und Behaviorismus. Mead argumentiert, dass menschliches Verhalten an der gegebenen Umwelt orientiert ist und dass Handeln über Denken gestellt werden sollte.
Das zweite Kapitel befasst sich mit Mead's Identitätstheorie. Es wird dargelegt, dass Identität nicht von Geburt an vorhanden ist, sondern sich innerhalb des gesellschaftlichen Interaktionsprozesses entwickelt. Mead beschreibt die Bedeutung von signifikanten Symbolen, Sprache und der Internalisierung von Haltungen für die Entstehung von Identität. Das Konzept des "Self" als Symbiose aus ICH und Ich wird vorgestellt.
Das dritte Kapitel widmet sich Erving Goffman's (1922-1982) Identitätstheorie. Goffman erweitert Mead's Ansatz und beschreibt Identität als einen Entwurf, der dramaturgisch aufrechterhalten werden muss. Er beleuchtet die Bedeutung von Rollen und Darstellungen für die Gestaltung von Identität und die Funktionen von Vorder- und Hinterbühnen für die Inszenierung des Selbst.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Kritik an den Identitätstheorien von Mead und Goffman. Es werden die Schwächen der Ansätze, insbesondere im Hinblick auf die Berücksichtigung von Machtstrukturen und die Analyse von postmodernen Gesellschaften, aufgezeigt. Der Stellenwert der Theorien für die heutige soziologische, pädagogische und psychologische Forschung wird diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den symbolischen Interaktionismus, Identitätstheorien, Georg Herbert Mead, Erving Goffman, Sprache, Symbole, soziale Interaktion, Kommunikation, Rollen, Darstellungen, Vorder- und Hinterbühnen, Kritik, Stellenwert, soziologische Forschung, pädagogische Forschung, psychologische Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist symbolischer Interaktionismus?
Es ist eine soziologische Theorie, nach der Identität und soziale Realität durch Interaktionsprozesse und die Deutung von Symbolen und Sprache entstehen.
Wie entsteht Identität nach George Herbert Mead?
Identität ("Self") entwickelt sich durch die Übernahme von Rollen und die Internalisierung der Haltungen anderer. Sie besteht aus dem impulsiven "I" (Ich) und dem gesellschaftlichen "Me" (Mich).
Was beschreibt Erving Goffman in seiner Identitätstheorie?
Goffman nutzt eine dramaturgische Metapher: Menschen inszenieren ihr Selbst auf einer "Vorderbühne" für ein Publikum, während sie sich auf der "Hinterbühne" davon erholen.
Welche Rolle spielt die Sprache bei Mead?
Sprache ist das System signifikanter Symbole, das es Menschen ermöglicht, die Reaktionen anderer vorwegzunehmen und so ihr eigenes Verhalten gesellschaftlich abzustimmen.
Was kritisieren moderne Forscher an Mead und Goffman?
Kritisiert wird oft die Vernachlässigung von Machtstrukturen und die Schwierigkeit, diese Theorien auf die komplexen Bedingungen postmoderner Gesellschaften anzuwenden.
- Quote paper
- Anja Koßurok (Author), 2010, Identitätstheorien nach G.H. Mead und E. Goffman, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178186