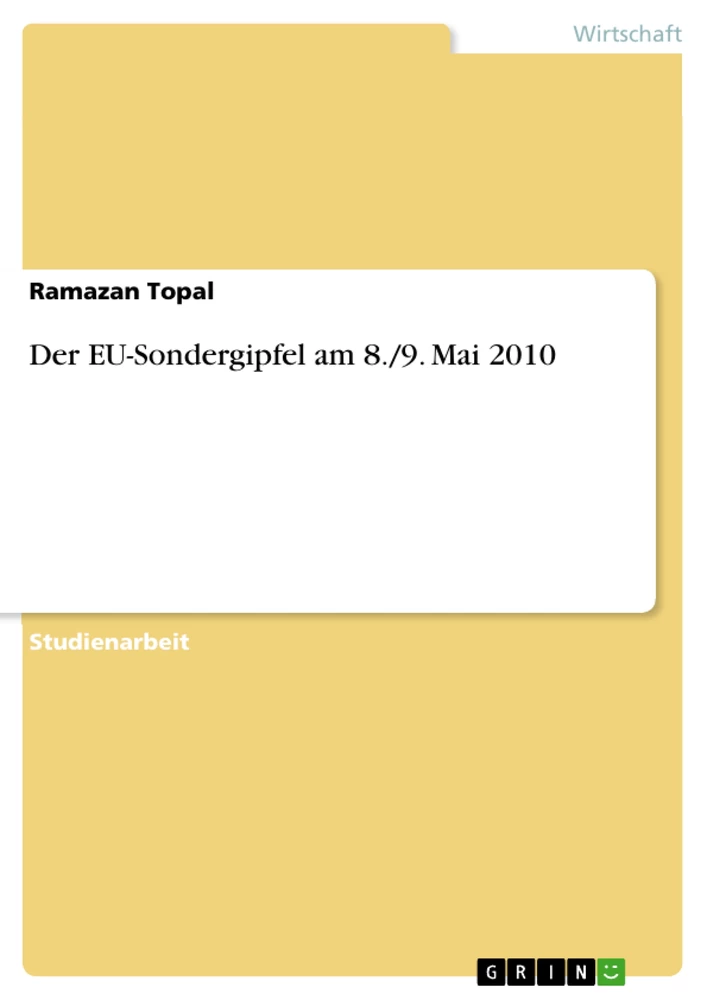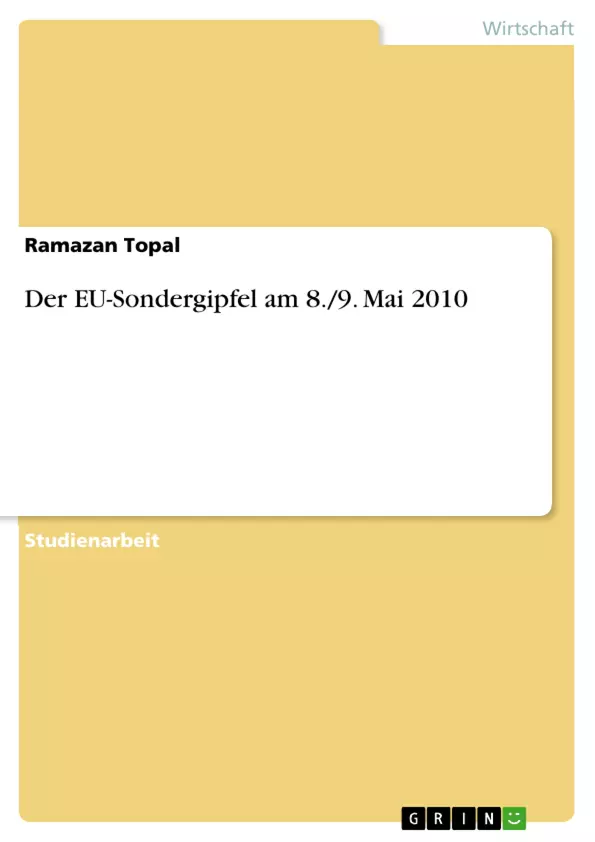Können Staaten bankrottgehen? Argentinien und Russland sind Beispiele aus jüngerer Vergangenheit, dass nicht nur Privatpersonen und Unternehmen sondern auch Staaten pleitegehen können. Im Fall Griechenland haben Schulden, Korruptionen, ein Leben über die Verhältnisse und insbesondere die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit den Mittelmeerstaat in den Abgrund geführt. Der Unterschied zu den beiden erst genannten Ländern ist, dass die Hellenen, die gerade einmal 2,5% zur Wirtschaftsleistung der Euro-16-Zone beitragen, sich zunehmend zu einem systemrelevanten Risiko entwickelt haben. Die griechische Schuldenkrise beeinflusste folglich nicht nur Griechenland, sondern zeitgleich auch die gesamte Europäische Währungsunion. Im Frühjahr 2010 konnte Griechenland mit finanzieller Unterstützung in dreistelliger Milliardenhöhe vor der Zahlungsunfähigkeit vorerst bewahrt werden. Zur Stabilisierung der Finanzlage in Europa und die Ansteckung auf andere Euroländer zu verhindern wurde am 9. Mai 2010 ein umfassendes Rettungspaket geschnürt.
Die Eurokrise hat die erheblichen Ungleichgewichte in der Währungsunion ans Licht gebracht. Elf Jahre nach der Einführung des Euro als Buchgeld treten die Konstruktionsfehler zutage.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Problemstellung
- Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- Der EU-Sondergipfel
- Gründe für die Einberufung
- Beschlüsse
- Umfeldanalyse
- Finanzielle Schieflage ausgewählter Länder
- Griechenland
- Irland
- Spanien
- Die weltweite Finanzkrise
- Weitere Rahmenbedingungen
- Finanzielle Schieflage ausgewählter Länder
- Ursachenanalyse
- Innereuropäische Ungleichgewichte
- Einflüsse der weltweiten Finanzkrise
- Defizitäre Staatshaushaltsführung
- Bewertung der Beschlüsse und alternative Handlungsmöglichkeiten
- Fazit
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem EU-Sondergipfel am 8./9. Mai 2010 und analysiert die Hintergründe, die Beschlüsse und die Ursachen der Eurokrise. Die Arbeit bietet eine kompakte Übersicht über die Ereignisse und liefert eine kritische Betrachtung der Situation.
- Die Gefährdung der Bonität einzelner europäischer Länder und ihre Fähigkeit sich weiterhin zu niedrigen Zinsen zu verschulden
- Die erheblichen Ungleichgewichte in der Währungsunion und die Konstruktionfehler des Euros
- Die Ursachen der Eurokrise, insbesondere die innereuropäischen Ungleichgewichte, die Einflüsse der weltweiten Finanzkrise und die defizitäre Staatshaushaltsführung
- Die Bewertung der Beschlüsse des EU-Sondergipfels und die Diskussion alternativer Handlungsmöglichkeiten
- Die Herausforderungen der Eurozone und die Notwendigkeit einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Eurokrise ein und stellt die Problemstellung dar. Der Fokus liegt dabei auf der Gefährdung der Bonität einzelner europäischer Länder und der Auswirkungen auf die gesamte Währungsunion. Der EU-Sondergipfel am 8./9. Mai 2010 wird im zweiten Kapitel beleuchtet. Die Gründe für die Einberufung der Krisensitzung, die Gefährdung der Bonität einzelner europäischer Länder und die damit verbundenen Risiken, werden analysiert. Anschließend werden die Beschlüsse des Gipfels, insbesondere die Einführung des Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM) und der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF), dargestellt.
Im dritten Kapitel wird die Umfeldanalyse durchgeführt. Die finanziellen Schieflagen ausgewählter Länder, insbesondere Griechenland, Irland und Spanien, werden dargestellt. Die weltweite Finanzkrise und ihre Auswirkungen auf die Eurozone werden erläutert. Darüber hinaus werden weitere Rahmenbedingungen, wie die Rolle der Ratingagenturen, beleuchtet.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Ursachenanalyse der Eurokrise. Die innereuropäischen Ungleichgewichte, insbesondere die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der südeuropäischen Euroländer, werden analysiert. Die Einflüsse der weltweiten Finanzkrise auf die Staatshaushalte der Euroländer werden dargestellt. Abschließend wird die defizitäre Staatshaushaltsführung der GIPS-Länder im Kontext des Stabilitäts- und Wachstumspakts beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den EU-Sondergipfel, die Eurokrise, die Finanzstabilität, die Bonität, die Staatsverschuldung, die innereuropäischen Ungleichgewichte, die weltweite Finanzkrise, die Ratingagenturen, der Stabilitäts- und Wachstumspakt, der Europäische Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM), die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF), die GIPS-Länder (Griechenland, Irland, Portugal und Spanien) und die gemeinsame Wirtschaftspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel des EU-Sondergipfels im Mai 2010?
Ziel war die Schnürung eines Rettungspakets zur Stabilisierung der Eurozone und zur Verhinderung eines Staatsbankrotts Griechenlands sowie einer Ansteckung anderer Länder.
Was sind EFSM und EFSF?
Es handelt sich um den Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus und die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität, die als Schutzschirme für verschuldete Euroländer geschaffen wurden.
Warum geriet Griechenland in die Krise?
Ursachen waren hohe Staatsverschuldung, mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, Korruption und eine Haushaltsführung, die über die Verhältnisse des Landes hinausging.
Welche Konstruktionsfehler des Euro traten zutage?
Die Krise offenbarte die fehlende gemeinsame Wirtschaftspolitik und die erheblichen wirtschaftlichen Ungleichgewichte zwischen den Mitgliedstaaten der Währungsunion.
Welche Rolle spielten Ratingagenturen in der Eurokrise?
Ratingagenturen beeinflussten die Krise durch Herabstufungen der Bonität, was die Zinsen für Staatsanleihen in die Höhe trieb und die Refinanzierung erschwerte.
- Citar trabajo
- Ramazan Topal (Autor), 2011, Der EU-Sondergipfel am 8./9. Mai 2010, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178218