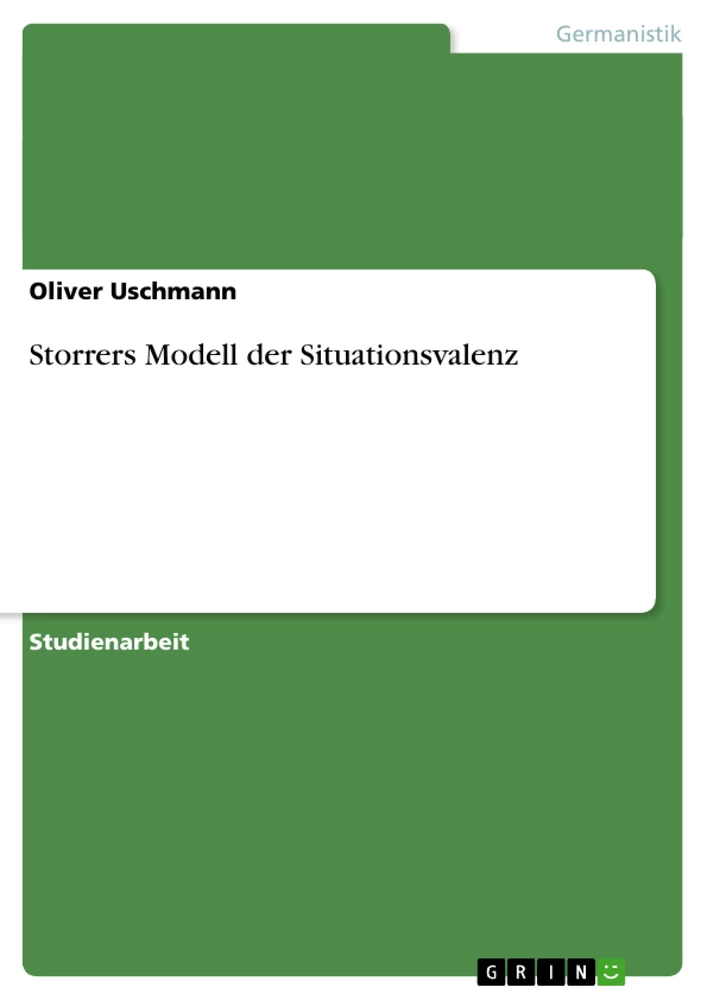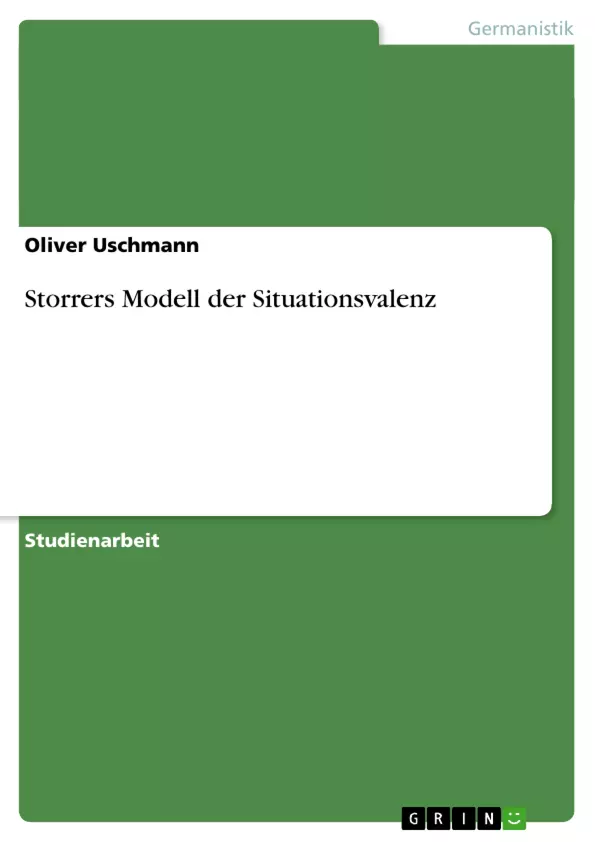"Man kann so das Verb mit einem Atom vergleichen, an dem Häkchen angebracht sind, so daß es – je nach der Anzahl der Häkchen – eine wechselnde Zahl von Aktanten an sich ziehen und in Abhängigkeit halten kann. Die Anzahl der Häkchen, die ein Verb aufweist, und dementsprechend die Anzahl der Aktanten, die es regieren kann, ergibt das, was man die Valenz des Verbs nennt." (Tesniere)
Mit diesem Bild begann 1959 eine bedeutende linguistische Strömung, die bis heute als eine der einflussreichsten grammatischen Theorien gilt. Zwar sprach bereits Bühler 1934 prophetisch von "Wahlverwandschaften" und "Leerstellen", die jedes Wort um sich eröffne, doch der Siegeszug der Valenztheorie begann erst mit Tesnieres Metapher. Zahlreiche Fragen eröffneten sich. Welche Verben verteilen welche Rollen? Wann ist eine Ergänzung fakultativ und wann obligatorisch? Wo liegt die Grenze zwischen manchen fakultativen Ergänzungen und Angaben? Wie ist das Verhältnis von Valenzpotenz und Valenzrealisierung? Unzählige Theorien betraten den wissenschaftlichen Kampfplatz, bis nur noch ein unentwirrbares Knäuel zu sehen war. Dann trat 1992 die eine Theorie auf den Plan, die das Knäuel entwirrte und Linguisten weltweit aufhorchen ließ. "Ein theoretisch-methodisches Meisterstück" jubelte Vilmos Agel und er jubelte mit Recht. Angelika Storrers Modell der "Situationsvalenz" brachte den Durchbruch.
Die vorliegende Arbeit stellt dieses Modell vor und illustriert es mit vielen Beispielen, so dass der abstrakte Stoff fassbar und verständlich wird. Sie bleibt terminologisch bei der Begrifflichkeit Storrers, arbeitet aber mit einer bildlichen, leicht zugänglichen Sprache. Sie ordnet Storrers Modell im Kontext der konkurrierenden Theorien ein und wagt schließlich einen Blick über den Tellerrand: Hat diese Theorie etwa auch Gemeinsamkeiten mit großen sprachphilosophischen Fragen? Ist sie mehr als "nur" perfektes Handwerk? Warum führt der Weg von ihr mühelos zu Humboldt und Chomsky? Eine Kür, die das Wirken der Sprachtheorien im Allgemeinen zum Schluss hin sichtbar macht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundüberlegungen des Modells
- Die „statische Modellkomponente: Die valenzrelevanten Parameter“ (s. ebd.:260-273)
- Wissensbezogene Parameter (s. ebd.:261-267)
- „GS/S (Gesetzesbereich des Sprechers)“ (s. ebd.:265-266)
- „GS/H/S (Der Gesetzesbereich des Hörers aus Sprechersicht)“ (s. ebd.:266-267)
- „INF/S (Informationsstand des Sprechers)“ (s. ebd.:263-264)
- „INF/H/S (Der Informationsstand des Hörers aus Sprechersicht)“ (s. ebd.:264-265)
- „Situationsbezogene Parameter“ (s. ebd.: 267-273)
- „t-p/U: Raum-Zeitliche Koordination der Äußerung“ (s. ebd.:269-270)
- „Sit-Typ(Sit): Situationstyp der Äußerungssituation“ (s. ebd.:270-271)
- „AM/ (t/U): Momentaner Aufmerksamkeitsbereich“ (s. ebd.: 271-272)
- „INT (t/U) / S : Momentane Interessenlage des Sprechers“ (s. ebd.: 272-273)
- „Dynamische Modellkomponente: Das Zusammenspiel der Parameter“ (s. ebd.: 273-292)
- „Schritt 1: Situationsangemessene Rollenwahl“ (s. ebd.:274-281)
- „Sprecherwissens-Filter“ (s. ebd.:277)
- „Hörerwissens-Filter“ (s. ebd.:277-278)
- „Relevanz-Filter“ (s. ebd.:278)
- „Situations-Filter“ (s. ebd.:278)
- „Gesetzeswissen-Filter“ (s. ebd.:278-279)
- „Interessens-Filter“ (s. ebd.:279)
- „Schritt 2: Wahl eines valenzgeeigneten Verbs“ (s. ebd.:281-292)
- Die „Frames“ Basis für das „Pattern-Matching“
- „Pattern-Matching 1“ (s. ebd.:289-291)
- „Pattern-Matching 2“ (s. ebd.:291-292)
- Zusammenfassung
- Die Bedeutung des Modells für die Valenztheorie
- Der geistige Charakter des Modells der Situationsvalenz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Modell der „Situationsvalenz“ von Angelika Storrer. Das Ziel ist es, das Modell vorzustellen, zusammenzufassen und seine Bedeutung für die Valenztheorie zu beleuchten. Darüber hinaus wird der Charakter des Modells in Hinblick auf andere Sprachtheorien und Sprachphilosophien betrachtet.
- Vorstellung und Zusammenfassung des Modells der „Situationsvalenz“
- Bedeutung des Modells für die Valenztheorie
- Der geistige Charakter des Modells der Situationsvalenz
- Einordnung des Modells in andere Sprachtheorien und Sprachphilosophien
- Analyse der „statischen“ und „dynamischen“ Modellkomponenten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt den Kontext der Valenztheorie dar und führt Storrers Modell der „Situationsvalenz“ als wegweisende Theorie ein. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und erklärt die gewählte Terminologie.
- Grundüberlegungen des Modells: Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Annahmen von Storrers Modell, insbesondere die Annahme, dass die Valenz eines Verbs nicht starr ist, sondern von Situation zu Situation variiert. Es erklärt den Begriff des „Situationstyps“ und die „Situationsrollen“, die in jeder Situation relevant sind.
- Die „statische Modellkomponente: Die valenzrelevanten Parameter“: Dieses Kapitel beschreibt die „statischen“ Parameter, die als Prinzipien für alle Menschen gelten und die Grundlage für die „dynamische“ Modellkomponente bilden. Es werden die „wissensbezogenen“ und die „situationsbezogenen“ Parameter erläutert.
- „Dynamische Modellkomponente: Das Zusammenspiel der Parameter“: Dieses Kapitel beschreibt die „dynamische“ Modellkomponente, die das Zusammenspiel der Parameter im Kopf des Sprechers bei der Auswahl von Verben und ihren Ergänzungen beschreibt. Es erläutert die „Filter“, die in der „Rollenwahl“ und der „Verbwahl“ relevant sind.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt das Modell der „Situationsvalenz“ von Angelika Storrer. Es werden die Kernelemente der Theorie, wie „Situationsrollen“, „statische Modellkomponente“, „dynamische Modellkomponente“ und „Filter“, ausführlich beleuchtet. Die Arbeit befasst sich mit der Bedeutung des Modells für die Valenztheorie und untersucht den geistigen Charakter des Modells im Kontext anderer Sprachtheorien und Sprachphilosophien.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Modell der Situationsvalenz?
Das von Angelika Storrer entwickelte Modell besagt, dass die Valenz eines Verbs nicht starr ist, sondern je nach Kommunikationssituation variiert.
Was sind die statischen Modellkomponenten bei Storrer?
Die statischen Komponenten umfassen wissensbezogene Parameter (wie den Informationsstand von Sprecher und Hörer) und situationsbezogene Parameter (wie Raum und Zeit).
Wie funktioniert die dynamische Modellkomponente?
Sie beschreibt das Zusammenspiel der Parameter im Kopf des Sprechers, insbesondere die Filter bei der Rollenwahl und der Auswahl eines passenden Verbs.
Welche Bedeutung hat das Modell für die Linguistik?
Es gilt als "Meisterstück", das die oft unübersichtlichen Theorien der Valenzgrammatik entwirrt und eine Verbindung zu sprachphilosophischen Fragen herstellt.
Was ist ein "Situations-Filter" im Sinne des Modells?
Es ist ein Teil der dynamischen Komponente, der hilft, die angemessenen Rollen und Ergänzungen basierend auf der aktuellen Situation auszuwählen.
Womit vergleicht Tesnière das Verb in seiner Metapher?
Tesnière vergleicht das Verb mit einem Atom, an dem "Häkchen" (Aktanten) angebracht sind, die dessen Valenz bestimmen.
- Quote paper
- Oliver Uschmann (Author), 2000, Storrers Modell der Situationsvalenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17825