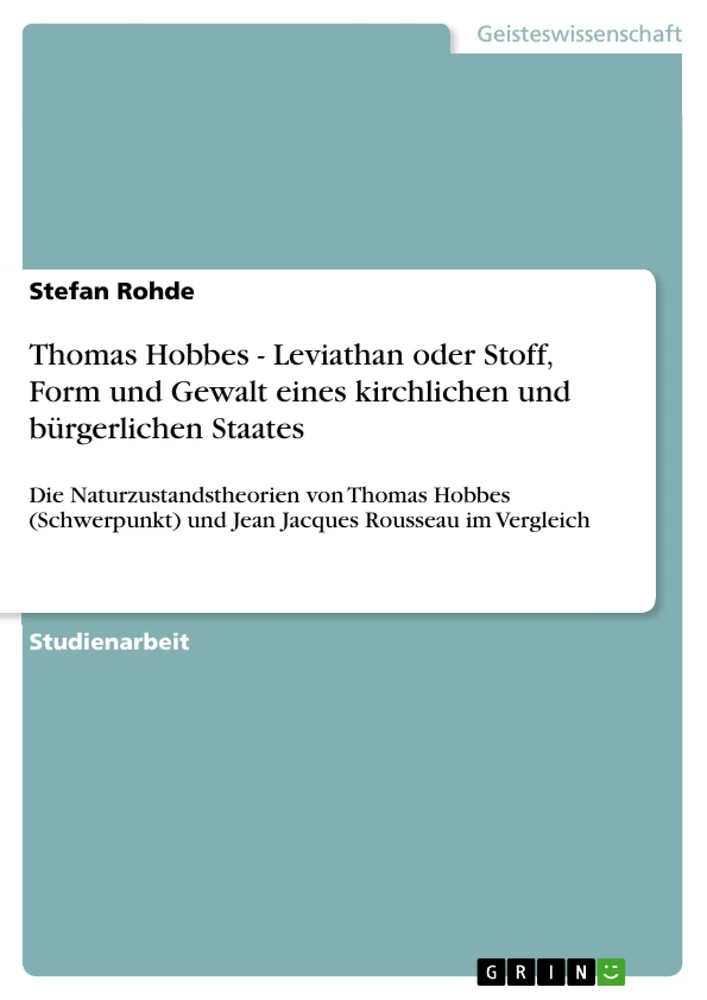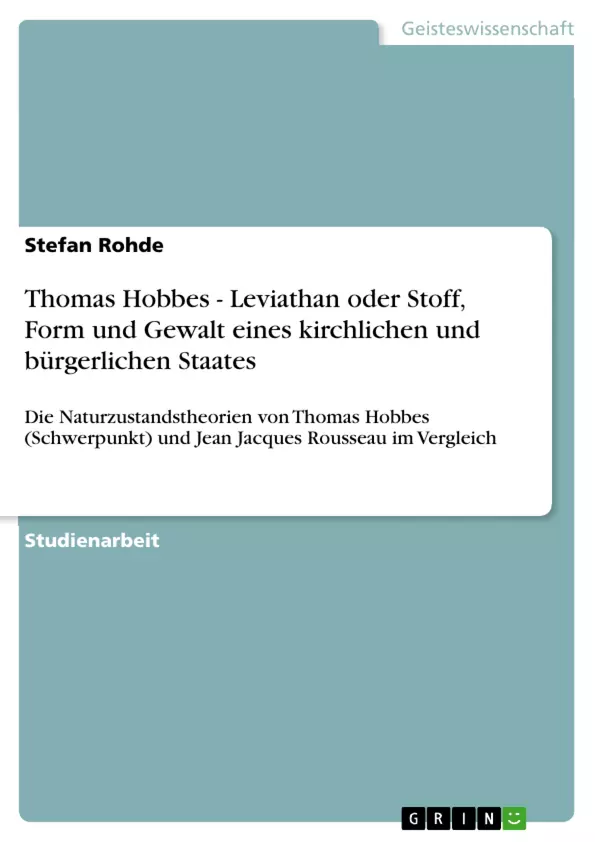Eine sehr wichtige und schon früh gestellte Frage der politischen Philosophie lautet, wie das Verhältnis zwischen der Freiheit des Einzelmenschen und der politischen Ordnung beschaffen sein soll. Mit der Aussage, der Mensch sei ein von Natur aus politisches Wesen („Anthopos zoon physei estin"), prägte Aristoteles bis in die Neuzeit das europäische Verständnis des Menschen und seiner politischen Lebensverhältnisse. Aristoteles war der Auffassung, die Menschen hätten seit Beginn der Menschheitsgeschichte in „politischen und sozialen Verbänden wie Familien und staatlichen Gemeinwesen zusammengelebt, während Hobbes ihm widersprach, indem er behauptete, dass eine umfassende Vergesellschaftung erst durch einen Gesellschaftsvertrag zustande kommt, den ein jeder mit jedem abschließt.“ Hierarchien waren (vom Sklavenstand bis zum Vollbürger) für Aristoteles legitim, weil in den genannten „Vergesellschaftungs-formen“ Individuen leben, die von Natur aus unterschiedlich wert sind. Bis zur Ausbreitung der Moral - und Rechtsphilosophie Immanuel Kants im 18. Jahrhundert, war der politische Aristotelismus in Deutschland „unbezweifelte Grundlage der gesellschaftlichen und politischen Selbstverständigung in Philosophie und Wissenschaft“.
In dieser Arbeit möchte ich die Frage klären, welche Ansichten von Hobbes und Rousseaus (beschränkt auf Teile ihrer politischen Philosophie) für Furore gesorgt und nachhaltig gewirkt haben. Im Einzelnen betrifft das die Fragen danach, wie der vorstaatliche Naturzustand bei Hobbes („Krieg aller gegen alle“) und Rousseau („Der Mensch wird frei geboren und überall liegt er in Ketten“) im
Vergleich aussieht, wobei der, wie in der Themenformulierung bereits angekündigt, Schwerpunkt auf Hobbes Theorie liegen soll (Da im Seminar Hobbes „Leviathan“ Gegenstand der Betrachtungen war, möchte ich ihm auch in dieser Arbeit mehr Beachtung schenken). Der Gedanke, es gebe einen Naturzustand, in dem all das vom Menschen Erdachte und Geschaffene fehlt, findet sich, nebenbei bemerkt, bereits bei Platon (Platon, Theaitetos, Seite 139, Reinbek 1958) Desweiteren soll erläutert werden, inwiefern es im Naturzustand Gesetze gibt und welche Bedeutung Begriffe wie Recht und Unrecht haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Der Naturzustand bei Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau
- Gleichheit der Menschen hinsichtlich ihrer physischen und psychischen Konstellation bei Hobbes
- Selbsterhaltungsstreben/Streben nach Macht (Hobbes)
- Hobbes Naturzustand im Gegensatz zum zivilisierten Gemeinwesen
- Rousseaus sprachloser Naturmensch: ausgestattet mit den Eigenschaften des Mitleidens und der Selbstliebe
- Rousseaus Ausweg aus dem Naturzustand und dessen Folgen für den vergesellschafteten Menschen
- Der Naturzustand bei Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau
- Schlussbemerkungen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie das Verhältnis zwischen der Freiheit des Einzelmenschen und der politischen Ordnung gestaltet sein soll. Im Fokus stehen die Naturzustandstheorien von Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau, wobei der Schwerpunkt auf Hobbes' Theorie liegt. Die Arbeit analysiert die Konzepte des Naturzustands bei beiden Denkern, beleuchtet die Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihrer Ansichten und untersucht die Bedeutung von Begriffen wie Recht, Unrecht, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit im Naturzustand. Darüber hinaus werden die Motive für den Übergang vom Naturzustand zum Gesellschaftszustand und die Folgen der Vergesellschaftung für den Menschen analysiert.
- Der Naturzustand als Gedankenexperiment und dessen Bedeutung für die politische Theorie
- Die Rolle der Leidenschaften und der Vernunft im Naturzustand
- Der Gesellschaftsvertrag als Ausweg aus dem Naturzustand
- Die Bedeutung von Freiheit und Unfreiheit im Naturzustand und im Gesellschaftszustand
- Die Folgen der Vergesellschaftung für den Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die zentrale Fragestellung nach dem Verhältnis von Freiheit und politischer Ordnung vor. Sie skizziert den historischen Kontext und die Bedeutung der Naturzustandstheorien für die politische Philosophie.
Der Hauptteil der Arbeit widmet sich den Naturzustandstheorien von Hobbes und Rousseau. Das erste Kapitel analysiert die Konzepte des Naturzustands bei beiden Denkern und beleuchtet die Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihrer Ansichten. Hobbes' Naturzustand ist geprägt von einem „Krieg aller gegen alle", in dem jeder Mensch um seine Selbsterhaltung kämpft und sein Streben nach Macht ungezügelt ist. Rousseau hingegen zeichnet ein Bild eines „edlen Wilden", der im Naturzustand frei und gut ist, aber durch die Vergesellschaftung korrumpiert wird.
Das zweite Kapitel untersucht die Bedeutung von Begriffen wie Recht, Unrecht, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit im Naturzustand. Hobbes argumentiert, dass im Naturzustand keine Gesetze und somit auch keine Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit existieren. Rousseau hingegen sieht im Naturzustand ein natürliches Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung.
Das dritte Kapitel analysiert die Motive für den Übergang vom Naturzustand zum Gesellschaftszustand. Hobbes sieht in der Todesangst und dem Streben nach Sicherheit den wichtigsten Antrieb für die Bildung eines Staates. Rousseau hingegen betont die Rolle der Perfektibilität, die den Menschen dazu treibt, sich zu vervollkommnen und die Gesellschaft zu bilden.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den Folgen der Vergesellschaftung für den Menschen. Hobbes sieht im Staat die Garantie für Sicherheit und Ordnung, während Rousseau die Vergesellschaftung als eine Quelle der Entfremdung und Unfreiheit betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Naturzustand, die politische Philosophie, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Freiheit, Unfreiheit, Selbsterhaltung, Macht, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, Gesellschaftsvertrag, Vergesellschaftung, Mitleid, Selbstliebe, Perfektibilität, Vernunft und Leidenschaften.
- Quote paper
- Stefan Rohde (Author), 2010, Thomas Hobbes - Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178343