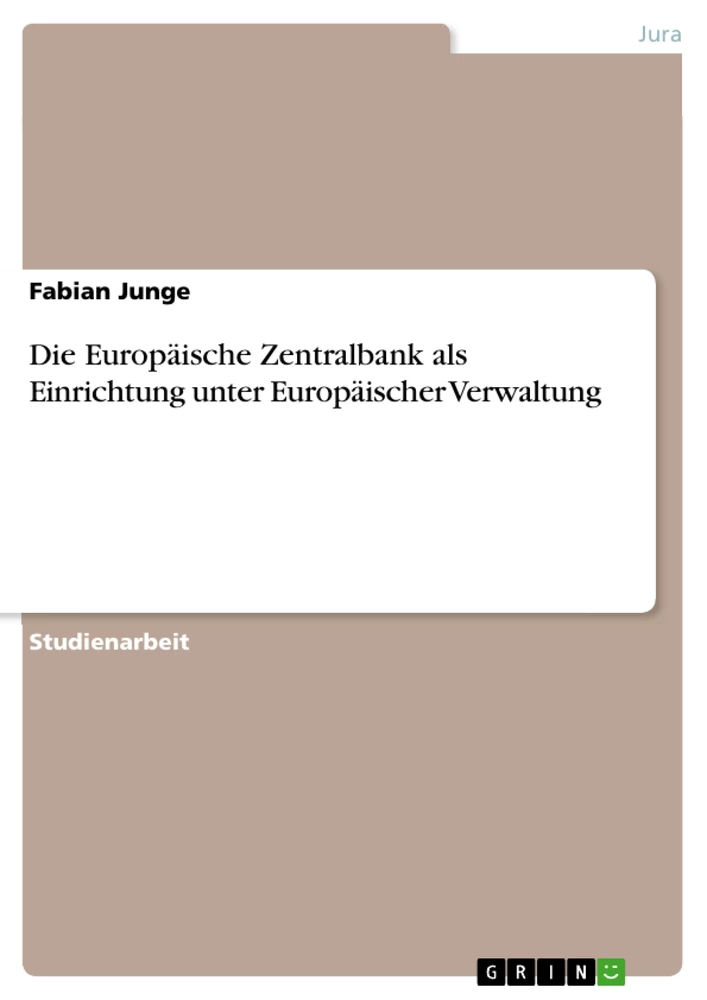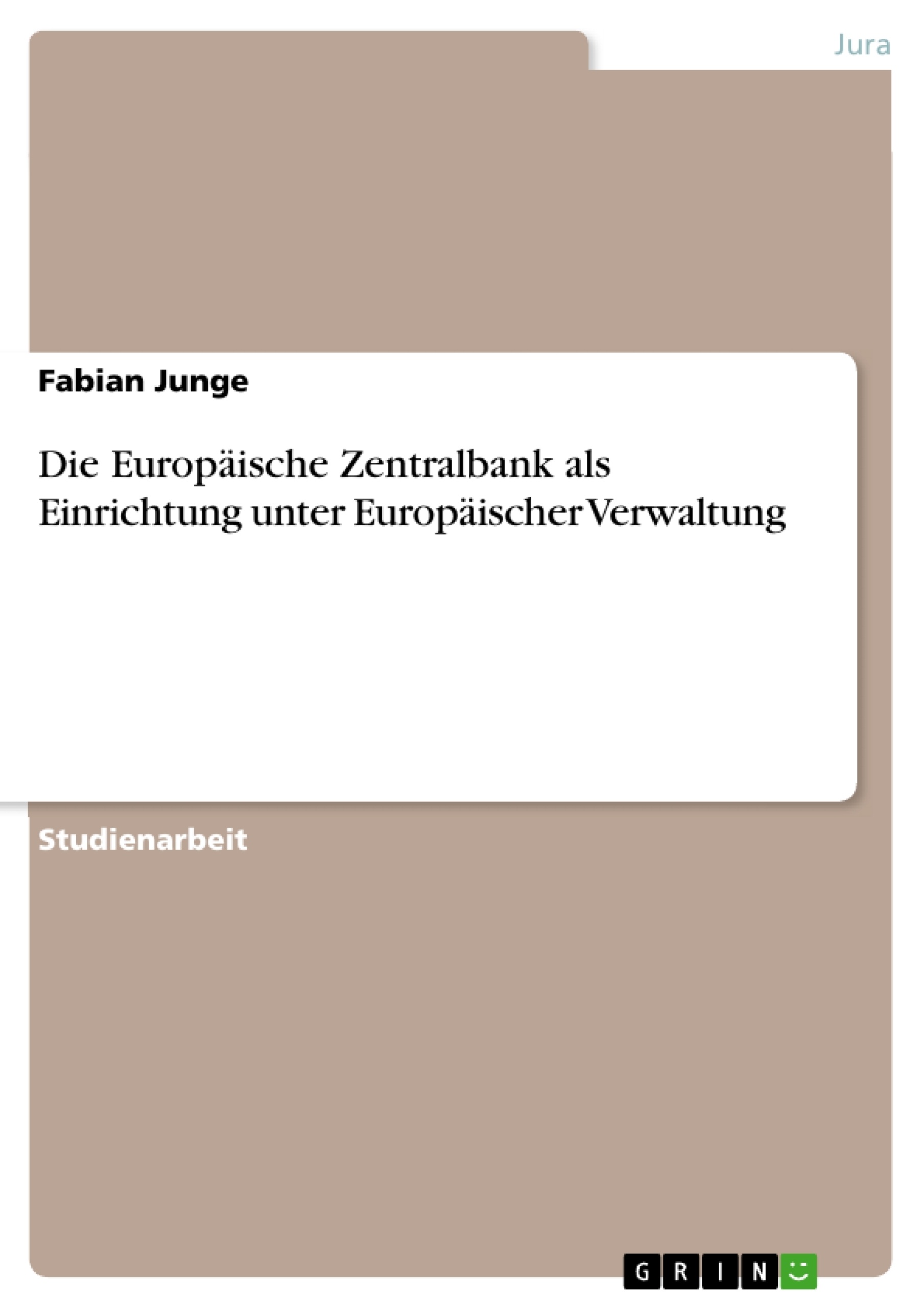Die europäische Finanz- und Wirtschaftspolitik ist und war in den letzten 12 Jahren geprägt von den Vorgaben der EZB. Vor allem in der Wirtschaftskrise ab 2007 verging kaum ein Monat an dem keine neue Stellungnahme oder gar eine neue Maßnahme der EZB in den Medien diskutiert wurde.
Gegenwärtig macht die EZB durch zwei Themen auf sich aufmerksam. Zum einen durch das Kräftemessen zwischen Frankreich und Deutschland, wer Jean-Claude Trichet im Oktober diesen Jahres als Präsident der EZB beerben soll und zum anderen durch das Anheben des Leitzins auf 1,25 Prozent, um die Inflation in der Euro-Zone zu bekämpfen.
Bei der Vielzahl an Nachrichten und Informationen über die EZB gerät die Tatsache, dass diese feste Größe in der europäischen Wirtschafts- und Währungspolitik das Ergebnis eines langwierigen Prozesses war, fast in Vergessenheit. Um dieser Entwicklung die gebührende Bedeutung beizumessen, beschäftigt sich diese Arbeit im ersten Teil damit, den Werdegang der europäischen Wirtschafts- und Währungspolitik anhand der wichtigsten Meilensteine zu skizzieren. Es folgt eine Auseinandersetzung mit dem institutionellen Rahmen des ESZB und der EZB, der die Basis für jegliche geldpolitischen Entscheidungen auf europäischer Ebene bildet. Im dritten Teil liegt der Fokus auf dem Verhältnis zwischen der EZB und der EU, im Speziellen auf der Schwierigkeit einer demokratischen Legitimation des EZB-Handelns und der Kontroverse um die Unabhängigkeit der EZB.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Die historische Entwicklung der EZB
- C. Der institutionelle Rahmen der EZB
- I. Rechtsstatus
- II. Aufgaben
- III. Organe
- 1. Der EZB-Rat
- 2. Das Direktorium
- 3. Der erweiterte EZB-Rat
- D. Die EZB und die Europäische Union
- I. Unabhängigkeit
- 1. Institutionelle Unabhängigkeit
- 2. Rechtliche Unabhängigkeit
- 3. Personelle Unabhängigkeit
- 4. Funktionelle und operative Unabhängigkeit
- 5. Finanzielle Unabhängigkeit
- II. Kontrollmechanismen
- 1. Berichts- und Rechenschaftspflichten
- 2. Demokratische Legitimität
- 4. Rechtliche Kontrolle
- I. Unabhängigkeit
- E. Kritische Betrachtung und Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Europäischen Zentralbank (EZB) und ihrer Rolle im Kontext der europäischen Verwaltung. Sie analysiert die historische Entwicklung der EZB, ihren institutionellen Rahmen, ihre Aufgaben und ihre Beziehung zur Europäischen Union. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Unabhängigkeit der EZB und den damit verbundenen Kontrollmechanismen. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen der demokratischen Legitimation und die Kritik an der EZB, insbesondere im Hinblick auf ihre Rolle in der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007.
- Die historische Entwicklung der EZB und die Entstehung der Wirtschafts- und Währungsunion
- Der institutionelle Rahmen der EZB, einschließlich ihrer Organe und Aufgaben
- Die Unabhängigkeit der EZB auf verschiedenen Ebenen: institutionell, rechtlich, personell, funktionell und finanziell
- Die Kontrollmechanismen der EZB, insbesondere Berichts- und Rechenschaftspflichten sowie die demokratische Legitimation
- Kritische Betrachtung der EZB, insbesondere im Hinblick auf ihre Rolle in der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Relevanz der EZB für die europäische Finanz- und Wirtschaftspolitik heraus. Sie skizziert die wichtigsten Themen, die in der Arbeit behandelt werden.
Das zweite Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der EZB, beginnend mit den ersten Schritten zur Europäischen Union bis hin zur Gründung der EZB im Jahr 1998. Es beschreibt die wichtigsten Meilensteine der europäischen Wirtschafts- und Währungspolitik.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem institutionellen Rahmen der EZB. Es erläutert den Rechtsstatus der EZB, ihre Aufgaben und ihre Organe: den EZB-Rat, das Direktorium und den erweiterten EZB-Rat.
Das vierte Kapitel analysiert das Verhältnis zwischen der EZB und der Europäischen Union, insbesondere die Unabhängigkeit der EZB. Es beschreibt die verschiedenen Ebenen der Unabhängigkeit, die in den Verträgen und der Satzung des ESZB und der EZB verankert sind.
Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit den Kontrollmechanismen, die die Unabhängigkeit der EZB gewährleisten sollen. Es erläutert die Berichts- und Rechenschaftspflichten der EZB sowie die demokratische Legitimation ihres Handelns.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Europäische Zentralbank (EZB), die Europäische Union (EU), die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU), die Preisstabilität, die Unabhängigkeit, die Kontrollmechanismen, die demokratische Legitimation, die Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007 und die Rolle der EZB in der Krisenbewältigung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Unabhängigkeit der EZB so wichtig?
Die Unabhängigkeit schützt die EZB vor politischer Einflussnahme, damit sie sich primär auf ihr Hauptziel, die Gewährleistung der Preisstabilität, konzentrieren kann.
Welche Organe steuern die Europäische Zentralbank?
Die EZB wird durch den EZB-Rat, das Direktorium und den erweiterten EZB-Rat geleitet, die jeweils unterschiedliche Entscheidungsbefugnisse haben.
Wie wird die EZB demokratisch kontrolliert?
Trotz ihrer Unabhängigkeit unterliegt die EZB Berichts- und Rechenschaftspflichten gegenüber dem Europäischen Parlament und wird rechtlich durch den EuGH kontrolliert.
Was sind die verschiedenen Ebenen der EZB-Unabhängigkeit?
Man unterscheidet zwischen institutioneller, rechtlicher, personeller, funktioneller (operativer) und finanzieller Unabhängigkeit.
Welche Rolle spielte die EZB in der Finanzkrise ab 2007?
Die EZB ergriff zahlreiche Maßnahmen und gab Stellungnahmen ab, um die Inflation zu bekämpfen und das europäische Finanzsystem während der Krise zu stabilisieren.
- Quote paper
- Fabian Junge (Author), 2011, Die Europäische Zentralbank als Einrichtung unter Europäischer Verwaltung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178388