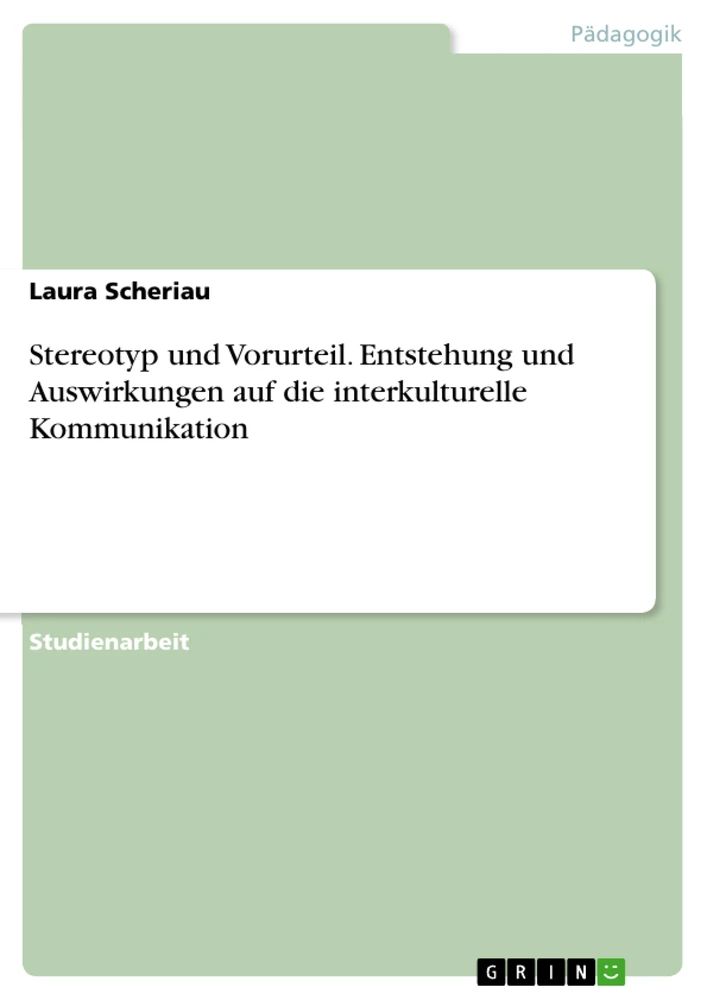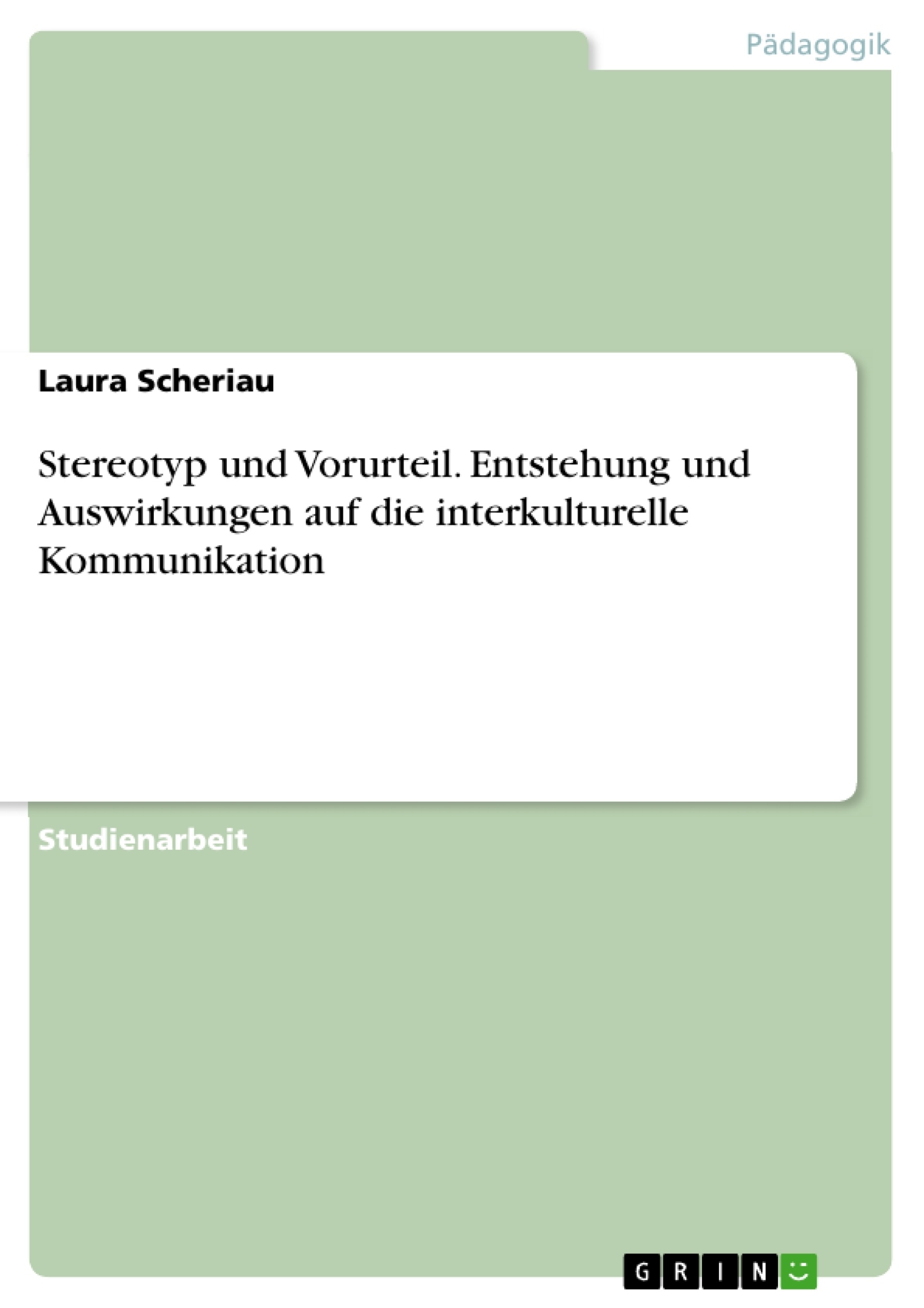Stereotype sind in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Egal ob in der Politik, im privaten Leben oder sogar im Fremdsprachenunterricht, überall entwickeln die Menschen Stereotype und Vorurteile. Wie genau diese entstehen und wie sie sich auf die interkulturelle Kommunikation auswirken ist das Thema dieser Arbeit.
Dabei ist zuerst einmal wichtig, die Unterschiede beziehungsweise Gemeinsamkeiten zwischen den Begriffen „Stereotyp“, „Vorurteil“, „Klischee“ und „Image“ zu definieren. Denn oft werden diese Begriffe wie Synonyme verwendet oder ein Begriff durch den anderen erklärt.
Wichtig ist auch die Funktion des Gedächtnisses und der sozialen Gemeinschaft in der Erklärung zur Bildung von Stereotypen und Vorurteilen. Nicht alle Menschen entwickeln unter ähnlichen Voraussetzungen die gleichen Vorurteile.
Als Letztes soll erörtert werden, wie und warum Stereotype im Fremdsprachenunterricht behandelt werden sollten. Dabei geht es weniger um lehrpsychologische Anweisungen, sondern eher um die soziale Komponente im Hinblick auf die Weiterverarbeitung der Informationen im Erwachsenenalter (bei Kindern) und im sozialen Umfeld (bei Erwachsenen).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinitionen
- 2.1. Stereotyp
- 2.2. Vorurteil
- 2.3. Klischee
- 2.4. Image
- 3. Das mentale Konstrukt
- 4. Drei Ansätze zur Bildung von Stereotypen
- 4.1. Der soziokulturelle Ansatz
- 4.2. Der kognitive Ansatz
- 4.3. Der psychodynamische/ persönlichkeitspsychologische Ansatz
- 5. Stereotype im Fremdsprachenunterricht
- 6. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Auswirkungen von Stereotypen und Vorurteilen, insbesondere im Kontext der interkulturellen Kommunikation und des Fremdsprachenunterrichts. Sie klärt zunächst die begrifflichen Grundlagen und analysiert verschiedene Ansätze zur Bildung von Stereotypen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Rolle von Stereotypen im Fremdsprachenunterricht und deren Bedeutung für die soziale Interaktion.
- Begriffliche Abgrenzung von Stereotyp, Vorurteil, Klischee und Image
- Analyse verschiedener Ansätze zur Entstehung von Stereotypen
- Die Funktion des Gedächtnisses und der sozialen Gemeinschaft bei der Stereotypenbildung
- Die Rolle von Stereotypen im Fremdsprachenunterricht
- Auswirkungen von Stereotypen auf die interkulturelle Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Stereotype und Vorurteile ein und betont deren weitverbreitete Präsenz in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Sie hebt die Bedeutung der Unterscheidung zwischen den Begriffen „Stereotyp“, „Vorurteil“, „Klischee“ und „Image“ hervor und kündigt die zentralen Fragestellungen der Arbeit an: die Entstehung von Stereotypen und deren Einfluss auf die interkulturelle Kommunikation, insbesondere im Kontext des Fremdsprachenunterrichts. Die Arbeit konzentriert sich auf die soziale Komponente der Weiterverarbeitung von Informationen im Erwachsenenalter und im sozialen Umfeld.
2. Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel klärt die verwendeten Schlüsselbegriffe. Es wird die oft synonym verwendete Begrifflichkeit von „Stereotyp“, „Vorurteil“ und „Klischee“ differenziert, wobei auf die feinen Unterschiede in den Bedeutungen eingegangen wird. Die Arbeit verweist auf die Schwierigkeiten der begrifflichen Abgrenzung, insbesondere im Vergleich zu Begriffen wie „Image“. Es wird dargelegt, warum in der Arbeit primär die Begriffe „Vorurteil“ und „Stereotyp“ im Vordergrund stehen und wie man diese Begriffe auch für nicht-muttersprachliche Sprecher verständlich macht. Die Schwierigkeit, die Begriffe auch für nicht franko- oder anglophone Studierende zu erklären, wird anhand von Beispielen wie „Alle Deutschen trinken Bier“ verdeutlicht. Die Kapitel beschreibt auch den Ursprung des Wortes Stereotyp aus dem Griechischen und erläutert dessen Bedeutung im sozialpsychologischen Kontext.
2.1. Stereotyp: Die Definition von Stereotyp wird in diesem Unterkapitel näher betrachtet. Der Begriff wird etymologisch hergeleitet, und seine Bedeutung als vereinfachendes und verallgemeinerndes Urteil wird erläutert. Es wird der Punkt gemacht, dass Stereotype über prinzipiell jedes Thema gebildet werden können und oft in der Werbung eingesetzt werden. Als Beispiel wird das im Ausland verbreitete Bild des „typischen Deutschen“ (Lederhose und Bierkrug) genannt.
2.2. Vorurteil: Der Begriff „Vorurteil“ wird anhand von Definitionen aus dem „Duden“ und dem Brockhaus erläutert. Es wird hervorgehoben, dass Vorurteile meist negativ wertend sind, ohne Prüfung objektiver Tatsachen gebildet werden und schwer abzubauen sind. Ein Beispiel für ein weitverbreitetes Vorurteil ist die Aussage „Die Ausländer nehmen unseren heimischen Arbeitern die Arbeitsplätze weg“, die im weiteren Verlauf der Arbeit vermutlich genauer untersucht wird. Das Kapitel hebt hervor, dass Vorurteile affektiv-emotionale Einstellungen transportieren, immun gegen die Realität sind und zu Aggression, Frustration und Hass führen können.
Schlüsselwörter
Stereotyp, Vorurteil, Klischee, Image, interkulturelle Kommunikation, Fremdsprachenunterricht, soziokultureller Ansatz, kognitiver Ansatz, psychodynamischer Ansatz, Gedächtnis, soziale Gemeinschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entstehung und Auswirkungen von Stereotypen und Vorurteilen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Entstehung und Auswirkungen von Stereotypen und Vorurteilen, insbesondere im Kontext der interkulturellen Kommunikation und des Fremdsprachenunterrichts. Sie analysiert verschiedene Ansätze zur Bildung von Stereotypen und deren Rolle im Fremdsprachenunterricht.
Welche Begriffe werden definiert und abgegrenzt?
Die Arbeit klärt die begrifflichen Grundlagen und differenziert zwischen den Begriffen „Stereotyp“, „Vorurteil“, „Klischee“ und „Image“. Es wird auf die feinen Unterschiede und die Schwierigkeiten der begrifflichen Abgrenzung eingegangen, insbesondere im Hinblick auf die Verständlichkeit für nicht-muttersprachliche Sprecher.
Welche Ansätze zur Stereotypenbildung werden untersucht?
Die Arbeit analysiert drei Ansätze zur Bildung von Stereotypen: den soziokulturellen Ansatz, den kognitiven Ansatz und den psychodynamischen/persönlichkeitspsychologischen Ansatz. Die Rolle des Gedächtnisses und der sozialen Gemeinschaft bei der Stereotypenbildung wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Rolle spielen Stereotype im Fremdsprachenunterricht?
Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Rolle von Stereotypen im Fremdsprachenunterricht und deren Bedeutung für die soziale Interaktion und interkulturelle Kommunikation. Die Auswirkungen von Stereotypen auf die interkulturelle Kommunikation werden untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu Begriffsdefinitionen (inkl. Unterkapiteln zu Stereotyp, Vorurteil, Klischee und Image), ein Kapitel zum mentalen Konstrukt, ein Kapitel zu den drei Ansätzen zur Stereotypenbildung, ein Kapitel zu Stereotypen im Fremdsprachenunterricht und abschließend eine Diskussion. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Stereotyp, Vorurteil, Klischee, Image, interkulturelle Kommunikation, Fremdsprachenunterricht, soziokultureller Ansatz, kognitiver Ansatz, psychodynamischer Ansatz, Gedächtnis, soziale Gemeinschaft.
Welche Beispiele werden verwendet?
Es werden verschiedene Beispiele verwendet, um die Begriffe zu veranschaulichen, z.B. das im Ausland verbreitete Bild des „typischen Deutschen“ (Lederhose und Bierkrug) oder das Vorurteil „Die Ausländer nehmen unseren heimischen Arbeitern die Arbeitsplätze weg“.
Auf welche Zielgruppe richtet sich die Arbeit?
Die Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum und zielt auf eine strukturierte und professionelle Analyse von Themen im Zusammenhang mit Stereotypen und Vorurteilen ab. Die Verständlichkeit der Begrifflichkeiten für nicht-muttersprachliche Sprecher wird besonders berücksichtigt.
- Arbeit zitieren
- Laura Scheriau (Autor:in), 2007, Stereotyp und Vorurteil. Entstehung und Auswirkungen auf die interkulturelle Kommunikation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178435